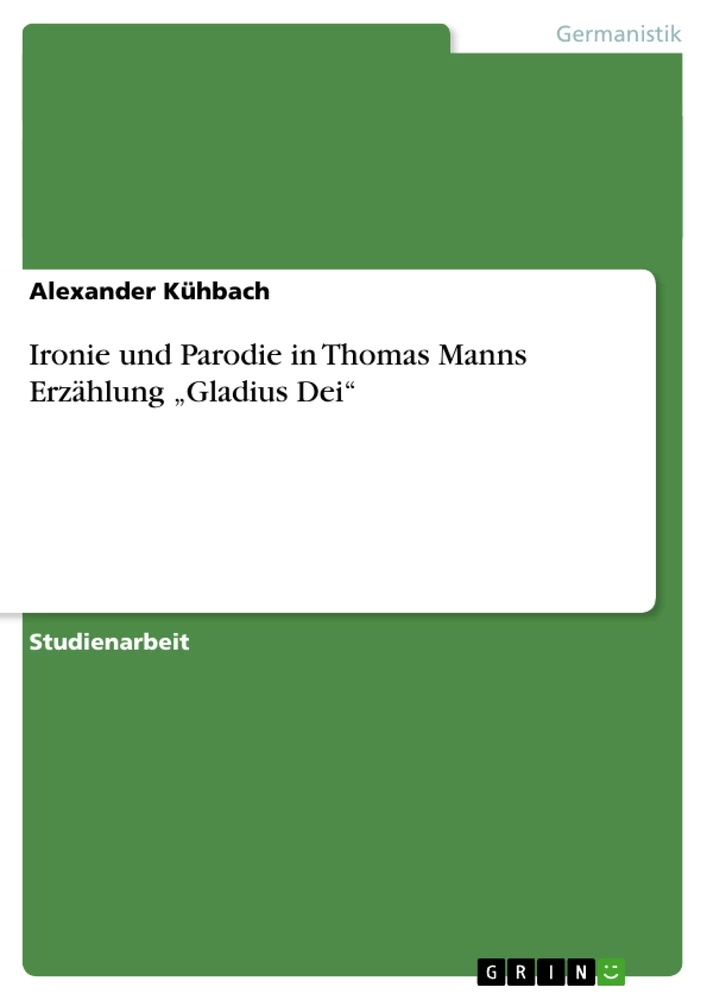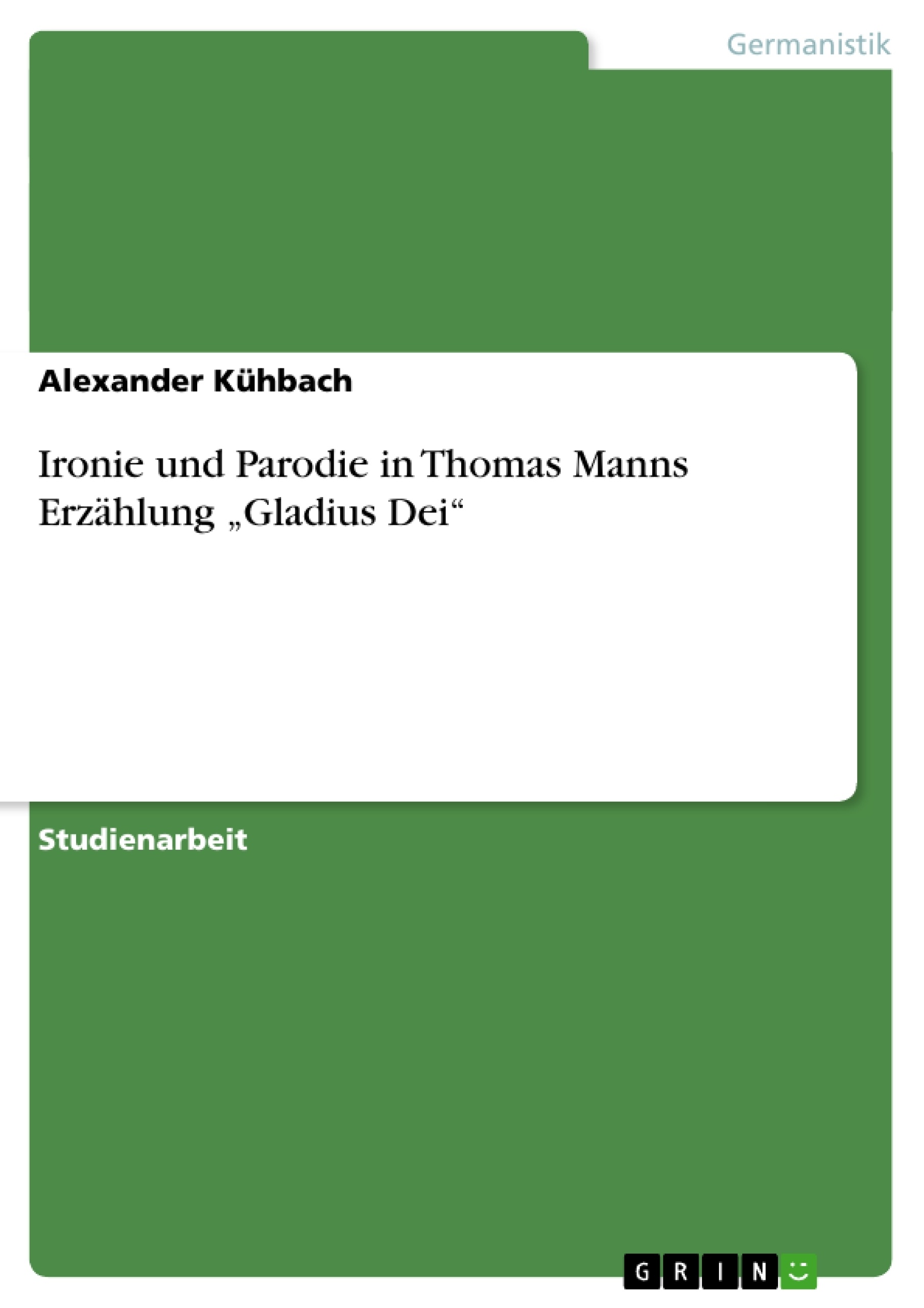Thomas Manns Erzählung „Gladius Dei“ erschien erstmals 1902 in der Wiener Zeitschrift „Die Zeit“ und wurde später in dem Novellenband „Tristan“ erneut veröffentlicht. Der Schauplatz der Erzählung ist das durch die Renaissance geprägte München um die Jahrhundertwende 1899/1900.
Augenscheinlich thematisiert diese Erzählung den Konflikt zwischen Moral und Werteverfall: Die Moral wird durch die Figur des Jünglings Hieronymus verkörpert, der Werteverfall durch die Kunst-Szene Münchens, versinnbildlicht durch ein Madonnenbild und durch das Geschäft, in dem das Stück angeboten wird. Dass Mann diesen Konflikt jedoch nicht ernsthaft behandelt, verdeutlicht die Darstellung der beiden Konfliktparteien: Ironisch, teilweise gar grotesk werden die Charaktere beschrieben.
Ziel dieser Arbeit ist es, eben jenen parodistischen Charakter der Erzählung „Gladius Dei“ herauszustellen.
Kapitel 1.1 setzt sich mit Manns Darstellung der Stadt München auseinander. Besonders die Architektur Münchens und einige Charaktere der Kunst-Szene sowie die Rolle, die sie in Manns Beschreibung spielen, werden hier untersucht. In Kapitel 1.2 steht das Kunstwerk, das Corpus Delicti, im Mittelpunkt – nicht nur, weil es eine zentrale Rolle in dieser Erzählung einnimmt, sondern auch, weil es eine Vielfalt an intertextuellen Bezügen widerspiegelt.
Das zweite Kapitel setzt sich mit dem Protagonisten der Erzählung, dem bereits erwähnten Hieronymus, sowie mit seinem historischen Vorbild, dem Prior Girolamo Savonarola, auseinander und stellt Vergleiche an. Hierzu wird eine kurze biographische Zusammenfassung von Savonarolas Leben und Wirken gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „München leuchtete“
- München
- Das Corpus Delicti
- Savonarola
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den parodistischen Charakter von Thomas Manns Erzählung „Gladius Dei“. Der Fokus liegt auf der ironischen Darstellung der Figuren und des Schauplatzes München.
- Ironische Darstellung Münchens als Kunstmetropole
- Parodie der Kunst-Szene und ihrer Akteure
- Intertextuelle Bezüge im „Corpus Delicti“
- Vergleich Hieronymus/Savonarola
- Analyse der moralischen Konflikte in der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Erzählung „Gladius Dei“ vor, ihren ersten Erscheinungsort und die Thematik des Konflikts zwischen Moral und Werteverfall. Es wird die Zielsetzung der Arbeit dargelegt: die Herausstellung des parodistischen Charakters der Erzählung.
„München leuchtete“ - München: Dieses Kapitel analysiert Manns Darstellung Münchens als scheinbare Kunstmetropole. Die Beschreibung der Architektur und der Charaktere der Kunstszene wird im Hinblick auf ihren ironischen Unterton untersucht. München wird als Inszenierung und Reproduktion, als künstliche Stadt dargestellt, die auf Tourismus ausgerichtet ist und im Wesentlichen auf Adaptionen und Vervielfältigungen beruht.
„München leuchtete“ - Das Corpus Delicti: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das zentrale Kunstwerk der Erzählung und seine intertextuellen Bezüge. Die detaillierte Analyse erfolgt im Haupttext.
Schlüsselwörter
Thomas Mann, Gladius Dei, Ironie, Parodie, München, Renaissance, Kunst, Kunstmarkt, Savonarola, Hieronymus, Moral, Werteverfall, Intertextualität, Reproduktion.
- Citar trabajo
- Alexander Kühbach (Autor), 2002, Ironie und Parodie in Thomas Manns Erzählung „Gladius Dei“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123329