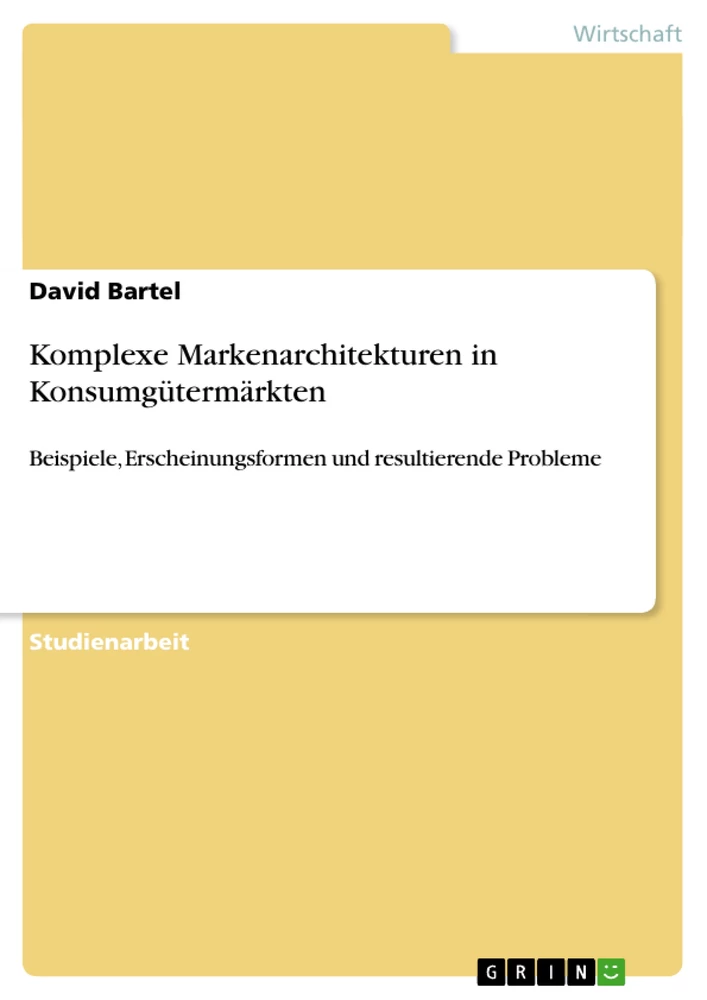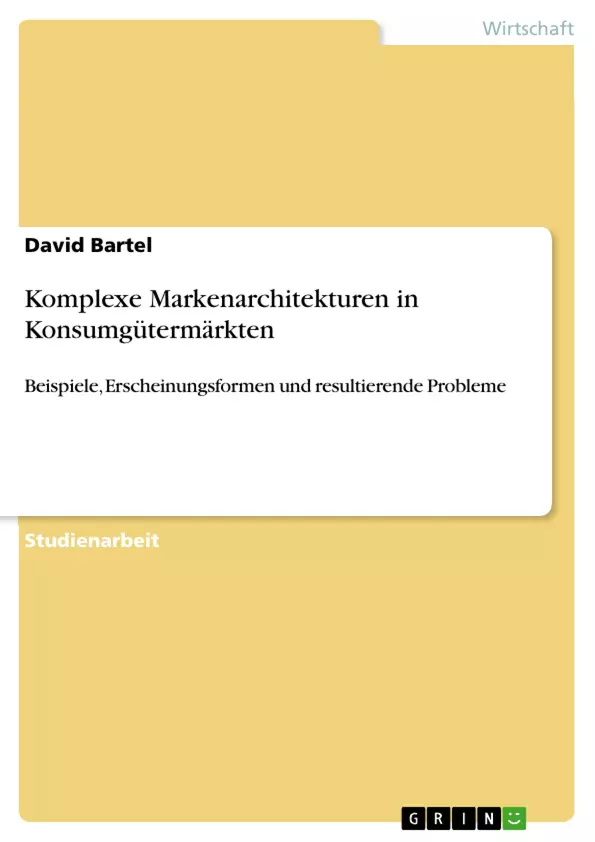Um den Aufbau einer geeigneten komplexen Markenarchitektur besser zu verstehen, ist es
wichtig zunächst auf den aktuellen Status einzugehen, d.h. bestehende Erscheinungsformen in
Klassifikationsansätzen einzuordnen. Um dies zu vereinfachen und zu veranschaulichen werden
Beispiele aus der Praxis direkt mit aufgeführt. Resultierende Probleme der bestehenden
Architekturen müssen erkannt und ausgeräumt werden, um die Gestaltung zu optimieren.
In der folgenden Studienarbeit wird zunächst auf die Marke eingegangen. Allgemeine Informationen,
sowie Definition und Historie werden kurz aufgezeigt, bevor auf die markenstrategischen
Grundtypen eingegangen wird. Bei komplexen Markenarchitekturen handelt es sich
um Kombinationen dieser Grundtypen. Danach werden kurz mögliche Ursachen zu deren
Entstehung dargestellt, bevor Klassifikationsansätze erklärt werden. Zuerst wird hierbei auf
Studienergebnisse eingegangen, die die unterschiedlichen Architekturen aus Sicht des Unternehmens
unterscheiden, bevor ein Modell aus Konsumentensicht vorgestellt wird. Zum
Schluss werden noch Empfehlungsansätze zur Gestaltung einer komplexen Markenarchitektur
beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
I Einleitung
II Die Marke
1 Begriff
2 Historie
3 Markenstrategien und Markenkombinationen
3.1 Klassische Markenstrategien (markenstrategische Grundtypen)
3.2 Horizontale Markenkombinationen
III Komplexe Markenarchitekturen
1 Markenarchitektur
2 Begriff
3 Ursachen für Entstehung
4 Klassifikationen
4.1 Markenhierarchien nach Laforet und Saunders
4.2 Brand Relationshipspectrum nach Aaker und Joachimsthaler
4.3 Wirkungsbezogene Klassifikation nach Esch und Bräutigam
5 Gestaltungsempfehlungen
IV Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Co-Branding von Milka und Cremissimo
Abbildung 2: Ausschnitt Markenarchitektur Unilever
Abbildung 3: Markenarchitektur-Matrix
Abbildung 4: Markenspektrum von der Markenfamilie Nivea (Beiersdorf)
Abbildung 5: Klassifikation der Markenarchitektur (Laforet/Saunders)
Abbildung 6: Spektrum der Markenarchitekturen (Aaker/Joachimsthaler)
Abbildung 7: Konsumentenbezogene Klassifikation von Markenarchitekturen
Abbildung 8: Konkurrierende Ziele der Markenarchitekturgestaltung
I Einleitung
Viele große Unternehmen besitzen in der heutigen Wirtschaft unzählige Marken für die ver- schiedensten Unternehmensbereiche und Produkte. Dabei gehen die Firmen ganz unterschied- lich mit dem Aufbau der Markenarchitektur und der Kommunikation zum Konsumenten hin um. Einige Unternehmen wie z.B. 3M kennzeichneten zeitweise ihre Produkte mit bis zu fünf Marken, andere hingegen benutzten nur eine (z.B. BMW oder Siemens). Wie der Aufbau ei- ner guten komplexen Markenarchitektur aussieht, ist bis heute wenig erforscht worden. Die ersten Klassifikationsansätze gibt es seit 1994. Das Führen von Marken ist teuer und bei eini- gen großen Unternehmen mit mehreren hunderten Marken auch sehr komplex und unüber- sichtlich. Viele Markenstrategien sind über Jahre aus der Historie gewachsen und von Unter- nehmensstrukturen abhängig, ohne dass sie jemals hinterfragt wurden.1 Aber der Konsument betrachtet die Markenwelt aus einer anderen Position als die Unternehmen. Für ihn ist es manchmal schwer sich im Markenwald zurecht zu finden. So überdenken viele Firmen die Struktur und den Umfang ihres Markenportfolios, damit die Vorzüge einer Marke auch wei- terhin und v.a. effizient genutzt werden können.
Um den Aufbau einer geeigneten komplexen Markenarchitektur besser zu verstehen, ist es wichtig zunächst auf den aktuellen Status einzugehen, d.h. bestehende Erscheinungsformen in Klassifikationsansätzen einzuordnen. Um dies zu vereinfachen und zu veranschaulichen wer- den Beispiele aus der Praxis direkt mit aufgeführt. Resultierende Probleme der bestehenden Architekturen müssen erkannt und ausgeräumt werden, um die Gestaltung zu optimieren.
In der folgenden Studienarbeit wird zunächst auf die Marke eingegangen. Allgemeine Infor- mationen, sowie Definition und Historie werden kurz aufgezeigt, bevor auf die markenstrate- gischen Grundtypen eingegangen wird. Bei komplexen Markenarchitekturen handelt es sich um Kombinationen dieser Grundtypen. Danach werden kurz mögliche Ursachen zu deren Entstehung dargestellt, bevor Klassifikationsansätze erklärt werden. Zuerst wird hierbei auf Studienergebnisse eingegangen, die die unterschiedlichen Architekturen aus Sicht des Unter- nehmens unterscheiden, bevor ein Modell aus Konsumentensicht vorgestellt wird. Zum Schluss werden noch Empfehlungsansätze zur Gestaltung einer komplexen Markenarchitektur beschrieben.
II Die Marke
1 Begriff
Sobald ein Artikel mit einer besonderen Kennzeichnung, also einer Markierung, versehen ist, spricht man von einem Markenartikel.2
Meffert bezeichnet die Marke als unverwechselbares Vorstellungsbild in der Psyche des Kon- sumenten von einem Produkt (bzw. Dienstleistung). Der Artikel wird in einem großen Ab- satzraum über einen längeren Zeitraum bei gleichartigem Auftritt und bei mindestens gleich- bleibender Qualität angeboten.3
Nach dem Markengesetz können "alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personen- namen, Abbildungen, (…) geschützt werden, die geeignet sind Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden"4.
Grundsätzlich strebt jedes Unternehmen nach Gewinnmaximierung. Die Markenpolitik soll den Markenwert steigern und mit der Kundenzufriedenheit die Markentreue und -bindung er- höhen. Dies gilt es mit Hilfe von folgenden psychologischen Zielen beim Konsumenten zu er- reichen: Eine Marke erleichtert die Identifikation eines Produktes. Sie leistet Orientierungshil- fe und schafft mit der Bekanntheit Vertrauen. Es liegt zumeist eine Vermutung nach Qualität vor, die so dem Konsumenten ein Gefühl von Sicherheit gibt. Nicht zu letzt leistet eine Marke eine Prestige- und Imagefunktion mit der sich der Nutzer von seinem Umfeld abheben oder profilieren will. Wenn diese Zusatznutzen von den Konsumenten akzeptiert werden, ist es für das Unternehmen möglich preispolitische Spielräume zu schaffen und die absatzfördernde Wirkung auszunutzen.5
2 Historie
Viele Unternehmen haben ursprünglich mit einem Produkt und einer Marke begonnen. Dies entspricht der Sichtweise des Markenpioniers Domizlaff, der behauptet „Eine Firma hat eine Marke. Zwei Marken sind zwei Firmen“6. Heute findet man nur noch selten solche Unter- nehmen, die ausschließlich ein einzelnes Produkt anbieten und dann auch nur dieses markie- ren (z.B. Jägermeister). So führen z.B. Unilever 400 Marken im klassischen Markenartikelge- schäft und Henkel sogar 1000. Auch auf Produktverpackungen findet man immer öfter mehre- re Markierungen. Insbesondere übergeordnete Unternehmensmarken werden mehr und mehr hinzugefügt.7
3 Markenstrategien und Markenkombinationen
Um komplexe Markenarchitekuren besser zu begreifen und die Abgrenzung zu anderen Mar- kenstrategien zu erleichtern, ist es sinnvoll kurz auf die Grundtypen der Markenstrategien, sowie deren Kombinationen einzugehen. Dabei werden zunächst Strategien mit Betrachtung auf nur eine Marke vorgestellt, die sog. klassischen Markenstrategien. Werden diese Strate- gien miteinander kombiniert, entstehen weitere Typen (vgl. Abbildung 3).
Im Gliederungspunkt II 3.2 werden horizontale Kombinationen erklärt, das bedeutet mehrere Marken werden nun in die Betrachtung mit einbezogen.
Kombinationen in horizontaler und vertikaler Ebene werden danach in Gliederungspunkt III
1.2 (= komplexe Markenarchitekturen) aufgezeigt. Hierbei werden mehrere Marken über verschiedene Hierachieebenen, also mit Über- und Unterordnungsverhältnissen betrachtet.
3.1 Klassische Markenstrategien (markenstrategische Grundtypen)
Einzelmarke: Bei einer Einzelmarkenstrategie (auch Produktmarken- oder Monomarkenstra- tegie genannt) nutzt das Unternehmen für jedes Produkt eine eigene Marke. Jedes Produkt lässt sich individuell auf dem Markt platzieren, womit eine einfache Bearbeitung unterschied- lichster Märkte möglich ist.8 Da die Herkunft der Artikel nicht ersichtlich ist, gibt es weder positive noch negative Imagetransfers innerhalb des Sortiments. Die Kosten pro Produkt sind im Vergleich zu einer der folgenden Strategien sehr hoch. Besonders geeignet ist eine Mono- markenstrategie für Unternehmen mit einem heterogenen Sortiment (z.B. Procter&Gamble mit Ariel, Meister Proper, Pampers), sowie bei innovativen Produkten. Dieser Strategietyp wurde (zumindest in seiner Reinform) im Laufe der Zeit immer weniger angewandt.9
[...]
1 Vgl. Laforet/Saunders (1999), S. 52ff.
2 Vgl. Mellerowicz (1963), S. 12f.
3 Vgl. Meffert (2000), S. 847; Vgl. Mellerowicz (1963), S. 25ff.
4 MarkenGesetz.§ 3 Abs. 1.
5 Vgl. Meffert/Bruhn (2006), S. 441; vgl. Meffert (2000), S. 847f ; Vgl. Mellerowicz (1963), S. 12ff.
6 Domizlaff (2005), S. 84.
7 Vgl. Goertz (2007), S. 14.
8 Vgl. Esch (2005), S. 413.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Studienarbeit befasst sich mit komplexen Markenarchitekturen. Sie untersucht die Struktur, Entstehung und Klassifikation solcher Architekturen, und gibt Gestaltungsempfehlungen.
Was sind die Ziele der Markenpolitik?
Die Markenpolitik zielt darauf ab, den Markenwert zu steigern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Markentreue und -bindung zu fördern. Dies soll durch psychologische Ziele wie Identifikation, Orientierungshilfe, Vertrauensaufbau, Qualitätsvermutung, Sicherheit und Prestige- und Imagefunktion erreicht werden.
Welche klassischen Markenstrategien gibt es?
Die Arbeit geht auf die Einzelmarkenstrategie (auch Produktmarken- oder Monomarkenstrategie genannt) ein, bei der jedes Produkt eine eigene Marke hat.
Was sind komplexe Markenarchitekturen?
Komplexe Markenarchitekturen entstehen durch die Kombination verschiedener Markenstrategien auf horizontaler und vertikaler Ebene, also mit Über- und Unterordnungsverhältnissen.
Warum überdenken Unternehmen ihre Markenportfolios?
Viele Firmen überdenken die Struktur und den Umfang ihres Markenportfolios, um die Vorzüge einer Marke weiterhin effizient nutzen zu können. Dies geschieht oft aufgrund von historisch gewachsenen, unübersichtlichen und teuren Markenstrategien, die vom Konsumenten schwer zu durchschauen sind.
Was wird im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Einleitung, die Marke (Begriff, Historie, Markenstrategien und Markenkombinationen), komplexe Markenarchitekturen (Begriff, Ursachen für Entstehung, Klassifikationen, Gestaltungsempfehlungen), Schlussbemerkungen und Literaturverzeichnis.
- Quote paper
- David Bartel (Author), 2008, Komplexe Markenarchitekturen in Konsumgütermärkten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123401