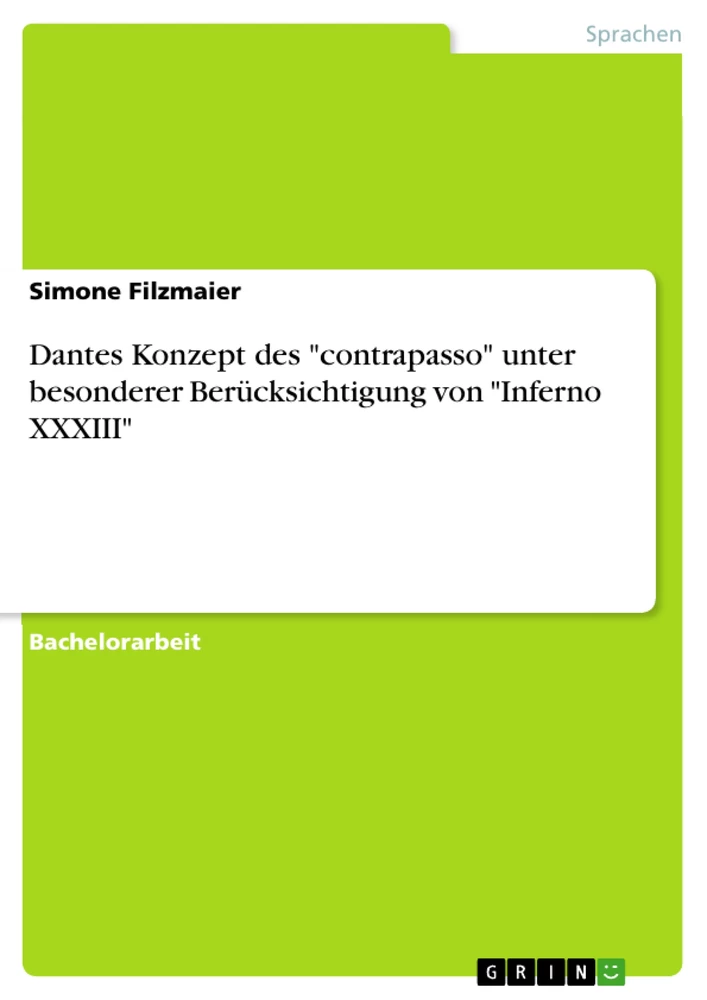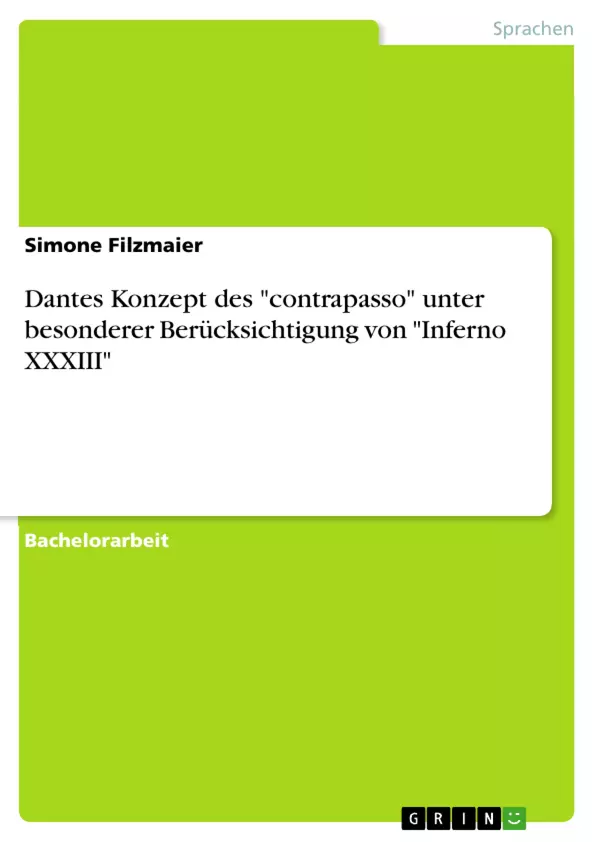Wie in der vorliegenden Arbeit ersichtlich wird, ist der "contrapasso" als Modell der Vergeltung keineswegs eine Erfindung des padre della lingua italiana, wie Dante Alighieri liebevoll genannt wird. Vielmehr handelt es sich um ein schon lange in der Gesellschaft verankertes Konzept, dessen Etymologie in dieser Arbeit thematisiert wird.
Weiters wird verdeutlicht, dass der Schmerz, den die Sünder des Inferno dantesco erleiden, nicht auf ein einziges Leid zurückzuführen ist, das sie quält. Vielmehr ist es ein ganzes Paket an Martern, das den Schatten auf ewig zusetzt. Unter der Pein der Sinne, die poena sensus, fallen die dem Leser offensichtlichen und grausam beschriebenen Leiden der Sünder, die ein wesentlicher, den Leser belehrender, Bestandteil des Inferno sind. Was die Innerlichkeit eines Schattens der Hölle betrifft, wird in der Arbeit klar hervorgehoben, dass auch hier in mehrfacher Hinsicht gelitten wird. Neben der poena damnis, der Entziehung Gottes, ist es in den meisten Fällen die immer wiederkehrende Erinnerung an das irdische Leben mitsamt den dort verrichteten Schandtaten, die den Seelen ewige Unruhe und Unzufriedenheit beschert.
Die Sünde eines Schattens zeichnet sich, wie mehrmals unterstrichen, in der Realisierung des contrapasso ab. Hierbei schließt sich der Kreis, wenn gesagt wird, dass es die Strafe als Spiegelbild oder zumindest im engen Verhältnis zur Sünde selbst ist, die eine Seele aber und abermals an das erinnert, was ihr unendliche Qualen bereitet: ihre eigene Verfehlung. Bezüglich Dantes Methoden der Umsetzung des contrapasso wird unter dem Punkt 3.2. eine grobe, aber relevante, Unterscheidung vorgenommen: die Distinktion der contrapassi per analogia von den contrapassi di contrasto. Besonders das letzte Kapitel (ab Punkt 4) soll bestmöglich Aufschluss darüber geben, zu welchen Methoden der Autor in den konkreten Fällen greift, um die Evidenz der Sünde in der Vergeltung zu gewährleisten. Die Verbildlichung des Vergehens mithilfe von Metaphern hat es Dante Alighieri ermöglicht, das nicht Darstellbare mit Worten so genau zu beschreiben, dass der Leser beinahe dazu gezwungen ist, sich das Szenario bildlich vorzustellen. Das Zusammenspiel von verschiedenen untereinander abhängigen Strafen, wie am Beispiel von Ugolino und dem Erzbischof Ruggieri, ergibt einen funktionierenden Kreislauf, demnach die Strafe des einen gleichzeitig die Strafe des anderen ergibt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Il contrapasso
- 2.1. Das Talionsprinzip der Bibel als Modell der Vergeltung
- III. Inferno: das Leiden in seiner Mannigfaltigkeit
- 3.1. La Tenebra, sofferenza e nudità
- 3.2. Der contrapasso der Analogie und der Antithese
- 3.3. Le pene nell'Inferno
- 3.4. Vergeltung und Belohnung in den weiteren cantiche
- 3.4.1. Purgatorio
- 3.4.2. Paradiso
- IV. Dantes Darstellung des contrapasso im nicht-theoretischen Rahmen
- 4.1. Die Körperlichkeit der Schatten als Merkmal in der Commedia
- 4.2. Die contrapassi in konkreten, ausgewählten Fällen
- 4.2.1. Canto V: Francesca e Paolo
- 4.2.2. Canto XXVIII: Bertran de Born
- 4.2.3. Canto XXXIII: l'episodio e contrapasso di Ugolino Della Gherardesca
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Konzept des Contrapasso in Dantes Inferno, insbesondere seine Anwendung im Canto XXXIII. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Contrapasso, analysiert seine Umsetzung in verschiedenen Episoden der Hölle und untersucht die Darstellungstechniken Dantes. Die Arbeit möchte die Gerechtigkeit in Dantes Inferno ergründen und die Beziehung zwischen Sünde und Strafe aufzeigen.
- Das Konzept des Contrapasso und seine historischen Wurzeln
- Die Anwendung des Contrapasso im Inferno
- Die Darstellungstechniken Dantes zur Veranschaulichung des Contrapasso
- Die Beziehung zwischen Sünde und Strafe im Inferno
- Detaillierte Analyse des Canto XXXIII und des Falls Ugolino della Gherardesca
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext, in dem sich Dante beim Schreiben der Divina Commedia befand. Sie erläutert die Bedeutung des Gefühls der Verlorenheit und die Notwendigkeit einer gerechten Vergeltung für begangene Sünden als Grundlage für den Transfer von Seelen in die Hölle. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gerechtigkeit im Inferno und die zentrale Rolle des Contrapasso als Modell dieser Gerechtigkeit.
II. Il contrapasso: Dieses Kapitel behandelt das Konzept des Contrapasso selbst. Es wird auf die biblischen Ursprünge des Talionsprinzips eingegangen und verschiedene Definitionen des Contrapasso, sowohl antike als auch moderne, diskutiert. Der Fokus liegt auf der mittelalterlichen Vorstellung von Gerechtigkeit, welche das dantesche Konzept des Contrapasso beeinflusst hat.
III. Inferno: das Leiden in seiner Mannigfaltigkeit: Dieses Kapitel analysiert die vielfältigen Formen des Leidens in der Hölle. Es untersucht den Contrapasso der Analogie und der Antithese und behandelt die verschiedenen Strafen, die den Sündern auferlegt werden. Ein Vergleich mit den Strafen im Purgatorio und Paradiso wird angedeutet, um die Gesamtheit des Systems zu veranschaulichen.
IV. Dantes Darstellung des contrapasso im nicht-theoretischen Rahmen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die konkrete Darstellung des Contrapasso in ausgewählten Cantos. Es untersucht die Körperlichkeit der Schatten und die Art und Weise, wie Dante das Prinzip des Contrapasso auf individuelle Fälle anwendet. Die Analyse spezifischer Beispiele aus den Cantos V, XXVIII und XXXIII soll die verschiedenen Aspekte und Umsetzungsmöglichkeiten des Contrapasso verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Contrapasso, Divina Commedia, Inferno, Dante Alighieri, Gerechtigkeit, Vergeltung, Sünde, Strafe, Talionsprinzip, Canto XXXIII, Ugolino della Gherardesca, Mittelalter, mittelalterliche Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Dantes Contrapasso im Inferno
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Konzept des Contrapasso in Dantes Inferno, insbesondere dessen Anwendung im Canto XXXIII. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Contrapasso, analysiert seine Umsetzung in verschiedenen Episoden der Hölle und untersucht Dantes Darstellungstechniken. Ein Schwerpunkt liegt auf der Gerechtigkeit in Dantes Inferno und der Beziehung zwischen Sünde und Strafe.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Konzept des Contrapasso und seine historischen Wurzeln, die Anwendung des Contrapasso im Inferno, Dantes Darstellungstechniken zur Veranschaulichung des Contrapasso, die Beziehung zwischen Sünde und Strafe im Inferno und eine detaillierte Analyse des Canto XXXIII und des Falls Ugolino della Gherardesca.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einleitung: Einführung in die Thematik, Kontext der Divina Commedia, Bedeutung von Verlorenheit und gerechter Vergeltung. II. Il contrapasso: Das Konzept des Contrapasso, biblische Ursprünge (Talionsprinzip), verschiedene Definitionen. III. Inferno: das Leiden in seiner Mannigfaltigkeit: Formen des Leidens in der Hölle, Contrapasso der Analogie und Antithese, Strafen im Inferno, Vergleich mit Purgatorio und Paradiso. IV. Dantes Darstellung des contrapasso im nicht-theoretischen Rahmen: Konkrete Darstellung des Contrapasso in ausgewählten Cantos, Körperlichkeit der Schatten, Analyse von Cantos V, XXVIII und XXXIII. V. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche konkreten Beispiele aus dem Inferno werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Fälle von Francesca und Paolo (Canto V), Bertran de Born (Canto XXVIII) und Ugolino della Gherardesca (Canto XXXIII), um die verschiedenen Aspekte und Umsetzungsmöglichkeiten des Contrapasso zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Contrapasso, Divina Commedia, Inferno, Dante Alighieri, Gerechtigkeit, Vergeltung, Sünde, Strafe, Talionsprinzip, Canto XXXIII, Ugolino della Gherardesca, Mittelalter, mittelalterliche Gerechtigkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die Gerechtigkeit in Dantes Inferno ergründen und die Beziehung zwischen Sünde und Strafe aufzeigen, indem sie das Konzept des Contrapasso detailliert untersucht und anhand konkreter Beispiele aus dem Inferno veranschaulicht.
- Quote paper
- Simone Filzmaier (Author), 2021, Dantes Konzept des "contrapasso" unter besonderer Berücksichtigung von "Inferno XXXIII", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1234794