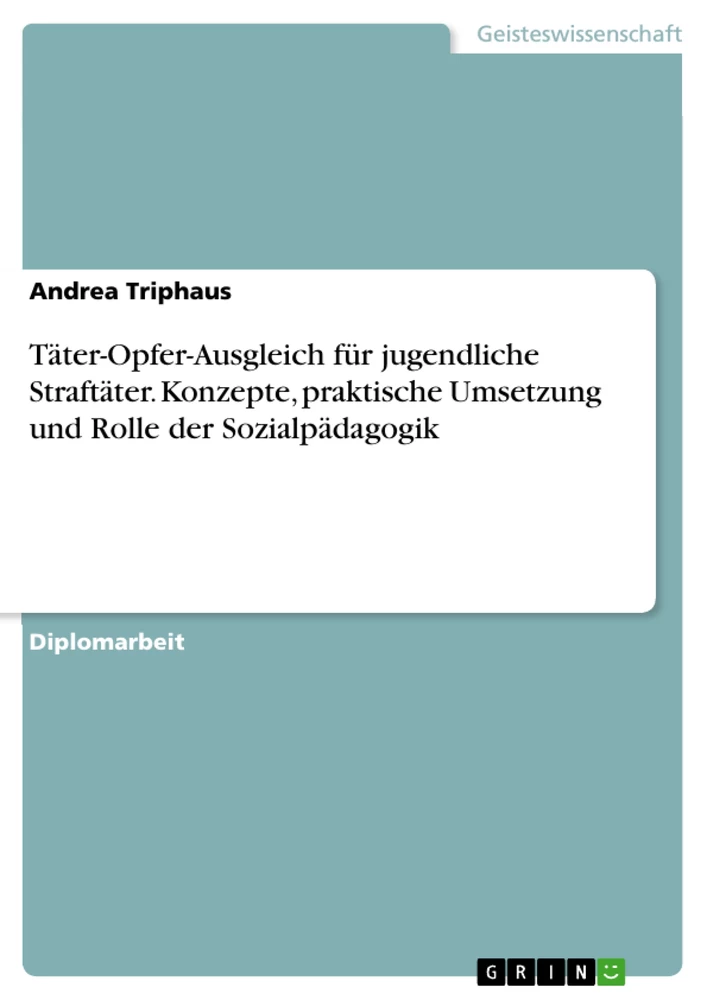Wenn Jugendliche Straftaten begehen, steht die Frage im Vordergrund, wie das begangene Unrecht geahndet und/oder der Jugendliche erzogen werden soll. Diese Konzentration auf den Täter und der vergebliche Versuch, mit Hilfe von Repression der weit verbreiteten Jugendkriminalität wirksam zu begegnen, war dabei zumindest bis vor einigen Jahren der Regelfall. Angesichts der Kontraproduktivität dieses Vorgehens begab man sich jedoch auf die Suche nach alternativen Reaktionsformen und erweiterte dabei den Blickwinkel auf eine Seite der Kriminalität, die bislang innerhalb der kriminalpolitischen Überlegungen so gut wie keine Rolle gespielt hatte: Das Opfer und mit diesem der Gedanke der Versöhnung als maßgeblicher Faktor zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens rückten zunehmend ins Zentrum des Interesses. Es entstand ein Konzept, dessen Kern nicht in der Bestrafung oder Erziehung des jugendlichen Delinquenten besteht, sondern in einer Aufarbeitung der Tat und der Folgen innerhalb eines gemeinsamen Gesprächs zwischen Täter und Opfer und der Wiedergutmachung des angerichteten Schadens durch den Täter.
Mit der Einführung dieses sogenannten „Täter-Opfer-Ausgleichs“ in den jugendstrafrechtlichen Reaktionskatalog wurde ein neuer Weg im Umgang mit jugendlichen Straftätern beschritten, der Abstand nimmt von Rache und Vergeltungsbestrebungen und der die Wahrnehmung der Opferinteressen gleichwertig neben die Unterstützung und Hilfe des jugendlichen Delinquenten stellt.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, auf Basis einer umfassenden Darstellung von Theorie und Praxis des Täter-Opfer-Ausgleichs, die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität dieser Maßnahme,auch aus dem Blickwinkel der Sozialpädagogik, zu untersuchen.
Dabei sollen zunächst die Hintergründe zur Entstehung und die Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs vorgestellt werden, um daraufhin seine Anwendungsmöglichkeiten nach dem Jugendgerichtsgesetz zu untersuchen. In einem weiteren Schritt wird auf die methodische Grundorientierung des Täter-Opfer-Ausgleichs, das Mediationskonzept, näher eingegangen, an die sich eine Darstellung der Grundlagen des Täter-Opfer-Ausgleichs anschließt. Wie und mit welchem Erfolg diese neue Reaktionsform in der Praxis umgesetzt wird, behandelt der nächstfolgende Punkt. Abschließend steht die Rolle der Sozialpädagogik im Zentrum der Diskussion, um vor allem zu überprüfen, welche Chancen oder auch Gefahren der Täter-Opfer-Ausgleich für diese birgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergründe zur Entstehung und Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs
- 2.1. Zum Begriff „Täter-Opfer-Ausgleich“
- 2.2. Historischer Hintergrund des Täter-Opfer-Ausgleichs: der Wiedergutmachungsgedanke
- 2.3. Konstitutionsbedingungen des Täter-Opfer-Ausgleichs
- 2.4. Entwicklung und Stand des Täter-Opfer-Ausgleichs in Deutschland
- 3. Der Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht
- 3.1. Der Erziehungs- und Subsidiaritätsgedanke des Jugendstrafrechts
- 3.2. Der Täter-Opfer-Ausgleich nach dem JGG
- 4. Das Mediationskonzept als Grundorientierung des Täter-Opfer-Ausgleichs
- 5. Zum Konzept Täter-Opfer-Ausgleich
- 5.1. Zielsetzung und Möglichkeiten
- 5.2. Falleignungskriterien
- 5.3. Trägerschaft und Organisationsform
- 5.4. Opferfonds
- 6. Der Täter-Opfer-Ausgleich in der Praxis
- 6.1. Ablauf eines TOA-Verfahrens
- 6.2. Fallbeispiele aus der Praxis
- 6.3. Die Vermittlungstätigkeit im Täter-Opfer-Ausgleich
- 6.4. Zur Akzeptanz des Täter-Opfer-Ausgleichs
- 6.5. Zum Erfolg und zur Effizienz des Täter-Opfer-Ausgleichs
- 7. Die Rolle der Sozialpädagogik im Täter-Opfer-Ausgleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) für jugendliche Straftäter, insbesondere unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. Die Studie beleuchtet die theoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung des TOA.
- Entstehung und Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs
- Der TOA im Jugendstrafrecht und das Mediationskonzept
- Praktische Umsetzung des TOA und Fallbeispiele
- Die Rolle der Sozialpädagogik im TOA
- Akzeptanz und Effizienz des TOA
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des traditionellen Jugendstrafrechts heraus, das sich oft als kontraproduktiv erweist. Sie führt den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) als alternative Reaktionsform ein, die den Fokus auf Versöhnung und Wiedergutmachung legt, anstatt ausschließlich auf Bestrafung.
2. Hintergründe zur Entstehung und Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff des TOA, seinen historischen Hintergrund im Wiedergutmachungsgedanken und die kriminologischen Erkenntnisse, die zu seiner Entwicklung beitrugen. Es analysiert die Konstitutionsbedingungen des TOA und seinen aktuellen Stand in Deutschland, unter Berücksichtigung der anhaltenden Kritik am traditionellen Strafsystem und der Bedeutung der Viktimologie.
3. Der Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht: Dieser Abschnitt untersucht die Einbettung des TOA in das Jugendgerichtsgesetz (JGG). Er analysiert den Erziehungs- und Subsidiaritätsgedanken des JGG und wie der TOA diese Prinzipien umsetzt. Der Fokus liegt auf der Kompatibilität des TOA mit den grundlegenden Zielen des Jugendstrafrechts.
4. Das Mediationskonzept als Grundorientierung des Täter-Opfer-Ausgleichs: Dieses Kapitel erläutert das Mediationskonzept als methodische Grundlage des TOA. Es beschreibt die Prinzipien der Mediation und wie diese im TOA-Prozess angewendet werden, um eine einvernehmliche Lösung zwischen Täter und Opfer zu ermöglichen.
5. Zum Konzept Täter-Opfer-Ausgleich: Hier werden die Zielsetzungen und Möglichkeiten des TOA detailliert dargestellt, inklusive der Fallauswahlkriterien, der Trägerschaft und Organisationsform sowie der Rolle von Opferfonds.
6. Der Täter-Opfer-Ausgleich in der Praxis: Dieser zentrale Abschnitt beschreibt den Ablauf eines TOA-Verfahrens von der Fallzuweisung bis zum Abschluss, inklusive Fallbeispiele. Die Rolle der Vermittlungsperson, ihre Aufgaben und Qualifikationen werden ebenso erörtert, wie die Akzeptanz des TOA bei Tätern, Opfern und der Justiz sowie die Erfolgsmessung und Effizienz des Verfahrens.
7. Die Rolle der Sozialpädagogik im Täter-Opfer-Ausgleich: Das abschließende Kapitel vor der Schlussbetrachtung untersucht die Bedeutung und den Beitrag der Sozialpädagogik im TOA-Prozess. Es analysiert die Chancen und Herausforderungen, die der TOA für Sozialpädagogen darstellt und wie diese professionell im TOA-Kontext agieren können.
Schlüsselwörter
Täter-Opfer-Ausgleich, Jugendstrafrecht, Mediation, Wiedergutmachung, Viktimologie, Sozialpädagogik, Jugendkriminalität, Konfliktlösung, Resozialisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) im Jugendstrafrecht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Sinnhaftigkeit und Praktikabilität des TOA für jugendliche Straftäter, insbesondere unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entstehung und Entwicklung des TOA, seine Einbettung in das Jugendgerichtsgesetz (JGG), das zugrundeliegende Mediationskonzept, die praktische Umsetzung inklusive Fallbeispiele, die Rolle der Sozialpädagogik im TOA-Prozess, sowie die Akzeptanz und Effizienz des Verfahrens. Es werden die Zielsetzung und Möglichkeiten des TOA, Fallauswahlkriterien, Trägerschaft und Organisationsformen sowie die Rolle von Opferfonds erläutert.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) für jugendliche Straftäter unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. Es werden die theoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung des TOA beleuchtet.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Hintergründe zur Entstehung und Entwicklung des TOA, Der TOA im Jugendstrafrecht, Das Mediationskonzept, Das TOA-Konzept, Der TOA in der Praxis und Die Rolle der Sozialpädagogik im TOA. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst. Zusätzlich enthält es ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was ist der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)?
Der Täter-Opfer-Ausgleich ist eine alternative Reaktionsform im Jugendstrafrecht, die im Gegensatz zum traditionellen Strafrecht den Fokus auf Versöhnung und Wiedergutmachung legt. Er basiert auf dem Mediationskonzept und zielt darauf ab, eine einvernehmliche Lösung zwischen Täter und Opfer zu finden.
Welche Rolle spielt die Mediation im TOA?
Das Mediationskonzept ist die methodische Grundlage des TOA. Die Prinzipien der Mediation werden angewendet, um einen konstruktiven Dialog zwischen Täter und Opfer zu ermöglichen und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Welche Rolle spielt die Sozialpädagogik im TOA?
Sozialpädagogen spielen eine wichtige Rolle im TOA-Prozess. Sie unterstützen die Beteiligten, begleiten das Verfahren und tragen zur erfolgreichen Durchführung bei. Das Dokument analysiert die Chancen und Herausforderungen für Sozialpädagogen im TOA-Kontext.
Wie wird der Erfolg und die Effizienz des TOA gemessen?
Das Dokument beleuchtet die Erfolgsmessung und Effizienz des TOA-Verfahrens. Es wird untersucht, wie die Akzeptanz des TOA bei Tätern, Opfern und der Justiz bewertet und die Effektivität des Verfahrens gemessen werden kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter umfassen: Täter-Opfer-Ausgleich, Jugendstrafrecht, Mediation, Wiedergutmachung, Viktimologie, Sozialpädagogik, Jugendkriminalität, Konfliktlösung, Resozialisierung.
- Citar trabajo
- Andrea Triphaus (Autor), 2003, Täter-Opfer-Ausgleich für jugendliche Straftäter. Konzepte, praktische Umsetzung und Rolle der Sozialpädagogik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12348