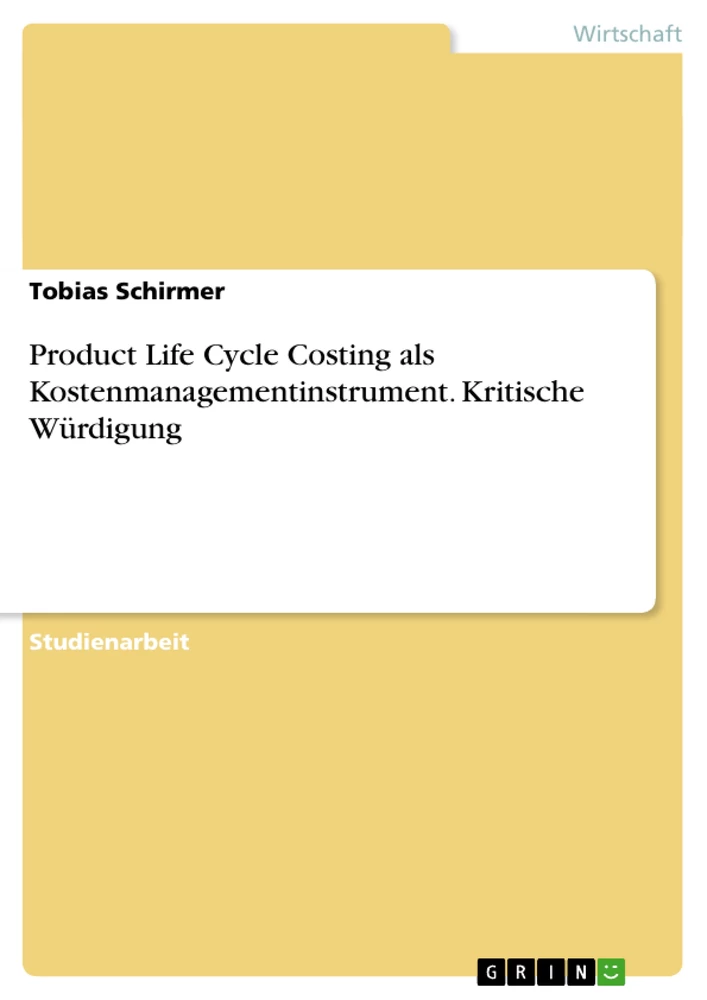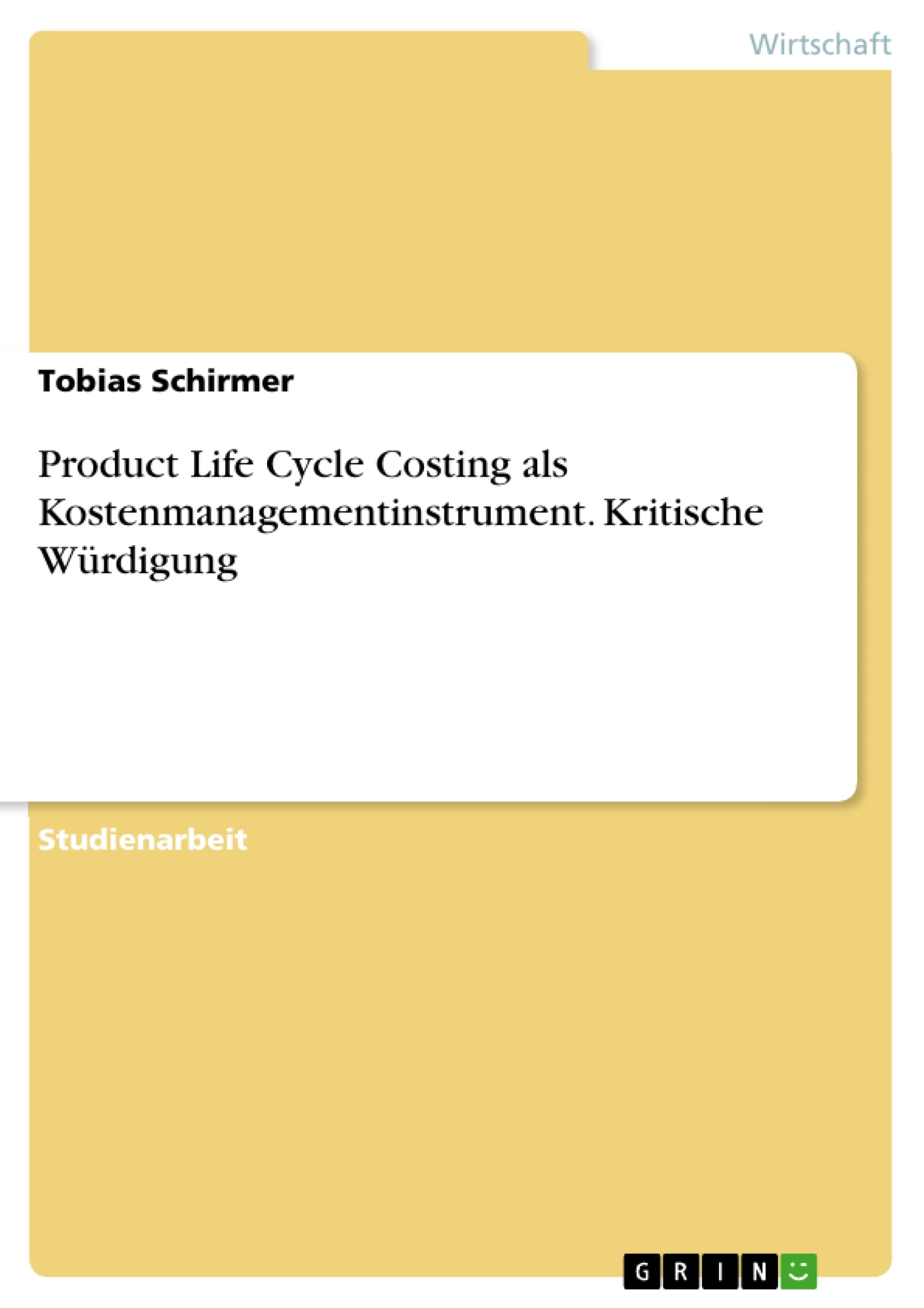Rechnungskonzepte die sich mit der Betrachtung von Lebenszyklen befassen, wurden in der Literatur unterschiedlich diskutiert. Der größte Teil der verschiedenen Konzepte ist in den USA im Rahmen des Life Cycle Costings entstanden.
Dieses Konzept des Life Cycle Costings wurde in den fünfziger Jahren fast aus-schließlich vom United States Department of Defense entwickelt. Es diente als Entscheidungshilfe für die Beschaffung von Waffensystemen. Später wurde dieses Konzept auch zum Teil bei der Vergabe von öffentlichen Bauprojekten angewendet. Dabei steht im Vordergrund, dass die Investitionsentscheidung durch eine umfassende Betrachtung der Kosten, insbesondere Anschaffungs- und Folgekosten, unterstützt wird. Des Weiteren sollten die Gesamtkosten während der Systemkonzeption positiv beeinflusst werden. Es wird also die Wirtschaftlichkeit des Produktes überprüft.
Das Konzept des Life Cycle Costings kann jedoch auch auf andere Sektoren wie zum Beispiel die Erschließung neuer Märkte, Zweigwerkerrichtung oder auch Beteiligungserwerbe übertragen werden.
Es wird versucht, alle anfallenden Kosten die während eines Lebenszyklus entstehen, dem Produkt zuzuordnen. Die Erfassung dieser Kosten findet periodenübergreifend statt, also von der Entstehung bis hin zur Entsorgung des Produktes. Diese Überlegung ist heutzutage sehr sinnvoll, da die Produktlebenszyklen immer kürzer und kürzer werden. Lebenszyklen von zwei bis zu fünf Jahren sind keine Seltenheit mehr, da Produkte immer schneller von neuen Entwicklungen und Produktinnovationen auf dem Markt abgelöst werden. Aufgrund dieser Marktsituation erhöhen sich die Gemeinkosten für Forschung und Entwicklung, den sogenannten Vorlaufkosten, und stellen einen immer wichtigeren Kostenfaktor dar.
„Hauptaufgabe des Lifecyle Costing ist die frühzeitige Kostenbeeinflussung, wobei grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass bereits in den Phasen der Entwicklung und Konstruktion bis zu 70 % der späteren Kosten eines Produkts verbindlich festgelegt werden und mit der zunehmenden Entwicklungsreife der Spielraum der Kostengestaltung deutlich abnimmt.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begriff des Life Cycle Costing
- 1.2 Ziele der Ausarbeitung
- 2. Produktlebenszyklus
- 2.1 Vorlaufkosten / Vorlauferlöse
- 2.2 Nachlaufkosten / Nachlauferlöse
- 3. Product Life Cycle Costing aus Produzentensicht
- 3.1 Verrechnung der Vorlauf- und Nachlaufkosten
- 3.2 Probleme der Kostenverrechnung
- 4. Product Life Cycle Costing aus Kundensicht
- 5. Anwendung des Life Cycle Costing
- 5.1 Verschiedene Methoden der Kostenprognose
- 5.2 Vorteile und Nutzen des Life Cycle Costing
- 5.3 Defizite des Life Cycle Costing
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Product Life Cycle Costing (LCC) als Kostenmanagementinstrument. Ziel ist eine kritische Würdigung des Konzepts, seiner Anwendung und seiner Grenzen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Perspektive des Produzenten als auch des Konsumenten.
- Begriff und Entwicklung des Life Cycle Costings
- Analyse des Produktlebenszyklus und seiner Kostenphasen
- Bewertung der Kostenverrechnung aus Produzenten- und Kundensicht
- Anwendung und Methoden der Kostenprognose im LCC
- Vorteile, Nutzen und Defizite des Life Cycle Costing
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Life Cycle Costing (LCC) ein und definiert den Begriff. Sie beschreibt die Entstehung des Konzepts, primär im US-Verteidigungsministerium, und dessen spätere Anwendung in anderen Bereichen wie öffentlichen Bauprojekten. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung der frühzeitigen Kostenbeeinflussung während der Entwicklungsphase, da hier ein Großteil der späteren Kosten festgelegt wird. Die Arbeit benennt ihre Zielsetzung, nämlich eine umfassende Analyse des LCC aus verschiedenen Perspektiven.
2. Produktlebenszyklus: Dieses Kapitel beschreibt den Produktlebenszyklus mit seinen Phasen: Einführung, Wachstum, Reife und Sättigung. Es erklärt den Unterschied zwischen Vorlaufkosten (Entwicklung, Konstruktion) und Nachlaufkosten (Wartung, Entsorgung) und wie diese im Kontext des integrierten Produktlebenszyklus betrachtet werden. Die Kapitel betont die Bedeutung des Verständnisses dieser verschiedenen Kostenphasen für eine effektive LCC-Anwendung.
3. Product Life Cycle Costing aus Produzentensicht: Hier wird die Verrechnung der Vorlauf- und Nachlaufkosten aus der Sicht des Produzenten analysiert. Die Herausforderungen bei der genauen Zuordnung und Verrechnung dieser Kosten werden beleuchtet, da diese für eine ganzheitliche Kostenbetrachtung essentiell sind. Probleme und Schwierigkeiten bei der Implementierung eines solchen Systems werden ebenfalls thematisiert.
4. Product Life Cycle Costing aus Kundensicht: Dieser Abschnitt betrachtet das LCC aus der Perspektive des Konsumenten. Es wird untersucht, wie die Lebenszykluskosten für den Kunden relevant sind und wie diese in seine Kaufentscheidung einfließen. Der Fokus liegt auf den Kosten über die gesamte Lebensdauer eines Produkts aus Kundensicht.
5. Anwendung des Life Cycle Costing: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Methoden der Kostenprognose im Rahmen des LCC. Es werden die Vorteile und der Nutzen des Life Cycle Costings herausgestellt, gleichzeitig aber auch dessen Defizite und Herausforderungen bei der praktischen Anwendung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Komplexität der Kostenberechnung und die damit verbundenen Unsicherheiten.
Schlüsselwörter
Product Life Cycle Costing (LCC), Lebenszykluskosten, Kostenmanagement, Kostenprognose, Produktlebenszyklus, Vorlaufkosten, Nachlaufkosten, Produzentensicht, Kundensicht, Kostenverrechnung, Wirtschaftlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Product Life Cycle Costing (LCC)"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Product Life Cycle Costing (LCC)?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Product Life Cycle Costing (LCC). Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf einer kritischen Analyse des LCC-Konzepts aus der Sicht des Produzenten und des Konsumenten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Kernpunkte: den Begriff und die Entwicklung des LCC, die Analyse des Produktlebenszyklus und seiner Kostenphasen (Vorlauf- und Nachlaufkosten), die Bewertung der Kostenverrechnung aus Produzenten- und Kundensicht, verschiedene Methoden der Kostenprognose im LCC, sowie die Vorteile, den Nutzen und die Defizite des LCC.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, die den Begriff LCC definiert und die Zielsetzung der Arbeit beschreibt; ein Kapitel zum Produktlebenszyklus; Kapitel, die das LCC aus Produzenten- und Kundensicht betrachten; ein Kapitel zur Anwendung des LCC mit verschiedenen Kostenprognosemethoden; und abschließend eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Welche Perspektiven werden im Bezug auf LCC eingenommen?
Die Arbeit betrachtet das LCC sowohl aus der Perspektive des Produzenten als auch des Konsumenten. Es wird analysiert, wie die Kosten über den gesamten Produktlebenszyklus für beide Seiten relevant sind und welche Herausforderungen und Möglichkeiten sich daraus ergeben.
Welche Methoden der Kostenprognose werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Kostenprognose im Rahmen des LCC, geht aber nicht im Detail auf einzelne Methoden ein. Der Fokus liegt auf den generellen Herausforderungen und dem Nutzen solcher Prognosen im Kontext des LCC.
Welche Vorteile und Nachteile des LCC werden diskutiert?
Die Arbeit hebt die Vorteile und den Nutzen des LCC hervor, diskutiert aber gleichzeitig auch die Defizite und Herausforderungen bei der praktischen Anwendung. Die Komplexität der Kostenberechnung und die damit verbundenen Unsicherheiten werden als wichtige Aspekte genannt.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Product Life Cycle Costing (LCC), Lebenszykluskosten, Kostenmanagement, Kostenprognose, Produktlebenszyklus, Vorlaufkosten, Nachlaufkosten, Produzentensicht, Kundensicht, Kostenverrechnung, Wirtschaftlichkeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Kostenmanagement, Produktlebenszyklen und dem Thema nachhaltige Wirtschaftlichkeit auseinandersetzen. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke zur Analyse von Themen im Bereich des Kostenmanagements.
- Arbeit zitieren
- Tobias Schirmer (Autor:in), 2007, Product Life Cycle Costing als Kostenmanagementinstrument. Kritische Würdigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123492