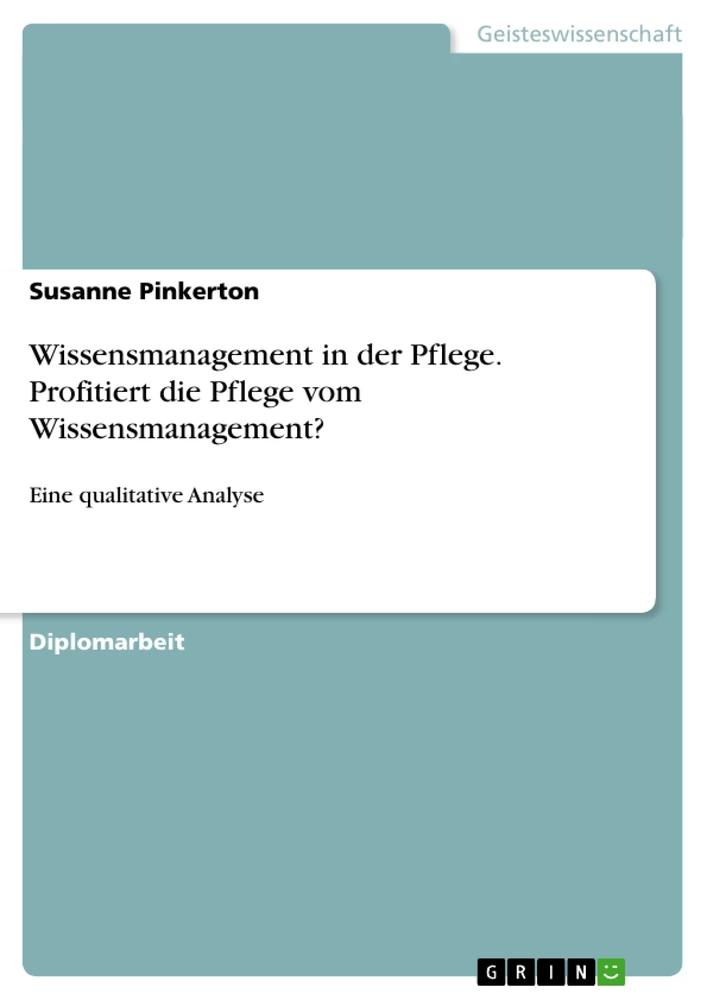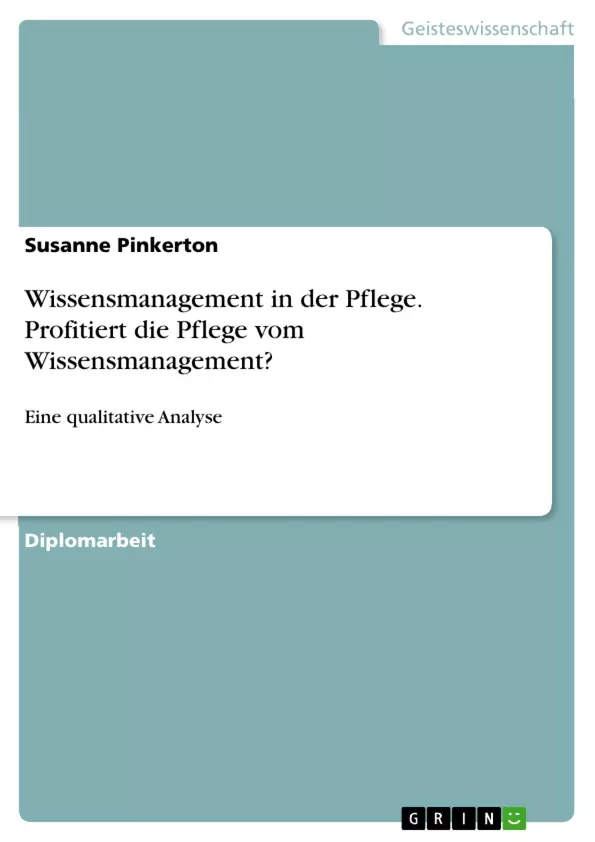Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Steuerung von Wissen in der Pflege. Dazu wurde in zwei Krankenhäusern strukturierte Interviews geführt und auf Grundlage der erhoben Daten die Umsetzung des Wissenstransfes untersucht. Des Weitern wurde untersucht, inwiefern Ansätze des Wissensmanagements bereits in dem Bewusstsein der Mitarbeiter der verschiedenen Hierarchieebenen vorhanden ist. Gleichfalls wurde evaluiert, welche Schritte zum Wissenstransfer und zur Wissensbewahrung bereits unternommen werden, ob und in welchem Maße Wissensmanagement bereits umsetzt wird.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt strukturiert:
Zunächst wird im ersten Kapitel auf die Grundstrukturen einer lernenden Organisation (LO) eingegangen. Die lernende Organisation ist der Rahmen für Wissensmanagement in Organisationen. Das Kapitel beschäftigt sich mit den drei Elementen der lernenden Organisation: dem individuellen Lernprozess, dem organisationalem Lernen (in einem kurzen Abriss) und schließlich mit den Strukturen der lernenden Organisation.
Im darauf folgenden Kapitel wird sich mit Aspekten des Wissensmanagements auseinander gesetzt, wobei sowohl theoretische Ansätze, als auch konkrete Modelle der Generierung impliziten Wissens angesprochen werden.
Im Anschluss wird das an der Praxis orientierte Interventionsmodell von PROBST et al. vorgestellt, dessen einzelne Module (Bausteine) den kontinuierlichen Prozess der Wissensteuerung beschreiben. Dieses Modell steht für eine praxisorientierte Steuerung des Wissens und bot die Grundlage einer Analyse des Wissenstransfers in der Krankenpflege zweier Berliner Krankenhäuser.
Im Rahmen dieser qualitativen Untersuchung wurden in beiden Krankenhäusern Interviews geführt und ausgewertet. Die empirische Analyse des Interviewmaterials wurde in Anlehnung an das Interventionsmodell durchgeführt.
Die der Analyse folgende Diskussion der erhaltenen Ergebnisse verdeutlicht, welche Bausteine des Modells bereits eine Umsetzung finden. Im Ausblick sind erste aus der Theorie abgeleitete Instrumente ausgewählt, die Ansätze für eine Implementierung bieten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung der Arbeit
- Das Modell der lernenden Organisation
- Individuelles Lernen
- Lerninhalte des individuellen Lernens
- Lernmotivation und Lernzweck
- Lernstil und -ort
- Organisationales Lernen
- Die lernende Organisation
- Individuen
- Der Kontext
- Strategien, organisatorische Strukturen und Prozesse
- Die Unternehmenskultur
- Lernsystem/-prozesse
- Individuelles Lernen
- Wissensmanagement
- Terminologie des Wissensbegriffs
- Der Prozess des individuellen Wissens
- Organisationales Wissen
- Explizites und implizites Wissen
- Die Ressource Implizites Wissen
- Ein Balanceakt zwischen implizitem und explizitem Wissen (HANSE-Modell)
- Von Daten über Information zum Wissen
- Verknüpfung von Daten, Informationen und Wissen
- Wissensbegriff im Wissensmanagement
- Ziele des Wissensmanagements
- Organisationales Lernen vs. Wissensmanagement
- Das Interventionsmodell des Wissensmanagements
- Die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al.
- Der Baustein „Wissensziele“
- Der Baustein „Wissensidentifikation“
- Der Baustein „Wissenserwerb“
- Der Baustein „Wissensentwicklung“
- Der Baustein „Wissens(ver)teilung“
- Der Baustein „Wissensnutzung“
- Der Baustein „Wissensbewahrung“
- Der Baustein „Wissensbewertung“
- Die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al.
- Fazit: Lernende Organisation und Wissensmanagement
- Methodisches Vorgehen
- Methodenwahl und Begründung
- Auswahl der Stichprobe
- Kontaktaufnahme zu den Krankenhäusern
- Pretest
- Interviewleitfaden
- Auswertung der Experteninterviews nach Meuser und Nagel
- Beschreibung der befragten Krankenhäuser
- Krankenhaus 1
- Krankenhaus 2
- Empirische Analysen
- Der Wissensbegriff in der Pflege
- Das Verständnis von explizitem und implizitem Wissen
- Die Analyse der Interviews nach dem Interventionsmodell des Wissensmanagements
- Kategorie 1: Wissensziele
- Kategorie 2: Wissensidentifikation
- Kategorie 3: Wissenserwerb
- Kategorie 4: Wissensentwicklung
- Kategorie 5: Wissensverteilung
- Kategorie 6: Wissensnutzung
- Kategorie 7: Wissensbewahrung
- Kategorie 8: Wissensbewertung
- Diskussion der Ergebnisse
- Diskussion der Analysen des Wissensbegriffs in der Pflege
- Diskussion der Analysen zum Interventionsmodell im Wissensmanagement
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob und wie Wissensmanagement in der Pflege zum Vorteil der Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden kann. Die Studie analysiert den Wissensbegriff in der Pflege und bewertet die Anwendbarkeit eines Interventionsmodells des Wissensmanagements in diesem Kontext.
- Der Wissensbegriff in der Pflege
- Explizites und implizites Wissen in der Pflegepraxis
- Anwendbarkeit von Wissensmanagement-Modellen in der Pflege
- Analyse eines Interventionsmodells zur Implementierung von Wissensmanagement
- Bewertung des Potenzials von Wissensmanagement für die Effizienz und Qualität der Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Wandel im Gesundheitswesen und die zunehmende Bedeutung von Wissen als Ressource. Kapitel 3 erläutert das Modell der lernenden Organisation, während Kapitel 4 den Wissensbegriff und das Wissensmanagement definiert und verschiedene Wissensarten wie explizites und implizites Wissen beschreibt. Kapitel 5 stellt ein Interventionsmodell für Wissensmanagement vor, das in den folgenden Kapiteln empirisch anhand von Experteninterviews in Krankenhäusern untersucht wird. Die Kapitel 7 und 8 beschreiben die Methodik und die Ergebnisse dieser Untersuchung. Die Ergebnisse werden hinsichtlich des Wissensbegriffs in der Pflege und der Anwendbarkeit des Interventionsmodells diskutiert.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Pflege, explizites Wissen, implizites Wissen, lernende Organisation, Interventionsmodell, qualitative Analyse, Experteninterviews, Effizienz, Qualität.
- Quote paper
- Diplom Susanne Pinkerton (Author), 2003, Wissensmanagement in der Pflege. Profitiert die Pflege vom Wissensmanagement?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123508