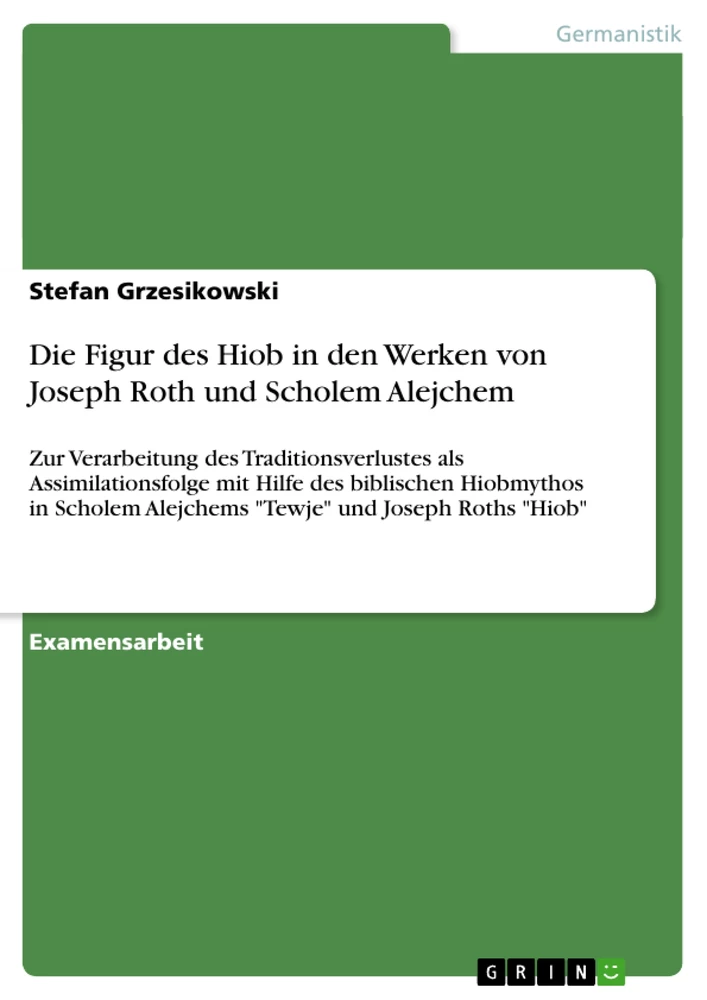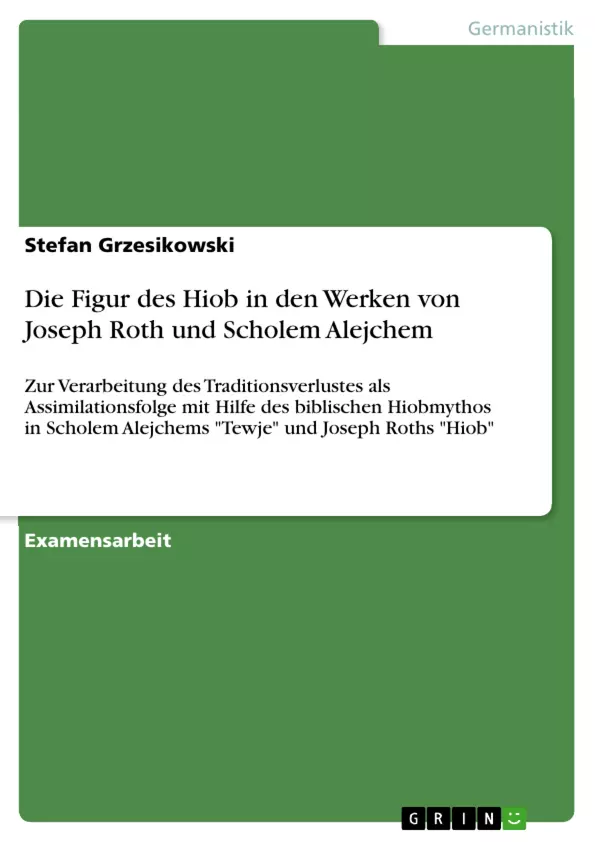Der Titel der Arbeit unterstellt eine primäre Gemeinsamkeit in den Werken der beiden Autoren: die Verwendung des Hiobmythos. Joseph Roth wählte die biblische Figur sogar als Namenspatron für seinen Roman. Inwieweit auch Scholem Alejchems Tewje als Hiob-Roman gelesen werden kann, muss diese Arbeit erst erweisen. Sollte auch hier die Verarbeitung des Hiob-Mythos wesentlich sein, so wäre Scholem Alejchems Tewje einer ersten Phase der Wiederbelebung dieses Mythos in der Moderne zuzuordnen, wohingegen Roths Hiob insofern das Ende einer solchen noch näher zu bestimmenden Phase markiert, weil sein Roman noch nicht vom Holocaust überschattet wird. Mit dem Holocaust ändert sich die Hiobrezeption grundlegend.
Mit den Romanen von Joseph Roth und Scholem Alejchem wurden nun bewusst zwei Texte ausgewählt, die deutlich vor dem Holocaust verfasst wurden. Die Frage ist hier also vor allem auch, wofür die Figur des Hiob in diesen Texten steht, bzw. inwiefern die beiden Autoren die Figur des Hiob mit ihren Texten deuten.
In einem ersten Schritt der Untersuchung werden hauptsächlich inhaltliche Aspekte der Textgrundlage geklärt werden müssen. Anschließend wird näher auf den biblischen Hiob-Mythos einzugehen sein. Hier muss zwischen der biblischen Hiobfigur und dem an ihr durchgespielten theologischen Hiobproblem unterschieden werden. Zu diskutieren wird sein, inwiefern der Tun-Ergehen-Zusammenhang mit dem biblischen Hiobbuch aufgelöst wird und wie die Restitution Hiobs in Anbetracht dessen zu verstehen ist. Die Aktualisierung des Hiobproblems wird in der Betrachtung des sozialgeschichtlichen Hintergrunds, vor allem also der Situation der Juden in Osteuropa und auch der Autorenbiographien, deutlich werden. Die jeweiligen hermeneutischen Textinterpretationen werden zu klären haben, worin genau das Leid der Hauptfigur besteht und in welcher Verbindung dies zum biblischen Mythos steht. Untrennbar mit dem Leid ist die Klage verbunden. Auch hier wird zu überprüfen sein, in welcher Form eine solche Klage in den vorliegenden Werken stattfindet. Schließlich muss auch auf die eschatologische Hoffnung eingegangen werden, die durch Hiobs Restitution ausgelöst wird. Den Abschluss der Arbeit wird dann ein Vergleich der beiden Hiobverarbeitungen bilden, die wohl besser als Verarbeitungen der Zeitumstände mit Hilfe des Hiob-Mythos bezeichnet würden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Allgemeine Vorbemerkungen
- 1.2. Rechtfertigung der Textauswahl
- 1.3. Bemerkungen zum methodischen Vorgehen
- 2. Eine erste Annäherung an den Text
- 2.1. Die Geschichten von Tewje, dem Milchmann
- 2.2. Der Roman vom einfachen Mann Mendel Singer
- 3. Der biblische Hiob-Mythos als ein gemeinsamer Bezugspunkt
- 3.1. Inhalt und Aufbau des Hiobbuches
- 3.2. Die Hiobfigur
- 3.3. Das Hiobproblem
- 3.4. Der Zusammenbruch des Tun-Ergehen-Zusammenhangs als Gegenstand und Voraussetzung
- 4. Der sozialgeschichtliche Hintergrund als Aktualisierung des Hiobproblems
- 4.1. Das Ostjudentum und sein Weg in die Krise der Moderne
- 4.2. Das Judentum im deutschsprachigen Raum und der Umgang mit dem Ostjudentum
- 4.3. Die Verortung der Autoren in dieser Zeit
- 4.3.1. Scholem Alejchem – assimilierter Verfechter ostjüdischer Kultur
- 4.3.2. Joseph Roth – k.u.k.-Europäer ostjüdischer Herkunft
- 4.4. Zwischenfazit
- 5. Unschuldig leidend, gottergeben klagend und auf diesseitige Erlösung hoffend – Tewje als Hiobfigur
- 5.1. Das ungerechte Leid des gerechten Milchmanns
- 5.2. Dulder oder Rebell? – Eine Charakteristik der Klagen
- 5.3. Hoffnung auf Erlösung durch Revolution und Rückbindung an die Tradition
- 6. Leidend ausgezeichnet, zornig klagend und Erlösung ausschließend – Mendel als Hiobfigur
- 6.1. Vom durchschnittlichen Melamed zum besonderen Leidenden
- 6.2. Vom ängstlichen Dulder zum zornig klagenden Rebellen
- 6.3. Menuchim als Erlösungshoffnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verarbeitung des Traditionsverlustes als Folge der Assimilation am Beispiel der Figur des Hiob in den Werken von Scholem Alejchem und Joseph Roth. Sie analysiert, wie die beiden Autoren den biblischen Hiobmythos nutzen, um die Erfahrungen des Ostjudentums im Kontext der Moderne darzustellen.
- Die Rezeption des Hiobmythos in der jüdischen Literatur
- Der sozialgeschichtliche Kontext des Ostjudentums und seine Krise in der Moderne
- Die Darstellung von Leid und Glaube bei Tewje und Mendel Singer
- Die Rolle der Assimilation und der traditionellen jüdischen Kultur
- Vergleichende Analyse der Hiobfiguren bei Alejchem und Roth
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Auswahl der Texte von Scholem Alejchem und Joseph Roth. Sie erläutert die Bedeutung der Hiobfigur in der Literatur und die unterschiedlichen Rezeptionen in jüdischer und christlicher Tradition. Der Fokus liegt auf der modernen Rezeption des Hiobmythos im Kontext des Ostjudentums und der Assimilation.
2. Eine erste Annäherung an den Text: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die ausgewählten Werke von Scholem Alejchem und Joseph Roth, wobei die jeweilige Darstellung der Hauptfigur und des zentralen Konflikts im Vordergrund steht. Es bereitet den Leser auf die detailliertere Analyse in den folgenden Kapiteln vor.
3. Der biblische Hiob-Mythos als ein gemeinsamer Bezugspunkt: Dieses Kapitel analysiert den biblischen Hiobmythos als gemeinsamen Bezugspunkt für die beiden literarischen Werke. Es untersucht den Inhalt und Aufbau des Hiobbuches, die Hiobfigur selbst, das "Hiobproblem" und den Zusammenbruch des Tun-Ergehen-Zusammenhangs.
4. Der sozialgeschichtliche Hintergrund als Aktualisierung des Hiobproblems: Das Kapitel beleuchtet den sozialgeschichtlichen Hintergrund, der die Aktualisierung des Hiobproblems in den Werken Alejchems und Roths ermöglicht. Es untersucht die Situation des Ostjudentums, seine Krise in der Moderne und die Position der beiden Autoren innerhalb dieses Kontextes.
5. Unschuldig leidend, gottergeben klagend und auf diesseitige Erlösung hoffend – Tewje als Hiobfigur: Die Zusammenfassung dieses Kapitels konzentriert sich auf die Interpretation Tewjes als Hiobfigur, seine Leiden, seine Reaktionen und seine Hoffnung auf Erlösung. Es untersucht die unterschiedlichen Aspekte seines Charakters im Kontext des Hiobmythos.
6. Leidend ausgezeichnet, zornig klagend und Erlösung ausschließend – Mendel als Hiobfigur: Ähnlich wie im vorherigen Kapitel wird hier die Figur Mendel Singer als Hiobfigur umfassend analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf den Aspekten seines Leids, seines Zorns und seiner (fehlenden) Hoffnung auf Erlösung, und wie diese sich mit der Hiobfigur vergleichen lassen.
Schlüsselwörter
Hiob, Scholem Alejchem, Joseph Roth, Ostjudentum, Assimilation, Traditionsverlust, Leid, Glaube, Moderne, Theodizee, Tewje, Mendel Singer, jüdische Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Hiobfigur bei Scholem Alejchem und Joseph Roth
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Verarbeitung des Traditionsverlustes durch Assimilation am Beispiel der Hiobfigur in den Werken von Scholem Alejchem und Joseph Roth. Im Fokus steht, wie beide Autoren den biblischen Hiobmythos nutzen, um die Erfahrungen des Ostjudentums in der Moderne darzustellen.
Welche Texte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht ausgewählte Werke von Scholem Alejchem (z.B. Geschichten von Tewje, dem Milchmann) und Joseph Roth (z.B. Der Roman vom einfachen Mann Mendel Singer). Die genaue Textauswahl wird in der Einleitung begründet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rezeption des Hiobmythos in der jüdischen Literatur, den sozialgeschichtlichen Kontext des Ostjudentums und seine Krise in der Moderne, die Darstellung von Leid und Glaube bei Tewje und Mendel Singer, die Rolle der Assimilation und der traditionellen jüdischen Kultur sowie einen vergleichenden Analyse der Hiobfiguren bei Alejchem und Roth.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, eine erste Annäherung an die Texte, der biblische Hiob-Mythos als Bezugspunkt, der sozialgeschichtliche Hintergrund, Tewje als Hiobfigur und Mendel Singer als Hiobfigur. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt und im Kapitel "Zusammenfassung der Kapitel" zusammengefasst.
Welche Bedeutung hat der Hiobmythos in dieser Arbeit?
Der biblische Hiobmythos dient als gemeinsamer interpretativer Bezugspunkt für die Analyse der beiden literarischen Figuren. Die Arbeit untersucht, wie die Autoren die Thematik des unschuldigen Leidens, des Glaubens und der Erlösung im Kontext des Ostjudentums und der Moderne interpretieren und umsetzen.
Wie werden Tewje und Mendel Singer als Hiobfiguren interpretiert?
Tewje wird als gottergebene, auf diesseitige Erlösung hoffende Figur dargestellt, während Mendel Singer als zornig klagende Figur ohne Hoffnung auf Erlösung erscheint. Die Arbeit vergleicht und kontrastiert ihre jeweiligen Reaktionen auf Leid und ihre Glaubenssätze im Kontext des Hiobmythos.
Welchen sozialgeschichtlichen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Ostjudentum im Kontext der Moderne, seine Krise durch Assimilation und Traditionsverlust, und die Position der Autoren Scholem Alejchem und Joseph Roth innerhalb dieses Kontextes. Der Umgang mit dem Ostjudentum im deutschsprachigen Raum wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die unterschiedlichen Arten, wie Scholem Alejchem und Joseph Roth den Hiobmythos aufgreifen, um die Herausforderungen des Ostjudentums und den Verlust traditioneller Strukturen darzustellen. Die spezifischen Schlussfolgerungen werden im Schlusskapitel der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Hiob, Scholem Alejchem, Joseph Roth, Ostjudentum, Assimilation, Traditionsverlust, Leid, Glaube, Moderne, Theodizee, Tewje, Mendel Singer und jüdische Identität.
- Quote paper
- Stefan Grzesikowski (Author), 2008, Die Figur des Hiob in den Werken von Joseph Roth und Scholem Alejchem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123559