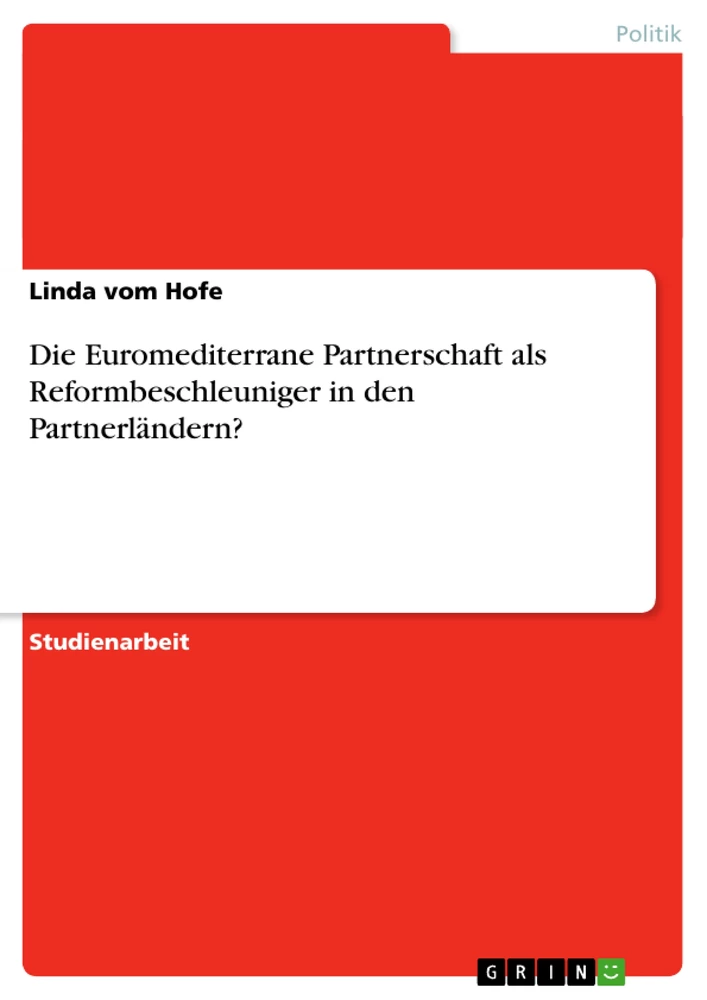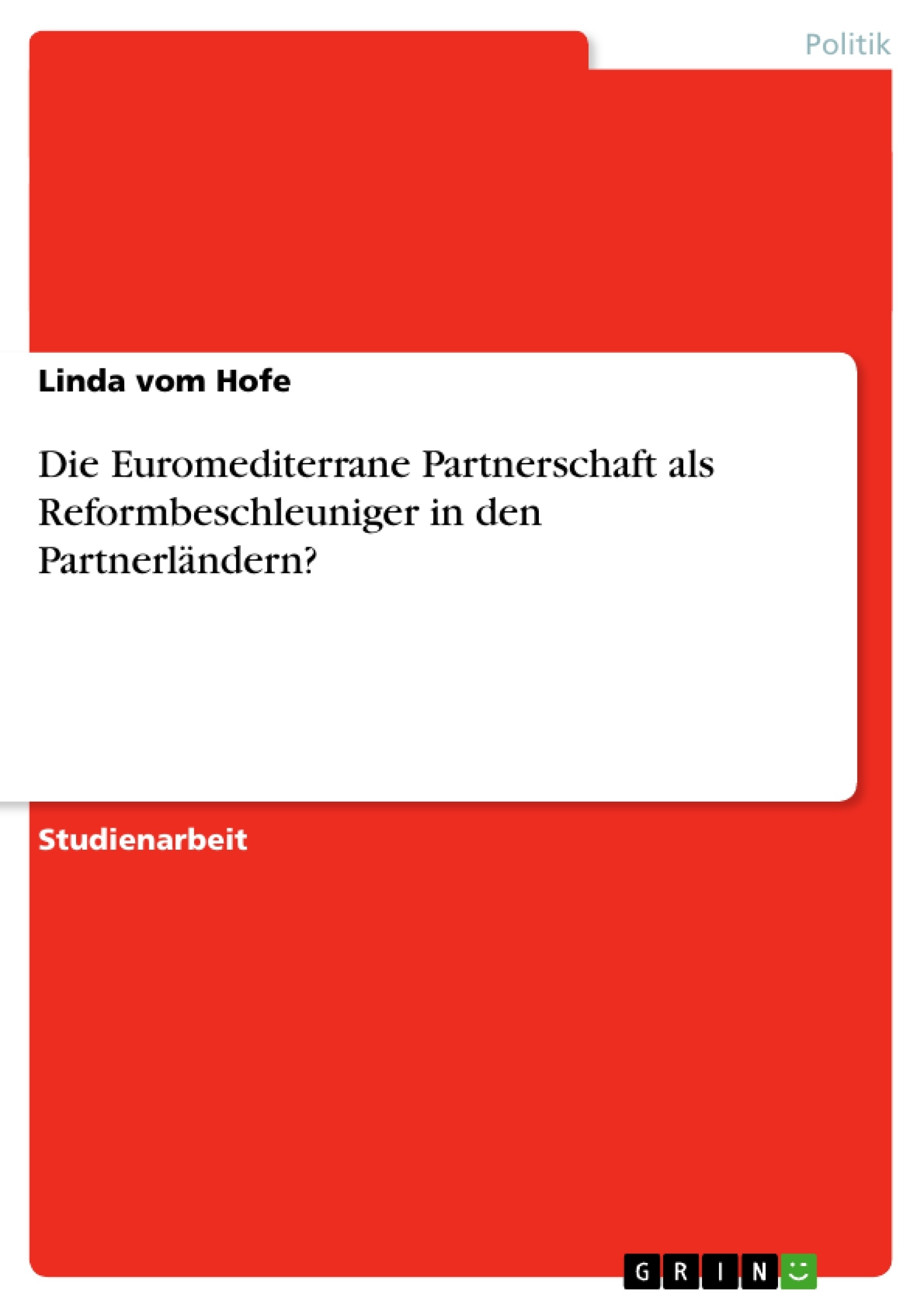Mit Beginn des Barcelona Prozesses (BP) 1995 hat sich die Europäische Union (EU) das
ehrgeizige Ziel gesetzt, einen Raum des Friedens, der Stabilität und des gemeinsamen
Wohlstandes im Mittelmeerbecken sowie eine für das Jahr 2010 angestrebte Euro-mediterrane
Freihandelszone (EMFZ) zu erschaffen. Nach derzeitigem Stand der Dinge ist man sich in
Politik und Literatur einig, dass dieses Ziel wohl nicht erreicht werden wird. Verschiedenste
Versuche, den Erfolg oder Misserfolg der Euromediterranen Partnerschaft (EMP) zu messen,
sind seit Beginn des BP erfolgt: Während einige Autoren betonen, dass die EMP in einigen
mediterranen Partnerländern (MPL) in gewissen Gebieten durchaus Erfolge vorzuweisen hat
und die EMP beispielsweise der einzige Hintergrund ist, in dem sich israelische und
palästinensische Vertreter regelmäßig treffen (JMC Berlin 2008), weisen andere Autoren
darauf hin, dass die EMP bisher, gemessen an den eigenen Zielvorgaben, eher ein Misserfolg
denn ein Erfolg war (Philippart 2003). Ausgehend von letzterer Einschätzung des BP, wird
diese Hausarbeit sich damit beschäftigen, warum die EMP bislang nicht die gewünschten
Erfolge erzielt hat und welche Mechanismen hinter dieser Fehlentwicklung stecken. Hierbei
wird insbesondere der wirtschaftliche Korb betrachtet werden. Die zentrale Fragestellung
lautet daher: Warum konnte der Barcelona Prozess bisher nur begrenzt einen Anreiz für
wirtschaftliche Reformen in den MPL schaffen?
Zur Beantwortung dieser Frage werde ich in erster Linie den Anchoring-Ansatz von Alfred
Tovias und Mehmet Ugur (Tovias/Ugur:2004) als Erklärungsmodell heranziehen, der in
Abschnitt 2 näher erläutert wird, denn dieser Ansatz beinhaltet ein Modell, das zeigt, dass die
EMP unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren kann. Nachdem gezeigt wurde, wie
die EU theoretisch als Reformbeschleuniger in den MPL fungieren könnte, wird Teil 3 zeigen,
dass dies jedoch bisher sehr begrenzt der Fall war. In Abschnitt 4 werden dann die Gründe
bzw. Erklärungen für das suboptimale Ergebnis der EMP näher betrachtet, um dann zu einer
abschließenden Bewertung in Teil 5 zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die EMP in der Theorie: der Anchoring-Ansatz
- 2.1 Divergierende Interessen beider Akteure
- 2.2 Das optimale Tauschgeschäft
- 3 Die Reformbilanz der EMP in der Praxis
- 3.1 Handelsliberalisierung
- 3.2 Wechselkurse, Geldpolitik und Finanzmarktliberalisierung
- 3.3 Privatisierung
- 3.4 Ausländische Direktinvestitionen
- 4 Warum Divergenzen zwischen Theorie und Praxis?
- 4.1 Ungünstige Ausgangsbedingungen
- 4.2 Unvollständige Verträge
- 4.3 Unausgewogene Verteilung der Kosten und fehlende Anreize
- 4.4 Mangelnde Zugeständnisse der EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für den begrenzten Erfolg der Euromediterranen Partnerschaft (EMP) als Reformbeschleuniger in den Partnerländern. Die zentrale Fragestellung lautet: Warum konnte der Barcelona-Prozess bisher nur begrenzt einen Anreiz für wirtschaftliche Reformen schaffen? Der Anchoring-Ansatz von Tovias/Ugur dient als theoretisches Erklärungsmodell.
- Analyse des Anchoring-Ansatzes als Erklärungsmodell für den Erfolg/Misserfolg der EMP.
- Bewertung der Reformbilanz der EMP in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen.
- Untersuchung der Gründe für Divergenzen zwischen Theorie und Praxis des Anchoring-Ansatzes.
- Analyse ungünstiger Ausgangsbedingungen in den Partnerländern.
- Bewertung der Rolle der EU und ihrer Zugeständnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für den begrenzten Erfolg der EMP bei der Förderung wirtschaftlicher Reformen in den Partnerländern. Der Anchoring-Ansatz von Tovias/Ugur wird als analytisches Werkzeug eingeführt.
Kapitel 2 (Die EMP in der Theorie): Dieses Kapitel beschreibt den Anchoring-Ansatz, der die Bedingungen für ein optimales Tauschgeschäft zwischen der EU und den Partnerländern aufzeigt. Es werden divergierende Interessen beider Akteure und die Anforderungen an einen effektiven Ankermechanismus erläutert.
Kapitel 3 (Die Reformbilanz der EMP in der Praxis): Dieses Kapitel bewertet den bisherigen Erfolg der EMP anhand verschiedener wirtschaftlicher Reformen (Handelsliberalisierung, Wechselkurse, Geldpolitik, Privatisierung, ausländische Direktinvestitionen) und stellt fest, dass die Fortschritte begrenzt sind und hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Kapitel 4 (Warum Divergenzen zwischen Theorie und Praxis?): Dieses Kapitel analysiert die Gründe für die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis des Anchoring-Ansatzes. Es werden ungünstige Ausgangsbedingungen in den Partnerländern, unvollständige Verträge, unausgewogene Kostenverteilung und mangelnde Zugeständnisse der EU diskutiert.
Schlüsselwörter
Euromediterrane Partnerschaft (EMP), Barcelona-Prozess, Reformbeschleuniger, Anchoring-Ansatz, Handelsliberalisierung, Privatisierung, ausländische Direktinvestitionen, ökonomische Reformen, Mittelmeer-Partnerländer (MPL), EU, politische Ökonomie, institutionelle Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Linda vom Hofe (Author), 2008, Die Euromediterrane Partnerschaft als Reformbeschleuniger in den Partnerländern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123566