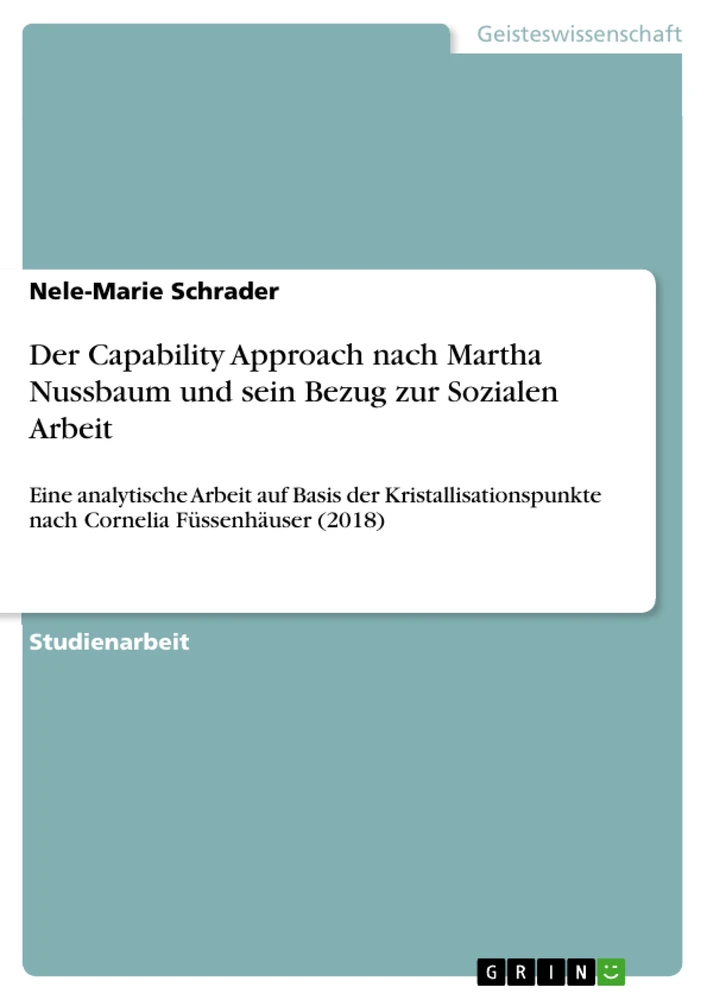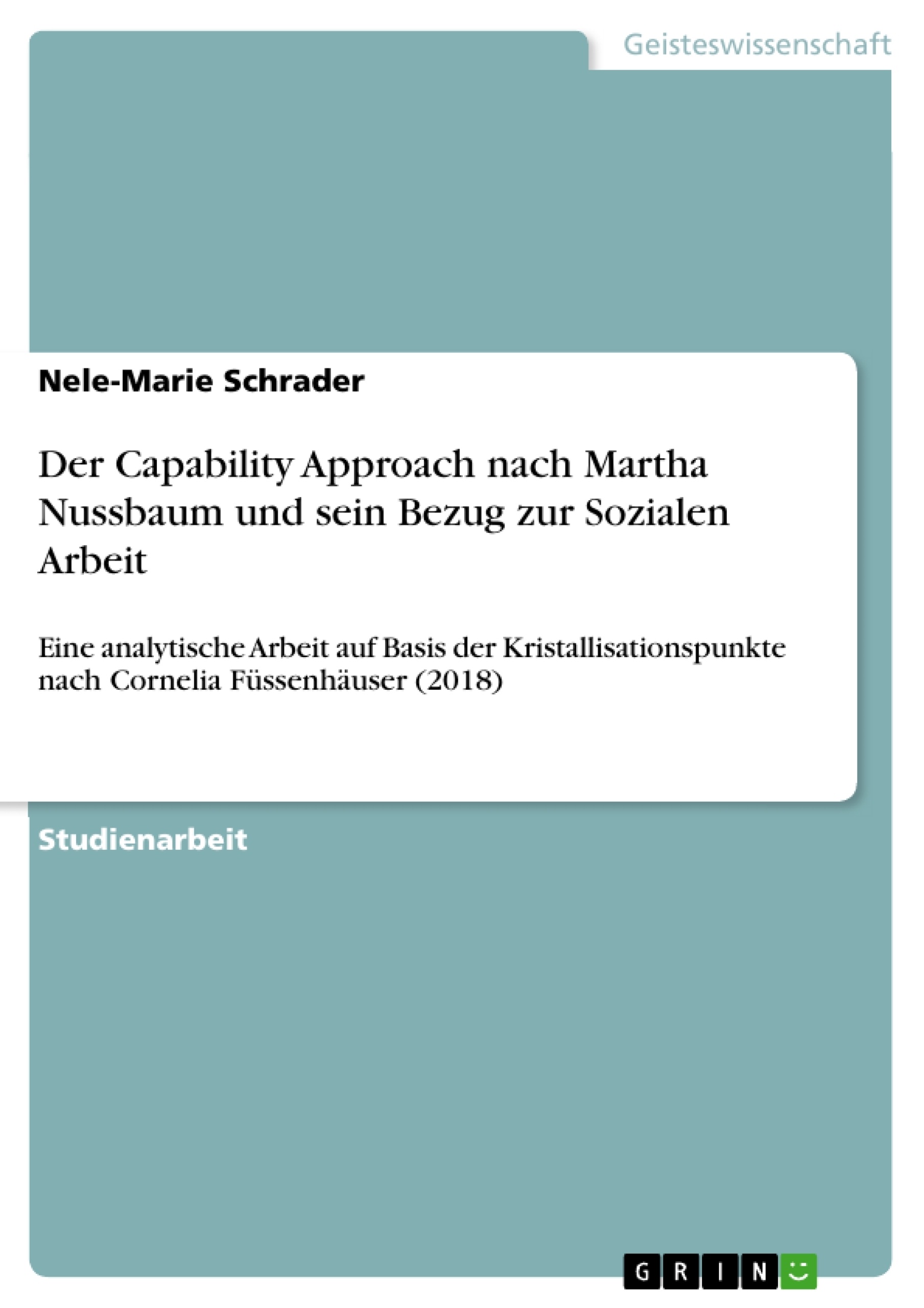In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit dem Capability Approach und dessen Bezügen zur Sozialen Arbeit. Dieser stellt sich den Fragen, was ein gutes Leben ausmacht und welche persönlichen und institutionellen Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen. Zum anderen geht er der Frage nach, welche externen Umstände das Leben beeinflussen und welche positiven oder negativen Folgen dies haben würde. Der Capability Approach setzt sein Ziel besonders auf die Möglichkeit der Selbstverwirklichung jedes Menschen und ob diese zur Führung eines „guten Lebens“ berechtigt sind. Dabei wird nicht festgelegt, wie ein gutes Leben aussieht, da dies eine subjektive Einschätzung des Individuums darstellt.
Der Capability Approach wurde in den 1980er Jahren von dem Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Armatya Sen und der Philosophin Martha Nussbaum entwickelt und kontinuierlich weitergeführt. Sen und Nussbaum gelten somit als Begründer des inzwischen weit verbreiteten Ansatzes und haben zu dessen internationaler Verbreitung und Bekanntmachung beigetragen. Ich beziehe mich in dieser Arbeit hauptsächlich auf die Werke von Nussbaum. Diese Entscheidung habe ich aufgrund der verschiedenen Herangehensweisen von Sen und Nussbaum getroffen. Während Sen die Entscheidungsfreiheit eines Menschen für ein gutes Leben fokussiert, setzt Nussbaum auf die Theorie einer objektiven Liste an Grundfähigkeiten, die zur Führung eines guten Lebens berechtigt. So bietet sich jene Liste an, um Explikationen anhand von Beispielen anschaulich zu machen.
Da die Arbeiten von Nussbaum einer internationalen Bekanntheit angehören und diese somit auf Englisch verfasst sind, hielt ich es für unabdingbar, deutschsprachige Literatur heranzuziehen, besonders auf Hinblick eines Bezuges zur Sozialen Arbeit. Dafür erwiesen sich die Arbeiten von Oelkers, Otto, Schrödter und Ziegler als besonders wertvoll. Um in dieser Hausarbeit den Ansatz adäquat zu analysieren, werde ich die Kristallisationspunkte nach Füssenhauser verwenden, welche sie in ihrer Arbeit „Theoriekonstruktion und Positionen der Sozialen Arbeit“ (2018) hervorhebt. Aufgrund dessen werde ich mit der Darstellung der Kriterien nach Füssenhäuser beginnen und diese im Anschluss einzeln beleuchten. Bevor ich die Hausarbeit mit einem Fazit abschließen werde, möchte ich den Ansatz vorerst fachtheoretisch diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung des Capability-Approaches anhand der Kriterien nach Füssenhäuser (2018)
- 2.1 Gegenstand
- 2.2 Wissenschaftscharakter
- 2.3 Theorie-Praxis-Verhältnis
- 2.4 Gesellschaftliche und soziale Rahmenbedingungen der Theorie
- 2.5 Lebenslagen und Lebensweisen der Adressat*innen
- 2.6 Organisationen und Institutionen
- 2.7 Professionelle Handlungsmuster
- 2.8 Ethik
- 3. Diskussion der Theorie
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Capability Approach und seine Relevanz für die Soziale Arbeit. Sie untersucht, wie dieser Ansatz die Frage nach einem guten Leben und den dafür notwendigen Voraussetzungen – sowohl persönlich als auch institutionell – beantwortet. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung externer Einflüsse auf das Leben und deren Folgen. Der Fokus liegt dabei auf Martha Nussbaums Beitrag, insbesondere ihrer Liste objektiver Grundfähigkeiten für ein gutes Leben.
- Der Capability Approach als Gerechtigkeitstheorie
- Nussbaums Liste der Grundfähigkeiten als Grundlage eines guten Lebens
- Die Bedeutung von Capabilities und Functionings in der Sozialen Arbeit
- Analyse des Ansatzes anhand der Kristallisationspunkte nach Füssenhäuser
- Theorie-Praxis-Beziehung im Capability Approach
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Capability Approach als Ansatz zur Beantwortung der Frage nach einem guten Leben und den dafür notwendigen Voraussetzungen. Sie betont die unterschiedlichen Herangehensweisen von Amartya Sen und Martha Nussbaum und begründet die Fokussierung auf Nussbaums Werk aufgrund ihrer objektiven Liste von Grundfähigkeiten. Die Arbeit nutzt die Kristallisationspunkte nach Füssenhäuser zur Analyse des Ansatzes.
2. Darstellung des Capability-Approaches anhand der Kriterien nach Füssenhäuser (2018): Dieses Kapitel analysiert den Capability Approach anhand der acht Kristallisationspunkte von Füssenhäuser. Es beleuchtet den Gegenstand des Ansatzes, seinen Wissenschaftscharakter, das Verhältnis von Theorie und Praxis, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Lebenslagen der Adressat*innen, die Rolle von Organisationen und Institutionen, professionelle Handlungsmuster und die zugrundeliegende Ethik. Es werden die Konzepte von Capabilities (Fähigkeiten, Befähigungen, Möglichkeiten) und Functionings (tatsächlich ausgeübte Fähigkeiten) erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht, wobei die Arbeiten von Otto und Ziegler im deutschen Kontext herangezogen werden. Das Kapitel legt den Fokus auf die grundlegenden Elemente des Capability Approach und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit.
Schlüsselwörter
Capability Approach, Martha Nussbaum, Soziale Arbeit, Gerechtigkeit, Grundfähigkeiten, Capabilities, Functionings, Lebensqualität, Theoriepluralismus, Kristallisationspunkte, Füssenhäuser.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Capability Approach in der Sozialen Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Capability Approach und seine Relevanz für die Soziale Arbeit. Sie untersucht, wie dieser Ansatz die Frage nach einem guten Leben und den dafür notwendigen Voraussetzungen – sowohl persönlich als auch institutionell – beantwortet. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung externer Einflüsse auf das Leben und deren Folgen. Der Fokus liegt dabei auf Martha Nussbaums Beitrag, insbesondere ihrer Liste objektiver Grundfähigkeiten für ein gutes Leben. Die Arbeit nutzt die Kristallisationspunkte nach Füssenhäuser zur systematischen Analyse des Ansatzes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Den Capability Approach als Gerechtigkeitstheorie; Nussbaums Liste der Grundfähigkeiten als Grundlage eines guten Lebens; Die Bedeutung von Capabilities und Functionings in der Sozialen Arbeit; Analyse des Ansatzes anhand der Kristallisationspunkte nach Füssenhäuser; Die Theorie-Praxis-Beziehung im Capability Approach.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Darstellung des Capability-Approaches anhand der Kriterien nach Füssenhäuser (2018), ein Kapitel zur Diskussion der Theorie und ein Fazit. Das Kapitel zur Darstellung des Ansatzes analysiert diesen anhand von acht Kristallisationspunkten, beleuchtet den Gegenstand, den Wissenschaftscharakter, das Theorie-Praxis-Verhältnis, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Lebenslagen der Adressat*innen, die Rolle von Organisationen und Institutionen, professionelle Handlungsmuster und die Ethik. Es werden die Konzepte von Capabilities und Functionings erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht.
Wer sind die wichtigsten Autoren?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Beitrag von Martha Nussbaum zum Capability Approach. Zusätzlich werden die Arbeiten von Amartya Sen und die Kriterien von Füssenhäuser zur Analyse des Ansatzes herangezogen. Im Kontext der Anwendung werden Otto und Ziegler erwähnt.
Was sind die zentralen Konzepte?
Die zentralen Konzepte sind der Capability Approach, Capabilities (Fähigkeiten, Befähigungen, Möglichkeiten), Functionings (tatsächlich ausgeübte Fähigkeiten), Gerechtigkeit, Grundfähigkeiten, Lebensqualität, Theoriepluralismus und die Kristallisationspunkte nach Füssenhäuser.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die acht Kristallisationspunkte nach Füssenhäuser (2018) als analytisches Rahmenwerk zur Untersuchung des Capability Approach.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende und Wissenschaftler*innen der Sozialen Arbeit, die sich mit dem Capability Approach und seiner Anwendung in der Praxis beschäftigen. Sie eignet sich auch für alle, die sich für Fragen der Gerechtigkeit, Lebensqualität und die Theoriebildung in der Sozialen Arbeit interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Capability Approach, Martha Nussbaum, Soziale Arbeit, Gerechtigkeit, Grundfähigkeiten, Capabilities, Functionings, Lebensqualität, Theoriepluralismus, Kristallisationspunkte, Füssenhäuser.
- Arbeit zitieren
- Nele-Marie Schrader (Autor:in), 2021, Der Capability Approach nach Martha Nussbaum und sein Bezug zur Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1235907