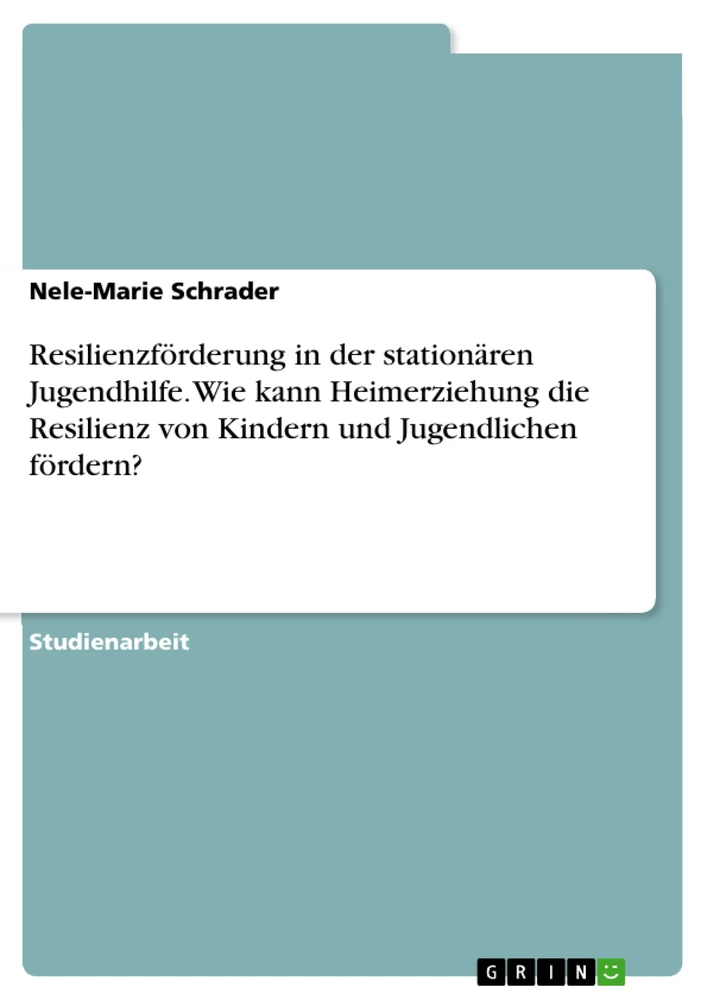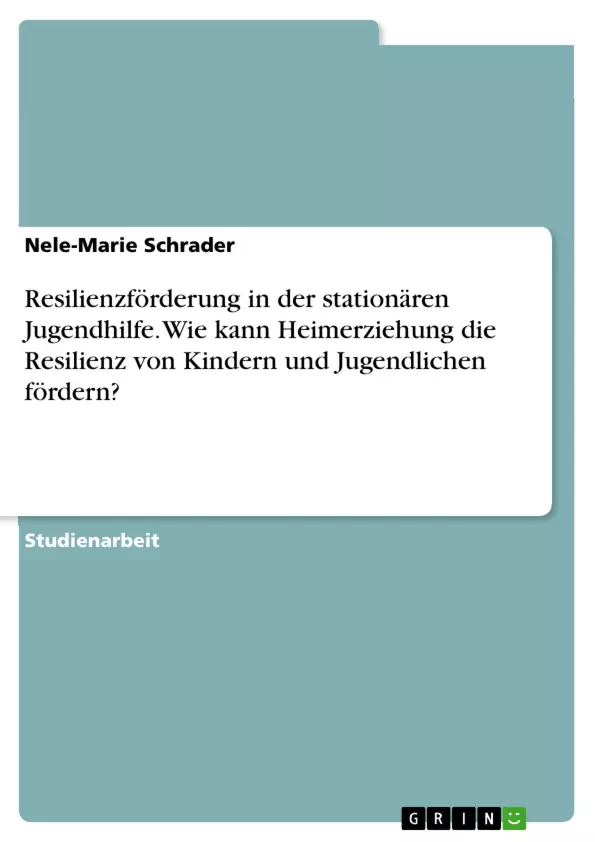In meiner Arbeit möchte ich die Frage klären, ob und inwieweit die stationäre Jugendhilfe die Resilienzförderung von dort betreuten Kindern und Jugendlichen positiv unterstützen kann. Einleitend gebe ich einen kurzen Überblick über die Heimerziehung in ihrer gesetzlichen Grundlage und ihrer Zielgruppe. Anschließend möchte ich die Geschichte des Resilienzbegriffs aufgreifen. Weiterfolgend möchte ich kurz auf das Salutogenesekonzept von Antonovsky und des Weiteren auf die Resilienzmodelle eingehen und diese kurz beleuchten. Nach der Beschreibung der Kauai-Längsschnittstudie von Emmy E. Werner und der Mannheimer Risikostudie gehe ich auf die Schwerpunkte der Resilienzforschung ein. Darauf folgend gehe ich auf die Risiko- und Schutzfaktoren der Resilienz ein. Im vierten Abschnitt beziehe ich mich auf die Förderung von Resilienz in der stationären Jugendhilfe und wie diese umgesetzt werden kann. Ich beende die Hausarbeit mit einem Fazit, in dem ich die gesammelten Informationen zusammenfassen und meine Fragestellung implizit beantworten möchte.
Der Begriff und die Notwendigkeit von Resilienz erfährt im Bereich der Pädagogik, Sozialarbeit und der pädagogischen Psychologie heutzutage immer mehr Anerkennung. Es gibt Erwachsene, die ihre Kindheit trotz Gewalterfahrungen, wie Miss- brauch, Misshandlung, Vernachlässigung, Armut oder Traumata überlebt haben. Entgegen ungünstiger Umstände können sich Kinder und Jugendliche überraschend positiv, kompetent und gesund entwickeln. Dadurch wird die Frage aufgeworfen, wes- halb sie widerstandsfähiger trotz negativer Erfahrungen geworden sind. Kinder und Jugendliche, welche sich in stationären Hilfen zur Erziehung befinden zeigen oft Defizite in ihrer Entwicklung und Bindung auf, da diese bereits in einem jungen Alter unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sind. Voraussetzung für die Aufnahme in stationäre Kinder- und Jugendhilfeangebote sind zum einen die akute Gefährdung des Kindeswohls durch die Herkunftsfamilie, sowie die Eignung und Notwendigkeit der Heimunterbringung, wenn ambulante und teilstationäre Maßnahmen bereits ausgeschöpft worden sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stationäre Jugendhilfe
- 2.1 Begriffserklärung und gesetzlicher Rahmen
- 2.2 Zielgruppe der Heimerziehung
- 3. Resilienz
- 3.1 Begriffserklärung
- 3.2 Forschungsstand
- 3.3 Schwerpunkte der Resilienzforschung
- 3.4 Salutogonesekonzept nach Antonovsky
- 3.5 Resilienzmodelle
- 3.6 Risikofaktoren
- 3.7 Das Schutzfaktorenkonzept
- 4. Resilienzförderung in der Heimerziehung
- 4.1 Unterstützungsmöglichkeiten durch die Heimerziehung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit die stationäre Jugendhilfe die Resilienzförderung von betreuten Kindern und Jugendlichen positiv unterstützen kann. Sie untersucht die Möglichkeiten der Heimerziehung, den Kindern und Jugendlichen zu helfen, trotz schwieriger Lebensumstände stark und widerstandsfähig zu werden.
- Begriffserklärung und gesetzlicher Rahmen der stationären Jugendhilfe
- Definition und Entwicklung des Resilienzbegriffs
- Schlüsselkonzepte und Modelle der Resilienzforschung
- Risiko- und Schutzfaktoren, die die Resilienz beeinflussen
- Möglichkeiten der Resilienzförderung in der stationären Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Relevanz des Themas dar. Sie führt in die Thematik der Resilienz im Kontext der stationären Jugendhilfe ein und stellt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit vor.
Kapitel 2 beleuchtet den gesetzlichen Rahmen und die Zielgruppe der Heimerziehung. Es gibt eine Definition des Begriffs „Heimerziehung“ und erläutert die gesetzlichen Grundlagen sowie die relevanten Zielgruppen.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Resilienzbegriff, dessen Geschichte und Entwicklung sowie den wichtigsten Forschungsaspekten. Es beleuchtet verschiedene Modelle und Konzepte der Resilienzforschung, darunter das Salutogenesekonzept von Antonovsky und die Rolle von Risiko- und Schutzfaktoren.
Kapitel 4 geht auf die Möglichkeiten der Resilienzförderung in der stationären Jugendhilfe ein und zeigt auf, wie die Heimerziehung die Stärken und Ressourcen der Kinder und Jugendlichen fördern kann.
Schlüsselwörter
Resilienz, stationäre Jugendhilfe, Heimerziehung, Kinder und Jugendliche, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Salutogenese, Entwicklungsförderung, Lebensweltorientierung.
- Quote paper
- Nele-Marie Schrader (Author), 2021, Resilienzförderung in der stationären Jugendhilfe. Wie kann Heimerziehung die Resilienz von Kindern und Jugendlichen fördern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1235909