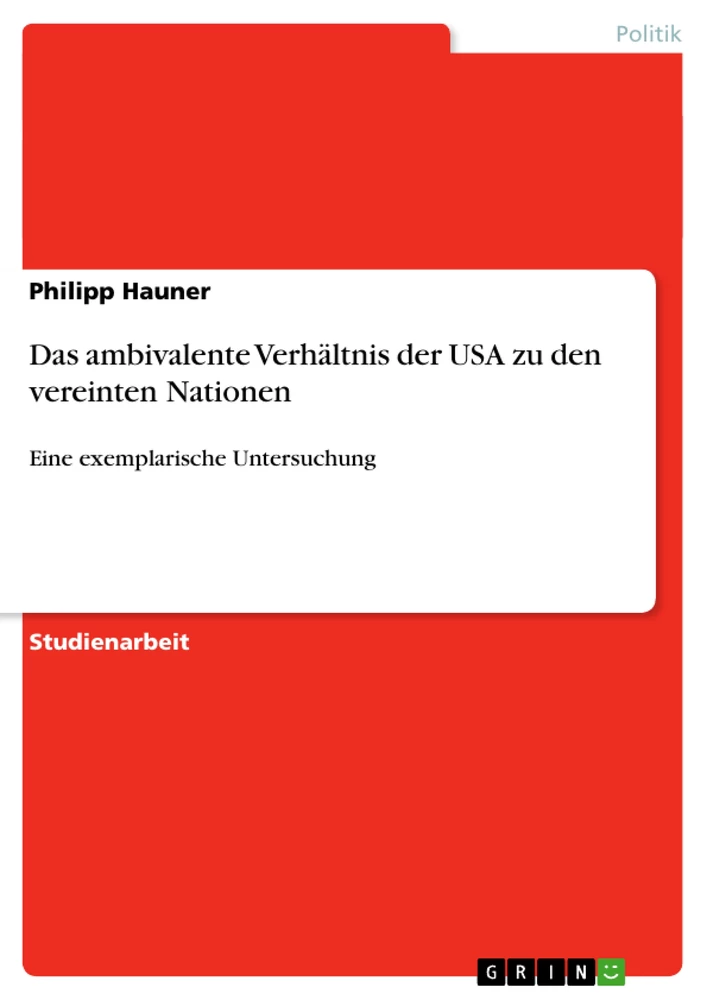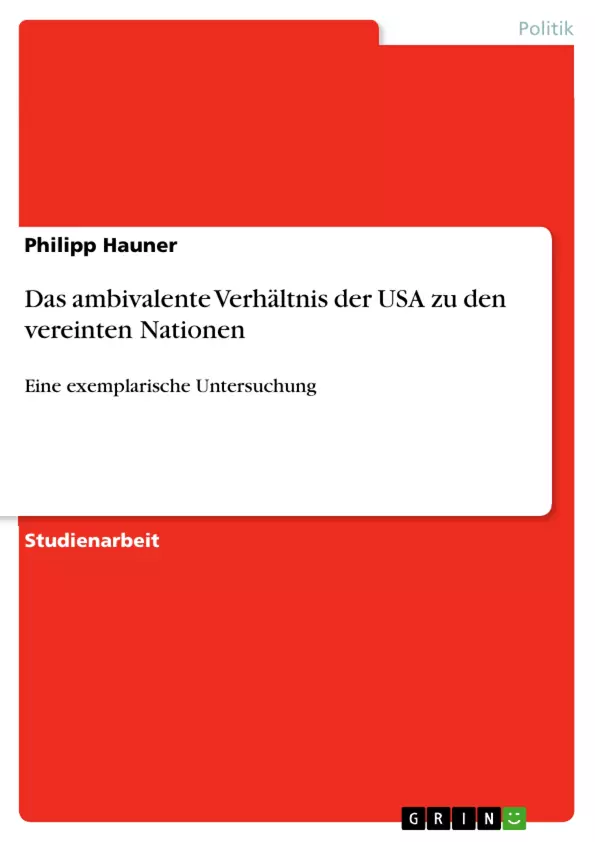Seit ihrer Unabhängigkeitserklärung am 04.07.1776 – und damit seit Beginn ihres Bestehens – prägten und prägen die USA mit ihrer Politik das Bild der Welt. Dabei könnten die Auffassungen der verschiedenen Präsidenten darüber, was gut für die eigene Nation sei, kaum unterschiedlicher sein. Gründervater George Washington warnte in seiner ‚Farewell Address’ seine Landsleute ausdrücklich vor „entangling alliances“ und schlug damit den Weg des Isolationismus ein, dem Amerika lange Zeit treu blieb. Diese Grundeinstellung wich – gleichzeitig mit dem wirtschaftlichen und militärischen Erstarken der USA – einer anderen Auffassung. In seinen berühmt gewordenen `14 Punkten’ nahm der liberale Präsident Woodrow Wilson eine radikale Gegenposition zu Washington ein: Das Bekenntnis „The world must be made safe for democracy“ impliziert die Verpflichtung zu aktivem Engagement in der Weltpolitik. Wilson war der Vordenker des Völkerbundes, der größten anzunehmenden „Allianz“ überhaupt. Er setzte große Hoffnungen in dieses multinationale Experiment. Nach dem Scheitern des Völkerbundes, das u.a. durch Amerikas Absenz von der Organisation bedingt war – der Kongress hatte das Beitrittsgesuch Wilsons zum Völkerbund abgelehnt – , präsentierte sich die USA als „key supporter“ zur Geburtsstunde der UNO. Der Hauptsitz der UNO wurde auf New York festgelegt, die Charta stimmte mit den US-Interessen überein und die gesamte Organisation trug zu sehr großen Teilen die Handschrift Amerikas. 2003: Der Irak-Krieg. Die ganze Welt wurde Zeuge, wie die UNO beim Einmarsch der US-Truppen in den Irak tatenlos und ohnmächtig zusehen musste. Was war passiert? Wieso entfernten sich die USA soweit von den Vereinten Nationen, so dass dieses Verhältnis sogar als „vergiftet“ beschrieben wurde? Was war in der Zeit vor 2003 geschehen? Wo liegen die Chancen für die Zukunft? Die vorliegende Arbeit versucht Antworten auf diese wichtigen Fragen zu geben, indem sie drei prominente Beispiele der US-UN Beziehungen beleuchtet: Amerikas Austritt aus der UNESCO, seine Zurückhaltung von Finanzierungsgeldern und schließlich der Krieg gegen den Irak. Sie sollen exemplarisch Meinungen und Handlungsmuster offenlegen, die das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen prägen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung – Rückblick
- B) Das zerrüttete Verhältnis zwischen USA und UNO
- 1. Der Austritt der Vereinigten Staaten aus der UNESCO
- 1.1. Vorstellung einer UN-Sonderorganisation: Die UNESCO
- 1.2. Die ideologische Determinante unter Präsident Reagan
- 1.3. Die Austrittserklärung der USA:
- 1.3.1 Unzufriedenheit mit dem NWICO-Programm
- 1.3.2. Vorwurf der Politisierung
- 2. Die inkonsistente Zahlungsmoral der USA
- 2.1. Vorstellung des Finanzierungssystems der UNO
- 2.2. Die Entwicklung der Finanzierung bis 1999
- 2.3 Das Helms-Biden-Agreement
- 2.4 Hintergründe der amerikanischen Zahlungsverweigerung:
- 2.4.1 Die amerikanische Sichtweise auf die UNO: „Tyrannei der Mehrheit“
- 2.4.2. Innenpolitische Machtspiele: Kongress vs. Administration
- 2.4.3 Zahlungsverweigerung als Druckmittel
- 3. Der Irak-Krieg: Ein neues Kapitel zwischen USA und UNO
- 3.1. Bush’s Bekenntnis zur „National Security Strategy“
- 3.2. Der Kampf um Resolutionen im Sicherheitsrat
- 3.3. „Exceptionalism“ als wichtiges Motiv für den US-Alleingang
- 3.4. Die UNO – für die USA obsolet geworden?
- 1. Der Austritt der Vereinigten Staaten aus der UNESCO
- C) Schlussbemerkungen – Aussicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das ambivalente Verhältnis der USA zu den Vereinten Nationen. Ziel ist es, anhand exemplarischer Fälle die Meinungen und Handlungsmuster aufzuzeigen, welche die Beziehung zwischen den USA und der UNO prägen. Die Arbeit vermeidet eine umfassende Geschichte der Beziehungen, sondern konzentriert sich auf ausgewählte Aspekte.
- Der Austritt der USA aus der UNESCO
- Die inkonsistente Zahlungsmoral der USA gegenüber der UNO
- Die Rolle der USA im Vorfeld und während des Irak-Krieges
- Der Einfluss innenpolitischer Faktoren auf die US-Außenpolitik gegenüber der UNO
- Das Konzept des amerikanischen „Exceptionalism“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der US-amerikanischen Außenpolitik gegenüber internationalen Organisationen, vom Isolationismus bis hin zum aktiven Engagement, und führt in die Problematik des zerrütteten Verhältnisses zwischen den USA und der UNO ein. Der erste Teil analysiert den Austritt der USA aus der UNESCO im Kontext der Reagan-Ära und der ideologischen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion. Die Kritikpunkte der USA an der UNESCO umfassen die Neue Weltinformations- und Kommunikationsordnung (NWIKO) und die Politisierung der Organisation, insbesondere in Bezug auf die Israel-Frage. Der zweite Teil beschreibt das Finanzierungssystem der UNO und die inkonsistente Zahlungsmoral der USA, die oft als Druckmittel eingesetzt wurde. Der dritte Teil behandelt den Irak-Krieg und die damit verbundenen Spannungen, wobei der Konflikt um Resolutionen im Sicherheitsrat und die Rolle der "National Security Strategy" der USA beleuchtet werden. Die amerikanische Doktrin des „Exceptionalism“ wird als ein wichtiges Motiv für den US-Alleingang im Irak-Krieg untersucht.
Schlüsselwörter
USA, Vereinte Nationen, UNESCO, Irak-Krieg, Finanzierung, „Exceptionalism“, Zahlungsverweigerung, Multilateralismus, Unilateralismus, NWIKO, Sicherheitsrat, Resolutionen, Innenpolitik, Kongress, Administration.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Verhältnis der USA zur UNO ambivalent?
Die USA waren Gründerväter der UNO, schwanken aber historisch zwischen aktivem Multilateralismus und isolationistischem Unilateralismus, je nach politischer Führung und nationalen Interessen.
Warum traten die USA aus der UNESCO aus?
Unter Präsident Reagan kritisierten die USA die angebliche Politisierung der Organisation, die Nähe zu sowjetischen Interessen und das NWIKO-Programm zur Medienkontrolle.
Was bedeutet „Exceptionalism“ in der US-Außenpolitik?
Es ist die Überzeugung, dass die USA eine Sonderstellung in der Welt einnehmen und daher berechtigt sind, im Zweifelsfall auch ohne internationales Mandat (wie im Irak-Krieg) zu handeln.
Warum hielten die USA zeitweise Beitragszahlungen an die UNO zurück?
Die Zahlungsverweigerung wurde oft als Druckmittel genutzt, um Reformen innerhalb der UNO zu erzwingen oder um gegen eine vermeintliche „Tyrannei der Mehrheit“ im Sicherheitsrat zu protestieren.
Was änderte der Irak-Krieg 2003 am Verhältnis zur UNO?
Der Einmarsch ohne explizite UN-Resolution führte zu einer tiefen Krise und Machtlosigkeit der UNO, woraufhin das Verhältnis oft als „vergiftet“ bezeichnet wurde.
Was ist das Helms-Biden-Agreement?
Ein Abkommen von 1999, das die Rückzahlung amerikanischer Schulden an die UNO an spezifische Reformbedingungen knüpfte.
- Arbeit zitieren
- Philipp Hauner (Autor:in), 2006, Das ambivalente Verhältnis der USA zu den vereinten Nationen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123595