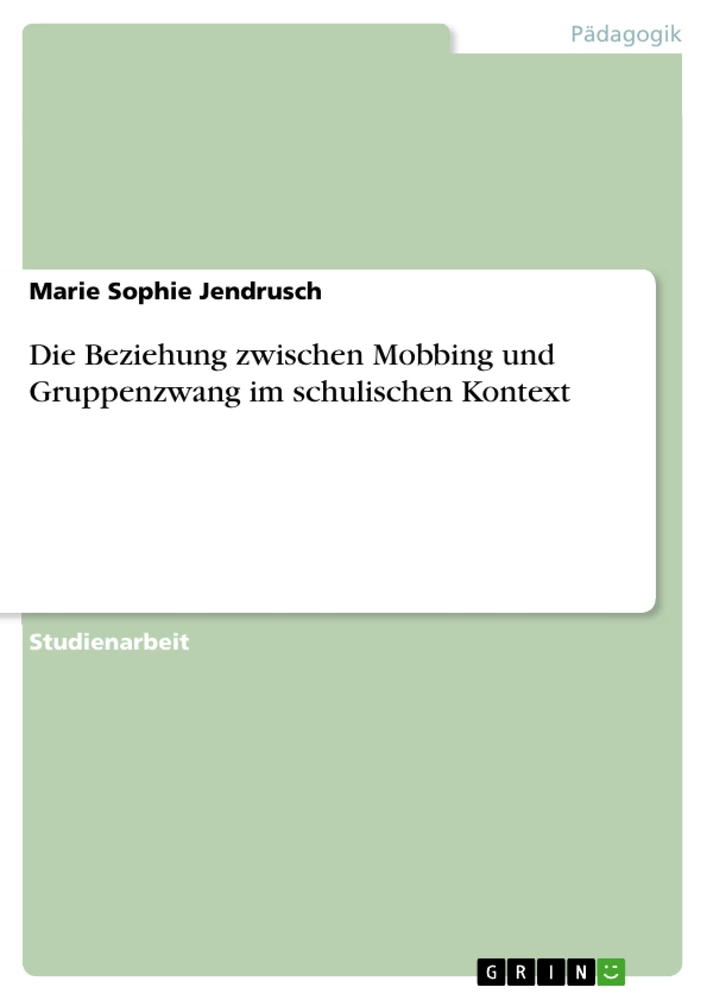Das Thema Mobbing stellt eine große Problematik unserer heutigen Gesellschaft dar. Im Schulalltag sehen sich viele LehrerInnen mit dieser Art von Gewalt unter SchülerInnen konfrontiert. Mobbing-Fälle sind dabei stets sehr komplex und für Außenstehende schwer nachzuvollziehen. Peer Groups sind ein entscheidender Faktor, wenn es um Mobbing geht. In der Arbeit soll die Frage, was Gruppen beziehungsweise Peer Groups im Speziellen eigentlich sind, geklärt werden. Zudem ist es sehr wichtig, sich die Bedeutung, den Stellenwert, den solche Peer Groups für Jugendliche haben, vor Augen zu führen. Auf dieser Grundlage ist das weitere Vorgehen leichter zu verstehen, da die Peers der SchülerInnen immer wieder auftreten werden und die Möglichkeit von Gruppenzwang nur auf der Basis des Stellenwertes der Zugehörigkeit zu Gruppen erläutert werden kann.
Nachdem sowohl in definitorischer Hinsicht als auch inhaltlich mit Blick auf die Jugendlichen die Bedeutung von Peer Groups herausgestellt wurde, gelangt diese Arbeit zu dem Themenkomplex des Gruppenzwanges, auch Gruppendruck genannt. Hierbei soll die Funktionsweise und Dynamik von Gruppenzwang verdeutlicht werden, indem eine nähere Betrachtung der Entstehung und Äußerung von Gruppendruck vorgenommen wird.
Diese Arbeit beschäftigt sich des Weiteren mit der Frage, was Mobbing eigentlich ist, und versucht, die Strukturen von Mobbing aufzudecken und zu erläutern. Neben der Klärung von Definitionsansätzen und der Entstehung von Mobbing sollen hier auch die Rollen der verschiedenen Beteiligten beleuchtet werden. Wie wird ein Mensch im Schulalter zum Täter und was bedeutet Mobbing für das Opfer? Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Täter/Opfer“ und welche entscheidende Rolle können Zeugen spielen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition des Begriffs Gruppe/Peer Group
- 2.1 Der Stellenwert von Peer Groups für Jugendliche
- 3. Gruppenzwang
- 3.1 Was ist Gruppenzwang und wie äußert er sich?
- 3.2 Entstehung von Gruppenzwang
- 4. Mobbing
- 4.1 Was ist Mobbing?
- 4.1.1 Mobbing als Gewalttat - Die fünf Arten von Gewalt
- 4.1.2 Formen von Mobbing
- 4.2 Entstehung von Mobbing
- 4.3 Die Beteiligten
- 4.3.1 Täter
- 4.3.2 Opfer
- 4.3.3 Täter/Opfer
- 4.3.4 Zeugen
- 5. Gruppenzwang und Mobbing und ihre gegenseitige Beeinflussung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen Mobbing und Gruppenzwang im schulischen Kontext. Die Arbeit klärt zunächst die Bedeutung von Peer Groups für Jugendliche und definiert die Konzepte von Gruppenzwang und Mobbing. Anschließend werden die Entstehungsprozesse beider Phänomene analysiert, unter Berücksichtigung der verschiedenen beteiligten Rollen (Täter, Opfer, Zeugen). Schließlich wird der Fokus auf die gegenseitige Beeinflussung von Gruppenzwang und Mobbing gelegt.
- Bedeutung von Peer Groups im Jugendalter
- Definition und Entstehung von Gruppenzwang
- Definition und Entstehung von Mobbing
- Rollen der Beteiligten bei Mobbing (Täter, Opfer, Zeugen)
- Der Zusammenhang zwischen Gruppenzwang und Mobbing
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Mobbing als gesellschaftliches Problem ein und betont die Komplexität von Mobbing-Fällen im schulischen Kontext. Sie begründet die Bedeutung der Untersuchung von Peer Groups als zentralen Faktor im Mobbinggeschehen und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von der Definition von Peer Groups über Gruppenzwang und Mobbing bis hin zur Analyse der gegenseitigen Beeinflussung dieser beiden Phänomene führt. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Argumentation und hebt die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung der sozialen Dynamiken hervor.
2. Definition des Begriffs Gruppe/Peer Group: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionen des Gruppenbegriffs, die auf Interaktion oder Normen basieren. Es werden wesentliche Merkmale von Gruppen vorgestellt, wie Gruppengröße, gemeinsames Ziel, Kommunikation und Dauer. Der Fokus liegt dann auf der Anwendung dieser Merkmale auf Peer Groups, die als Gruppen von Gleichaltrigen definiert werden, die heterogene Beziehungen und ein hohes Konfliktpotenzial aufweisen können. Das Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der sozialen Strukturen, in denen Mobbing und Gruppenzwang stattfinden.
2.1 Der Stellenwert von Peer Groups für Jugendliche: Dieser Abschnitt betont den hohen Stellenwert von Peer Groups für Jugendliche in der Adoleszenz. Die Beziehungen zu Gleichaltrigen werden als zentral für die Selbstwertbildung der Jugendlichen beschrieben, da sie die Selbstwahrnehmung und -beurteilung stark beeinflussen. Die Bedeutung der Peer Group steigt mit dem abnehmenden Einfluss der Erwachsenen, wie Eltern. Die Kapitel liefert einen wichtigen Kontext für die folgenden Kapitel indem es den Einfluss der Peer-Gruppe in der Entwicklung des Jugendlichen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Mobbing, Gruppenzwang, Peer Groups, Jugendliche, Schule, Gewalt, Sozialpsychologie, Selbstwert, Gruppenprozesse, soziale Rollen, Konflikt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Mobbing und Gruppenzwang
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Mobbing und Gruppenzwang im schulischen Kontext. Sie analysiert die Entstehung und die gegenseitige Beeinflussung dieser beiden Phänomene und beleuchtet die Rolle von Peer Groups (Gleichaltrigen-Gruppen) für Jugendliche.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Bedeutung von Peer Groups für Jugendliche, die Definition und Entstehung von Gruppenzwang und Mobbing, die verschiedenen Rollen der Beteiligten an Mobbing (Täter, Opfer, Zeugen) und den Zusammenhang zwischen Gruppenzwang und Mobbing.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition des Begriffs Gruppe/Peer Group (inkl. Stellenwert von Peer Groups für Jugendliche), Gruppenzwang (inkl. Entstehung und Erscheinungsformen), Mobbing (inkl. Definition, Entstehung, Formen und die Rollen der Beteiligten), die gegenseitige Beeinflussung von Gruppenzwang und Mobbing, und ein Fazit. Die Arbeit enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird unter Gruppenzwang verstanden?
Die Hausarbeit definiert Gruppenzwang und beschreibt, wie er sich äußert und entsteht. Der Fokus liegt auf seiner Rolle im Kontext von Mobbing.
Was wird unter Mobbing verstanden?
Die Hausarbeit definiert Mobbing als Gewalttat, unterscheidet verschiedene Arten von Gewalt und Mobbingformen. Sie beschreibt die Entstehung von Mobbing und analysiert die Rollen der Beteiligten (Täter, Opfer, Täter/Opfer, Zeugen).
Welche Rolle spielen Peer Groups?
Die Hausarbeit betont die zentrale Rolle von Peer Groups in der Adoleszenz. Die Beziehungen zu Gleichaltrigen beeinflussen die Selbstwertbildung und Selbstwahrnehmung von Jugendlichen stark. Der Einfluss der Peer Group nimmt mit dem abnehmenden Einfluss der Erwachsenen zu.
Wie beeinflussen sich Gruppenzwang und Mobbing gegenseitig?
Die Hausarbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Gruppenzwang und Mobbing und untersucht, wie diese beiden Phänomene sich gegenseitig beeinflussen und verstärken können.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Hausarbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Mobbing, Gruppenzwang, Peer Groups, Jugendliche, Schule, Gewalt, Sozialpsychologie, Selbstwert, Gruppenprozesse, soziale Rollen und Konflikt.
Für wen ist diese Hausarbeit gedacht?
Diese Hausarbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Mobbing und Gruppenzwang.
- Quote paper
- Master of Education Marie Sophie Jendrusch (Author), 2014, Die Beziehung zwischen Mobbing und Gruppenzwang im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1236024