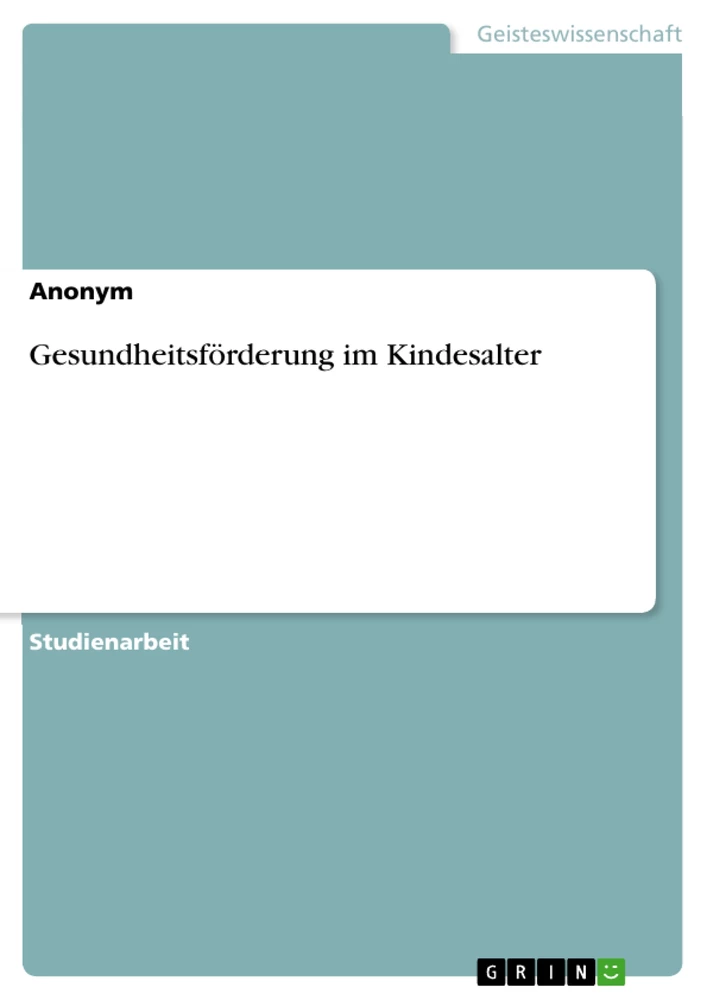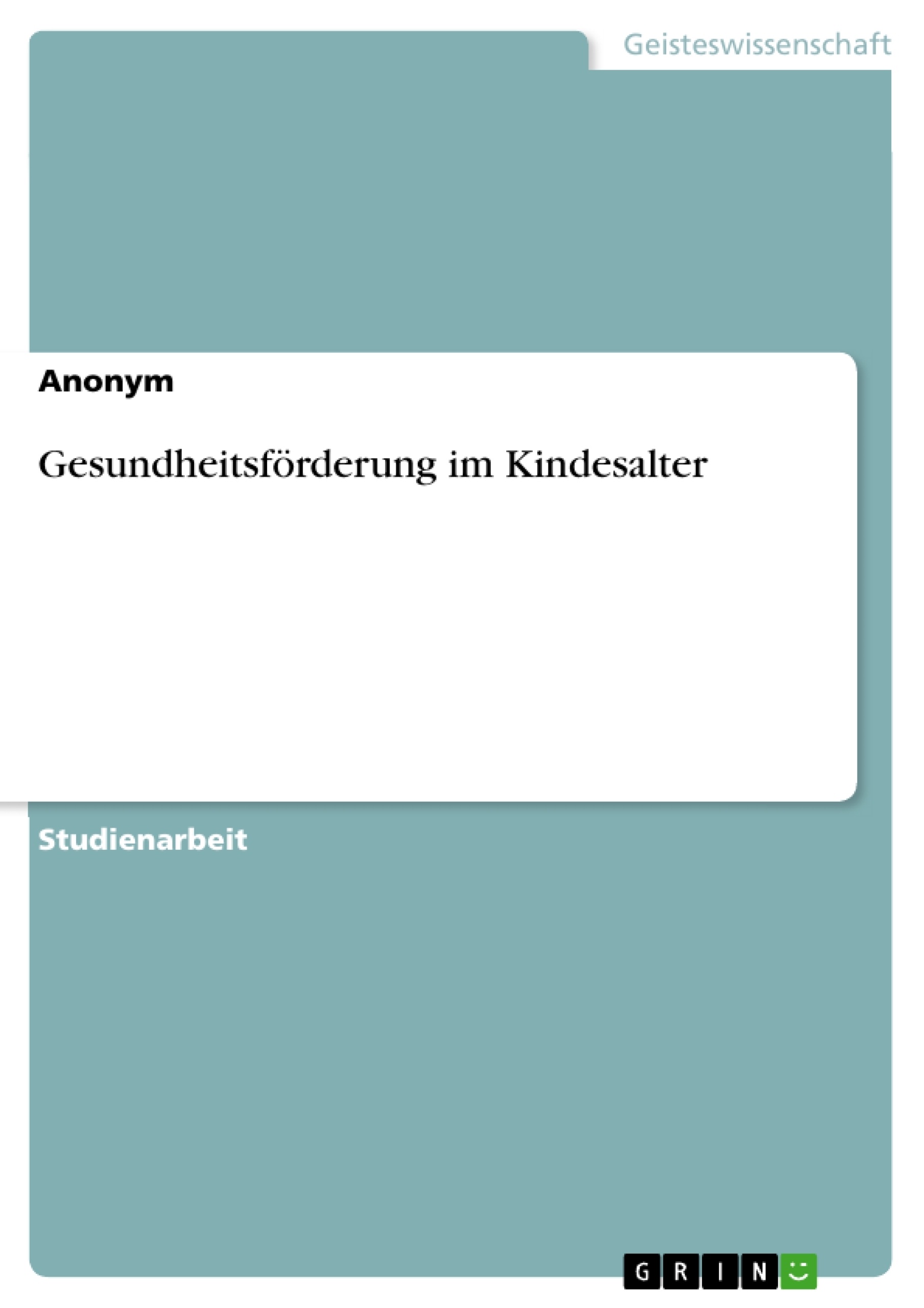Die Arbeit mit Kindern, aber auch der Alltag zeigt bei genauerer Betrachtung, dass einige Kinder deutlich schneller und öfter erkranken als andere. Aus diesem Grund wird sich die folgende Hausarbeit mit Gesundheit und deren Förderung befassen. Bereits bei der Definition, was Gesundheit genau ist, gibt es verschiedene Auffassungen. Das weitaus Wichtigere ist jedoch, wie dieser Zustand dann erhalten werden kann. Dazu tragen die Eltern den größten Teil der Verantwortung. Daraus entsteht dann allerdings die Frage: "Wie können SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen die Gesundheit von Kindern noch zusätzlich fördern?"
Ziel dieser Arbeit ist es also genau diese Frage aufzuklären und ein Bild darüber zu vermitteln, wie viele Faktoren in die Gesundheit mit einfließen, die nicht zufällig auftreten, sondern von außen in hohem Maß beeinflussbar sind.
Dazu wird zuerst eine Definition verdeutlichen was Gesundheit oder Krankheit überhaupt ist. Danach wird es darum gehen, auf welche Weise die Gesundheit erhalten werden kann und wodurch sie überhaupt beeinflusst wird. Hier werden einzelne Faktoren aufgelistet, um einen Eindruck zu bekommen, was sich alles auf die Gesundheit auswirken kann. Anschließend wird der Bezug zur Kindheit gezogen. Dazu wird herausgearbeitet auf welche Bedingungen in der Kindheit geachtet werden sollte und wie speziell in dieser Lebensphase unterstützt werden kann. Folgend wird ebenfalls ein Bezug zur Sozialen Arbeit gezogen, in dem dargelegt wird, was genau Professionelle zur Gesundheitsförderung im Kindesalter ergänzend tun können. Zum Abschluss wird mit Hilfe eines Fazits die Ausgangsfrage beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- Gesundheit
- Krankheit
- Gesundheitsförderung
- Erhaltung der Gesundheit
- Methoden
- Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen
- Bezug zur Kindheit
- Sauberkeit
- Ernährung
- Bewegung und Entspannung
- Ressourcenförderung
- Bezug zur Sozialen Arbeit
- Förderung durch SozialarbeiterInnen/ SozialpädagogInnen
- Gestaltung der Umgebung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Gesundheitsförderung im Kindesalter. Sie zielt darauf ab, die verschiedenen Faktoren zu beleuchten, die die Gesundheit von Kindern beeinflussen und wie diese Faktoren aktiv gestaltet werden können.
- Definition und Bedeutung von Gesundheit im Kindesalter
- Faktoren, die die Gesundheit von Kindern beeinflussen
- Methoden der Gesundheitsförderung im Kindesalter
- Rolle von Sozialarbeit in der Gesundheitsförderung von Kindern
- Bedeutung der Gestaltung der Umgebung für die Gesundheit von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Gesundheitsförderung im Kindesalter ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Das zweite Kapitel widmet sich der Begriffserklärung von Gesundheit, Krankheit und Gesundheitsförderung. Es beleuchtet verschiedene Definitionen aus wissenschaftlicher Sicht. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Erhaltung der Gesundheit und stellt verschiedene Methoden und Einflussfaktoren vor. Im vierten Kapitel wird der Bezug zur Kindheit hergestellt und es werden wichtige Bedingungen für die Gesundheit von Kindern herausgearbeitet. Das fünfte Kapitel widmet sich dem Bezug zur Sozialen Arbeit und legt dar, wie SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen die Gesundheitsförderung von Kindern unterstützen können. Abschließend fasst das Fazit die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Gesundheitsförderung, Kinder, Gesundheit, Krankheit, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Prävention, Einflussfaktoren, Ressourcenförderung, Lebensumfeld, Wohlbefinden, Entwicklung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Gesundheitsförderung im Kindesalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1236394