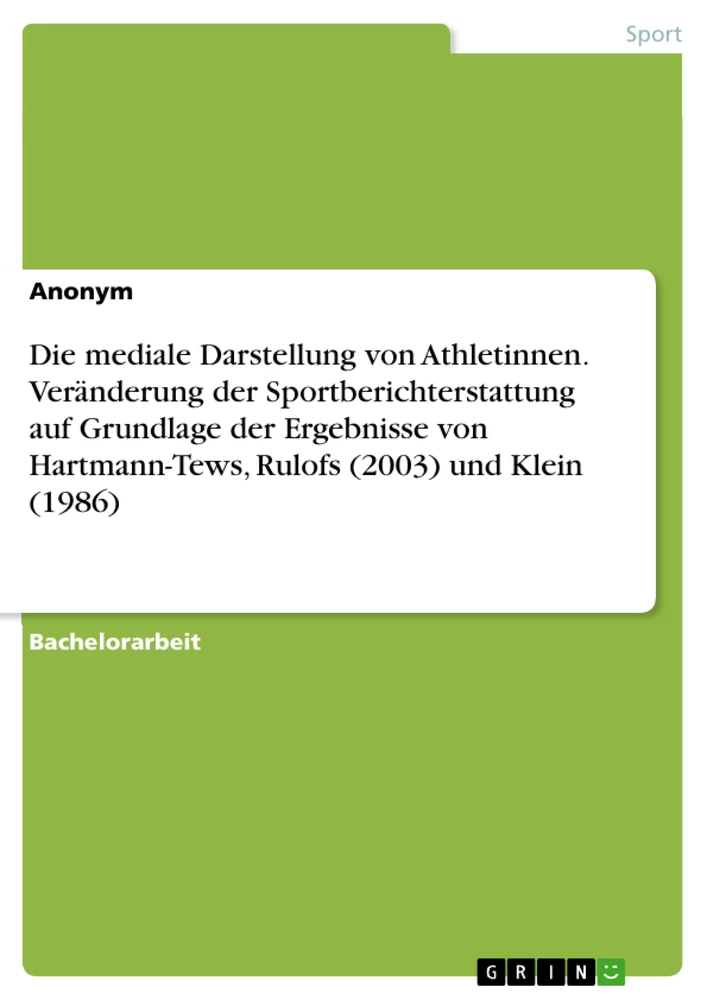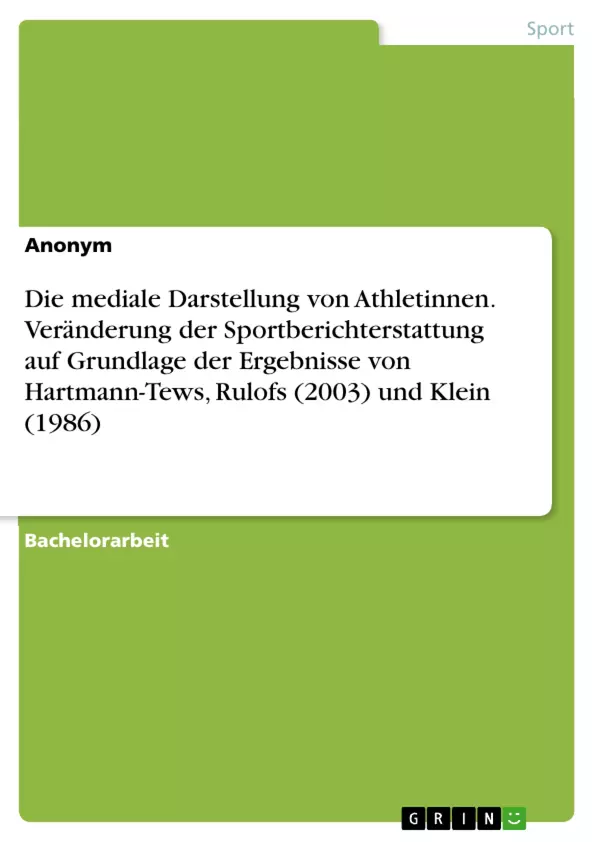In der Vergangenheit belegten Studien immer wieder, dass die Berichterstattung über Athletinnen sich erheblich von der über Athleten unterscheidet. Die Studie dieser Arbeit untersucht Artikel aus dem 2021 hinsichtlich der vor über 30 Jahren festgestellten Diskursstrategien der Medien (Sexualisierung, Trivialisierung ...).
Die Arbeit zeigt, wie sich die Berichterstattung von Sportler*innen unterscheidet, wie Sportlerinnen in den Medien dargestellt werden und was sich in den letzten 20 Jahren seit der Studie von Hartmann-Tews und Rulofs (2003) verändert hat.
In der Sportlandschaft haben sich Veränderungen im Frauen- und Männersport vollzogen. In der Vergangenheit belegten Studien, dass die Berichterstattung über Sportler*innen Diskursstrategien wie Sexualisierung, Trivialisierung oder die Präsentation von Sportlerinnen in nicht-sportlichen Rollen beinhaltet. Zwanzig Jahre später zeigte die Studie von Hartmann-Tews und Rulofs (2003) deutlich, dass Sportlerinnen zwar häufiger als noch vor 20 Jahren, aber immer noch viel seltener in den Medien erwähnt werden. Diese Arbeit soll beleuchten, ob diese Ungleichheit auch noch im Jahr 2021 besteht.
Demnach stellt sich die Frage nach der Realität der Sportberichterstattung im Jahr 2021. Wie unterscheidet sich die Berichterstattung von Sportlern und Sportlerinnen? Wie werden Sportlerinnen in den Medien dargestellt? Was hat sich in den letzten 20 Jahren seit der Studie von Hartmann-Tews und Rulofs (2003) verändert?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Forschungsstand
- Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Forschungsstand im deutschsprachigem Raum
- Soziale Konstruktion von Geschlecht im Sport
- Die Entwicklung des Frauensports
- Massenmedien
- Die Massenmedien als gesellschaftliches Teilsystem
- Sport in den Massenmedien
- Darstellung der Vergleichsstudien
- Studie von Klein (1986)
- Aufbau
- Ergebnisse
- Reflektion
- Studie von Hartmann-Tews und Rulofs (2003)
- Aufbau
- Ergebnisse
- Reflektion
- Konzeption der empirischen Untersuchung
- Forschungsziel und Fragestellung
- Methodische Durchführung
- Auswahl der Tageszeitungen
- Kategoriensystem
- Operationalisierung der Kategorien
- Darstellung, Interpretation und Vergleich der Ergebnisse
- Darstellung und Interpretation
- Umfang der Berichterstattung
- Sportarten
- Leistungs- und Erfolgsbewertungen
- Personenbeschreibungen
- Privates und Nicht-Sportliche Karriere
- Handeln unter Sportler*innen
- Vergleich
- Vergleich der ausgewählten Zeitungen
- Historischer Vergleich
- Fazit und Reflektion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die mediale Darstellung von Athletinnen im deutschen Sportjournalismus. Sie analysiert die Veränderungen in der Berichterstattung über Frauen im Sport und setzt die Ergebnisse in Bezug zu den Studien von Hartmann-Tews und Rulofs (2003) und Klein (1986).
- Die Entwicklung der Berichterstattung über Frauen im Sport
- Die Rolle der Massenmedien in der Konstruktion von Geschlecht
- Der Einfluss von medialen Darstellungen auf das öffentliche Bild von Athletinnen
- Der Vergleich verschiedener Zeitungen und Medienformate
- Die Auswirkungen von Stereotypen und Vorurteilen auf die Berichterstattung über Athletinnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie führt in die Thematik der medialen Darstellung von Athletinnen ein und beleuchtet die Problematik der stereotypen Berichterstattung. Die Arbeit analysiert die Veränderung der Sportberichterstattung auf Grundlage der Ergebnisse von Hartmann-Tews und Rulofs (2003) und Klein (1986). Die Analyse der Daten zeigt, dass die Berichterstattung über Frauen im Sport immer noch von Stereotypen geprägt ist und dass die mediale Darstellung von Athletinnen weiterhin von traditionellen Geschlechterrollen beeinflusst wird. Die Arbeit bietet eine umfassende Analyse des Forschungsstandes zum Thema mediale Darstellung von Athletinnen und liefert eine kritische Auseinandersetzung mit den aktuellen Entwicklungen in der Berichterstattung über Frauen im Sport.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der medialen Darstellung von Athletinnen, der Veränderung der Sportberichterstattung, der sozialen Konstruktion von Geschlecht im Sport, dem Einfluss von Massenmedien, der Analyse von Tageszeitungen und der Entwicklung von Stereotypen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Die mediale Darstellung von Athletinnen. Veränderung der Sportberichterstattung auf Grundlage der Ergebnisse von Hartmann-Tews, Rulofs (2003) und Klein (1986), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1236714