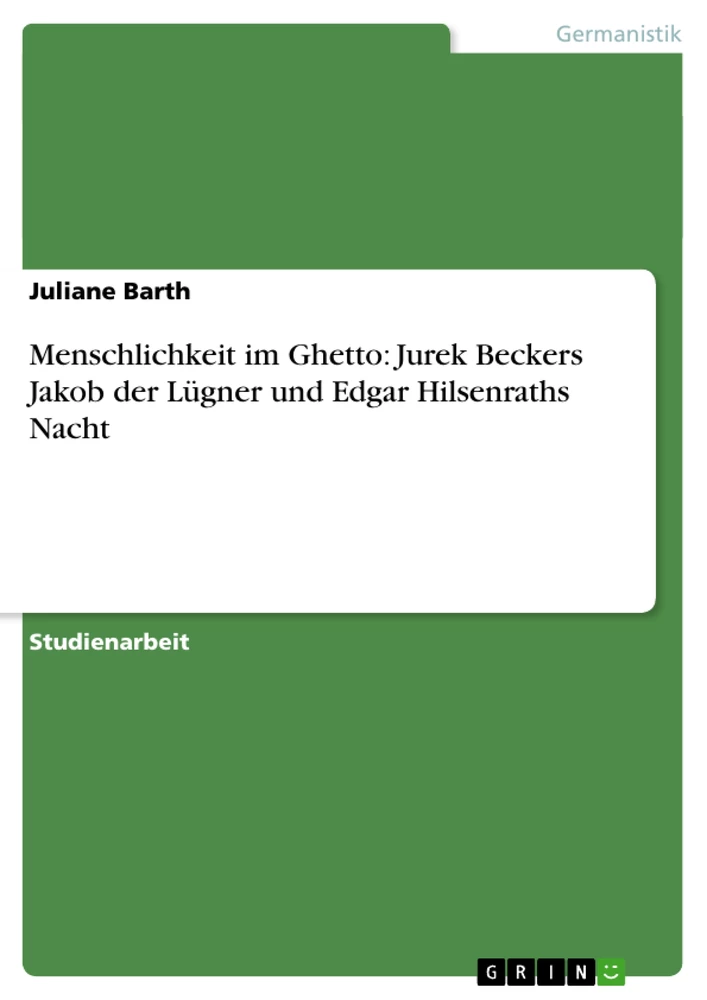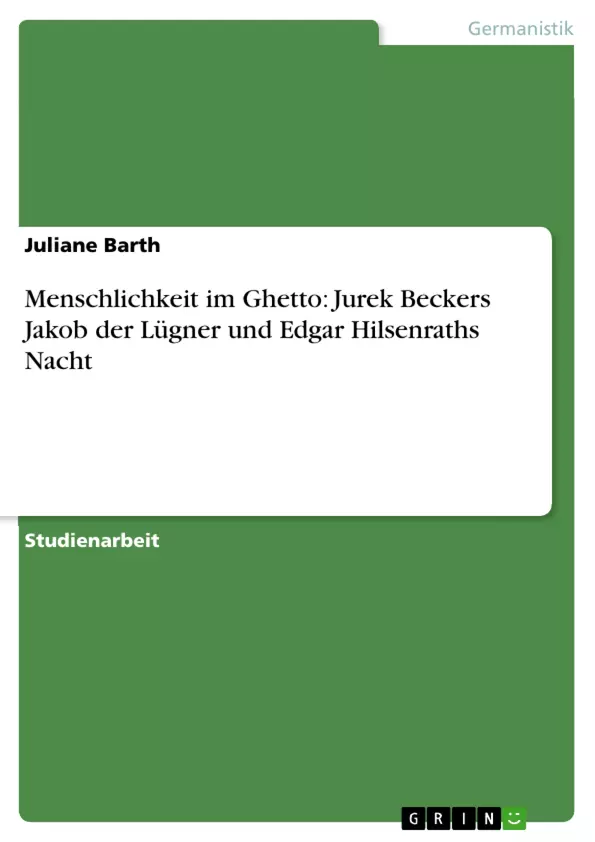1969 erscheint in der DDR Jurek Beckers Erstlingswerk „Jakob der Lügner“. Der Roman stößt im In- und Ausland auf eine außergewöhnlich positive Resonanz. Becker erhält dafür den Heinrich-Mann-Preis der DDR und den Schweizer Charles-Veillon-Preis. Der Autor schreibt auf eine leichte, amüsante Art, mit Humor Charme und Grazie über ein unerfreuliches und düsteres Thema: das Leben und Überleben von Juden in einem nationalsozialistischen Ghetto.
„Nacht“ erscheint erstmals 1964 in einer Miniauflage bei Kindler. Der Titel verschwindet jedoch schnell wieder in der Versenkung, aus dem Kindler Verlag hieß es damals zur Begründung: „in Deutschland darf ein solches Buch nicht verbreitet werden.“ Nina Raven-Kindler, Frau des Verlegers und damalige Geschäftsführerin sagte sogar: „In unserem Verlag fand sich keine Stimme dafür... Ich fürchte die falsche Reaktion des Publikums, das sehr gerne etwas finden möchte, um seine antisemitische Haltung zu rechtfertigen.“ Diese Angst, Antisemitismus zu schüren, liegt darin begründet, daß Hilsenrath in seinem Roman erstmals mit der damaligen Tradition bricht, jüdische Figuren ausschließlich positiv darzustellen. Er schreibt gegen philosemitische Haltungen an, indem er ohne Schönfärberei schildert, wie die Bewohner eines jüdischen Ghettos unter Hunger, Kälte und Krankheiten leidend, zu kämpfenden Rivalen um jedes Stück Brot oder einen Schlafplatz werden. Erst nach weltweitem Erfolg wird der Roman 1978 neu verlegt.
Die offensichtliche Gegensätzlichkeit zweier von jüdischen Autoren geschriebenen Ghettoromane hat mich zur genaueren Betrachtung der beiden Werke veranlaßt. Da für eine umfassende Interpretation in dieser Arbeit nicht genug Platz sein wird, möchte ich mich auf die Untersuchung wichtiger Figuren konzentrieren. Ich werde zeigen, wie unterschiedlich, in einigen Punkten aber doch ähnlich, die Autoren ihre Figuren im Ghetto agieren lassen, wie diese sich zwar an das Grauen gewöhnt haben, dennoch aber versuchen, dagegen anzukämpfen. Ich habe mich dabei auf die Opfer – also auf die jüdischen Ghettobewohner – konzentriert. Die Täter spielen in beiden Romanen keine große Rolle, bei Becker bleiben sie meist typenhaft. In „Nacht“ werden die Opfer gleichzeitig zu Tätern, die wahren Täter tauchen nur schemenhaft auf.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- FIGUREN IN „JAKOB DER LÜGNER“
- DIE HAUPTFIGUR JAKOB HEYM
- DER ERZÄHLER
- KOWALSKI
- MISCHA UND ROSA
- HERSCHEL SCHTAMM, LEONARD SCHMITT UND PROF. KIRSCHBAUM
- LINA
- FIGUREN IN „NACHT“
- DIE HAUPTFIGUR RANEK
- DEBORA
- WEITERE FIGUREN
- VERGLEICH
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Menschlichkeit im Ghetto anhand der Figuren in den Romanen „Jakob der Lügner“ von Jurek Becker und „Nacht“ von Edgar Hilsenrath. Die Arbeit analysiert, wie unterschiedlich und doch ähnlich die Autoren ihre Figuren im Ghetto agieren lassen, und zeigt, wie diese sich trotz der Grausamkeiten des Ghettos bemühen, dagegen anzukämpfen.
- Darstellung der menschlichen Reaktionen auf das Leben im Ghetto
- Untersuchung der Mechanismen der Anpassung und des Überlebens
- Analyse der individuellen Entscheidungen und moralischen Dilemmata der Figuren
- Vergleich der unterschiedlichen Schreibstile und Perspektiven der beiden Autoren
- Bedeutung der Hoffnung und der Suche nach Menschlichkeit inmitten der Verzweiflung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Romane „Jakob der Lügner“ und „Nacht“ vor und erläutert den Hintergrund und die Intention der Arbeit. Die Analyse der Figuren in „Jakob der Lügner“ konzentriert sich auf die Hauptfigur Jakob Heym, den Erzähler, Kowalski, Mischa und Rosa sowie Herschel Stamm, Leonard Schmitt und Professor Kirschbaum. Es wird Jakobs Entwicklung im Ghetto dargestellt, seine Rolle als „Lügner“ und die Folgen seiner Handlungen. Die Analyse der Figuren in „Nacht“ konzentriert sich auf die Hauptfigur Ranek, Debora und weitere Figuren. Die Arbeit untersucht, wie die Figuren in „Nacht“ mit der brutalen Realität des Ghettos konfrontiert sind und wie sie damit umgehen. Die Analyse der Figuren in beiden Romanen dient als Grundlage für den anschließenden Vergleich, in dem die unterschiedlichen Darstellungen der Menschlichkeit im Ghetto und die verschiedenen Strategien des Überlebens herausgestellt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Menschlichkeit, Ghetto, Holocaust, jüdische Autoren, Literaturanalyse, Figurencharakterisierung, Überlebensstrategien, Hoffnung, Verzweiflung, moralische Dilemmata, Jurek Becker, „Jakob der Lügner“, Edgar Hilsenrath, „Nacht“. Die Analyse der Figuren in beiden Romanen beleuchtet die unterschiedlichen Reaktionen auf die Grausamkeiten des Ghettos und bietet einen Einblick in die menschlichen Abgründe und die Suche nach Menschlichkeit inmitten der Verzweiflung.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich die Ghettoromane von Becker und Hilsenrath?
Jurek Becker schreibt in „Jakob der Lügner“ mit Humor und Charme über die Hoffnung, während Edgar Hilsenrath in „Nacht“ die brutale, ungeschönte Rivalität ums Überleben schildert.
Warum war Hilsenraths „Nacht“ anfangs umstritten?
Hilsenrath brach mit der Tradition, jüdische Opfer ausschließlich positiv darzustellen, und zeigte sie als Menschen, die unter extremem Hunger selbst zu Tätern werden können.
Welche Rolle spielen Lügen in Beckers Roman?
Die Hauptfigur Jakob Heym erfindet Nachrichten über einen nahenden Sieg, um den Ghettobewohnern Hoffnung zu geben und sie vor der Verzweiflung zu bewahren.
Wie wird das Thema Menschlichkeit in den Werken behandelt?
Die Arbeit analysiert, wie Figuren trotz Grauen und Anpassung versuchen, ihre Menschlichkeit zu bewahren oder wie sie im Kampf um ein Stück Brot verloren geht.
Werden die Täter in den Romanen thematisiert?
Die NS-Täter bleiben meist im Hintergrund oder schemenhaft; der Fokus liegt ganz auf der psychologischen Dynamik innerhalb der Opfergemeinschaft.
- Quote paper
- Juliane Barth (Author), 1999, Menschlichkeit im Ghetto: Jurek Beckers Jakob der Lügner und Edgar Hilsenraths Nacht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12368