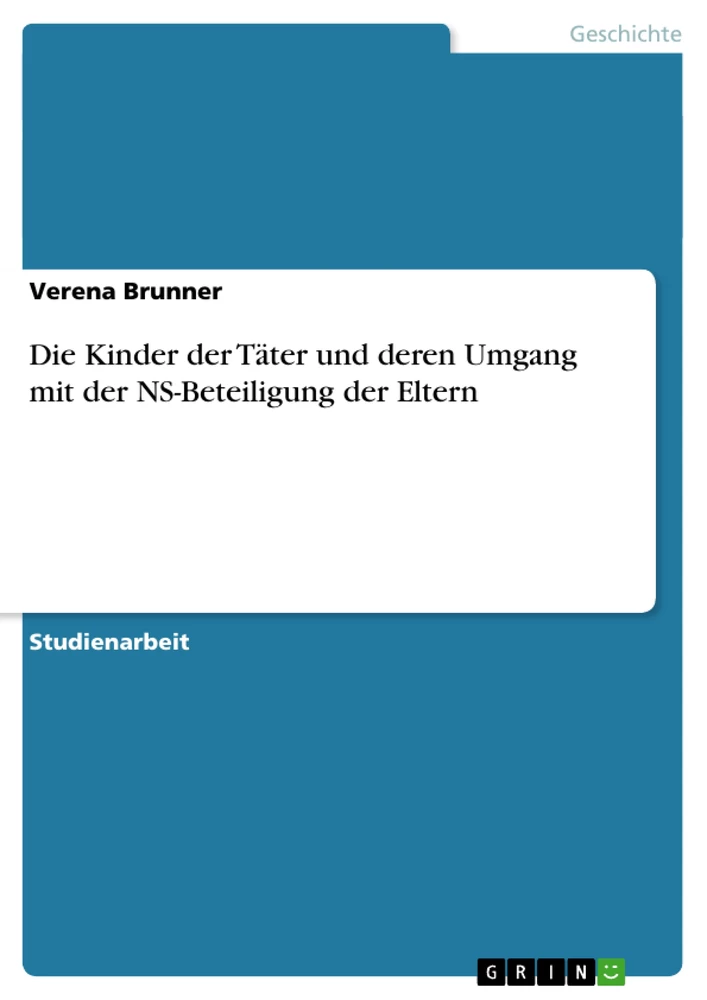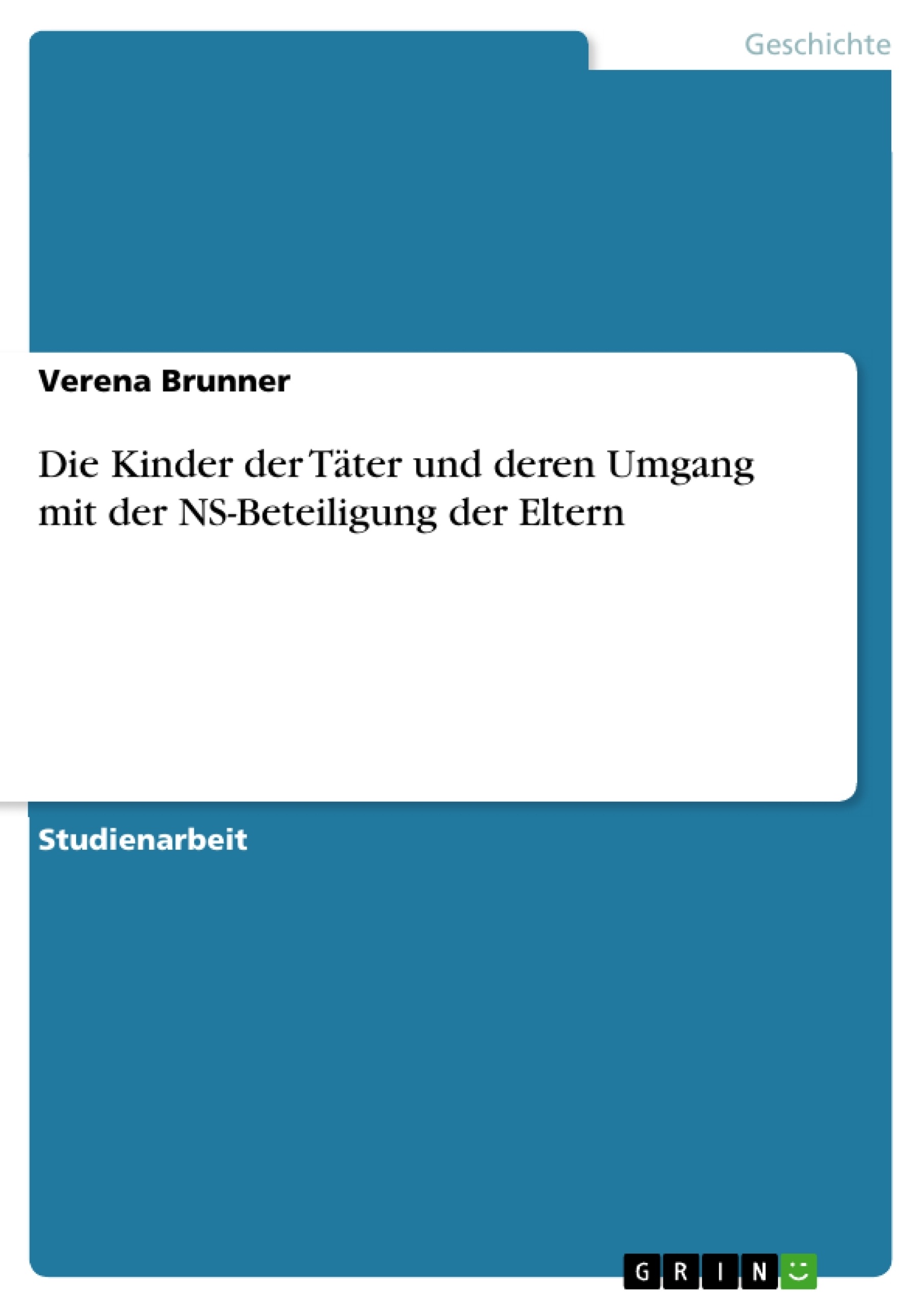Die vorliegende Arbeit untersucht das Verhältnis von Generation und Gedächtnis in Hinblick auf den Nationalsozialismus am Beispiel der zweiten Generation. Im Blickpunkt stehen jene Kinder, deren Eltern im Nationalsozialismus eine eindeutig aktive Rolle als Täter spielten und sich von der Masse der "kleinen Rädchen im Getriebe" abhoben. Gefragt wird nach den unterschiedlichen Umgangsformen der Nachgeborenen mit der NS-Vergangenheit der Eltern. Wesentliche Fragen sind dabei: Welche Identifikationsmöglichkeiten boten sich, fand eine Entidentifizierung mit der Geschichte der Eltern statt bzw. welche Abwehrmechanismen sind in diesem Generationszusammenhang zu finden? Dazu wird anfangs untersucht, wie sich das Leben der Kinder der Täter in der Nachkriegsfamilie darstellte, und vor allem wie in diesen Familien über die NS-Zeit kommuniziert wurde. Anhand biographischer Beispiele werden die unterschiedlichen Rollenbilder analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die 2. Generation
- I.1. Begriffserklärung
- I.2. Die Nachkriegsfamilie
- II. Die Kinder der Täter und deren Umgang mit dem geschichtlichen Erbe
- II.1. Die Integration ambivalenter Väterbilder
- II.2. Rehabilitierung und Rechtfertigung
- II.3. Die anklagende Haltung
- II.3.1. Die Opferidentifikation
- II.3.2. Die Wiederkehr der Verfolgermentalität
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Verhältnis von Generation und Gedächtnis im Kontext des Nationalsozialismus, indem sie sich mit der zweiten Generation auseinandersetzt. Der Fokus liegt auf den Kindern von NS-Tätern, die eine aktive Rolle im NS-Regime spielten und sich von der Masse der „kleinen Rädchen im Getriebe“ abhoben. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Umgangsformen der Nachgeborenen mit der NS-Vergangenheit ihrer Eltern, einschließlich der Identifikationsmöglichkeiten, der Ent-Identifizierung mit der Geschichte der Eltern und der Abwehrmechanismen, die in diesem Generationszusammenhang auftreten.
- Die spezifische Situation der Kinder von NS-Tätern in der Nachkriegsfamilie
- Die Kommunikation über die NS-Zeit innerhalb der Familien
- Die Integration ambivalenter Väterbilder
- Die verschiedenen Reaktionen der Nachgeborenen auf die „Erbschaft der Schuld“
- Die Auswirkungen des „Pakts des Schweigens“ auf die zweite Generation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt das Thema der Arbeit ein und erläutert die Forschungsfrage: Wie gehen die Kinder von NS-Tätern mit der Vergangenheit ihrer Eltern um? Die Arbeit stellt die spezifische Situation der zweiten Generation im Kontext des Nationalsozialismus dar und definiert den Begriff der „zweiten Generation“ im Zusammenhang mit dem Dreigenerationenmodell.
I. Die 2. Generation
I.1. Begriffserklärung
Dieser Abschnitt erläutert den Begriff der „zweiten Generation“ im Kontext des Nationalsozialismus und stellt das Dreigenerationenmodell vor. Er definiert die erste Generation als „Kriegsgeneration“, die aktiv am Nationalsozialismus beteiligt war, und die zweite Generation als deren Kinder, die als „Nachgeborene“ bezeichnet werden.
I.2. Die Nachkriegsfamilie
Dieser Abschnitt untersucht die Situation der Kinder von NS-Tätern in der Nachkriegsfamilie. Er beleuchtet die „Mauer des Schweigens“, die um das Thema Nationalsozialismus aufgebaut wurde, und die Herausforderungen der Nachkriegszeit wie die Existenzsicherung und die Erfahrungsdifferenz zwischen den Geschlechtern. Außerdem wird die Rolle des Kindes als „narzistisches Objekt“ für die innere Konsolidierung der Eltern und die Übertragung der „Erbschaft der Schuld“ auf die Nachgeborenen analysiert.
II. Die Kinder der Täter und deren Umgang mit dem geschichtlichen Erbe
II.1. Die Integration ambivalenter Väterbilder
Dieser Abschnitt untersucht das Problem der Integration ambivalenter Väterbilder bei den Kindern von NS-Tätern. Er beschreibt, wie die Kinder mit der Diskrepanz zwischen der liebenden Vaterfigur und dem Täter in der Vergangenheit umgehen mussten. Die Schwierigkeit, den Vater gleichzeitig als Liebesobjekt und als Täter wahrzunehmen, wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Generation, Gedächtnis, Nationalsozialismus, zweite Generation, Kinder der Täter, Nachkriegsfamilie, Väterbilder, Erbschaft der Schuld, Pakt des Schweigens, Identifikation, Ent-Identifizierung, Abwehrmechanismen.
Häufig gestellte Fragen
Wie gehen Kinder von NS-Tätern mit der Schuld ihrer Eltern um?
Die Umgangsformen reichen von der Rechtfertigung und Rehabilitierung bis hin zur anklagenden Haltung und Opferidentifikation.
Was ist der „Pakt des Schweigens“ in Nachkriegsfamilien?
Es beschreibt die Mauer des Schweigens über die NS-Vergangenheit, die in vielen Täterfamilien errichtet wurde, um die eigene Beteiligung zu verdrängen.
Warum ist die Integration des Väterbildes für die Kinder schwierig?
Es besteht eine enorme Diskrepanz zwischen dem erlebten „liebenden Vater“ und dem Wissen über dessen aktive Rolle als NS-Täter.
Was versteht man unter „Erbschaft der Schuld“?
Es bezeichnet die psychische Last, die die zweite Generation trägt, indem sie unbewusst die ungesühnte Schuld oder das Trauma der Eltern übernimmt.
Welche Abwehrmechanismen zeigen die Nachgeborenen?
Häufige Mechanismen sind Verleugnung der Taten, Bagatellisierung der elterlichen Rolle oder die Externalisierung der Schuld auf „höhere Befehle“.
- Quote paper
- Mag.phil. Verena Brunner (Author), 2001, Die Kinder der Täter und deren Umgang mit der NS-Beteiligung der Eltern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12375