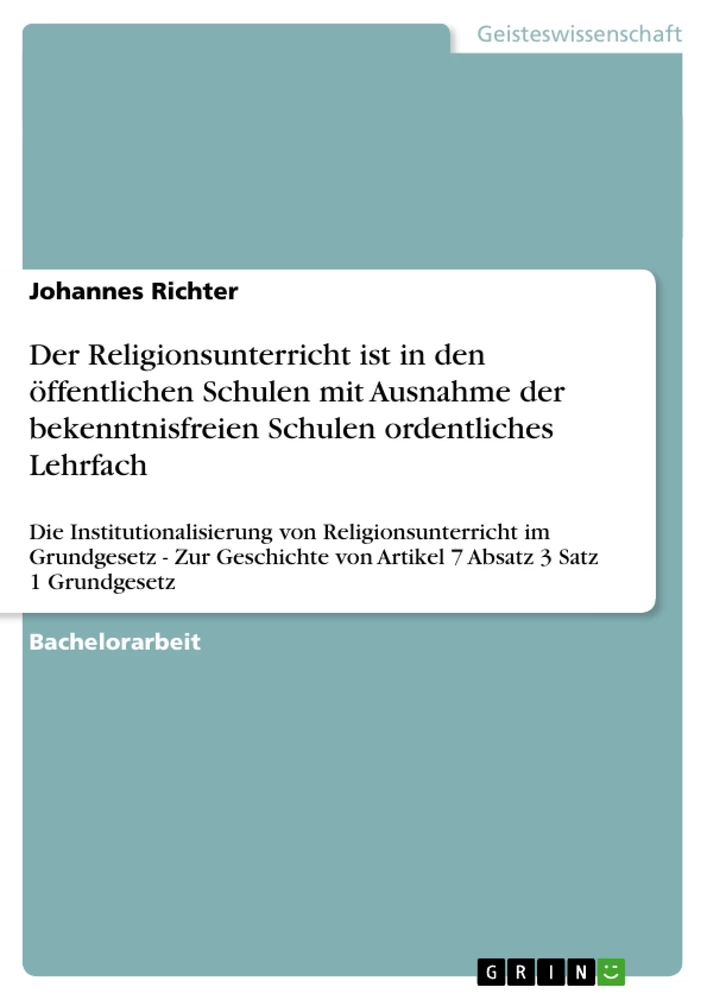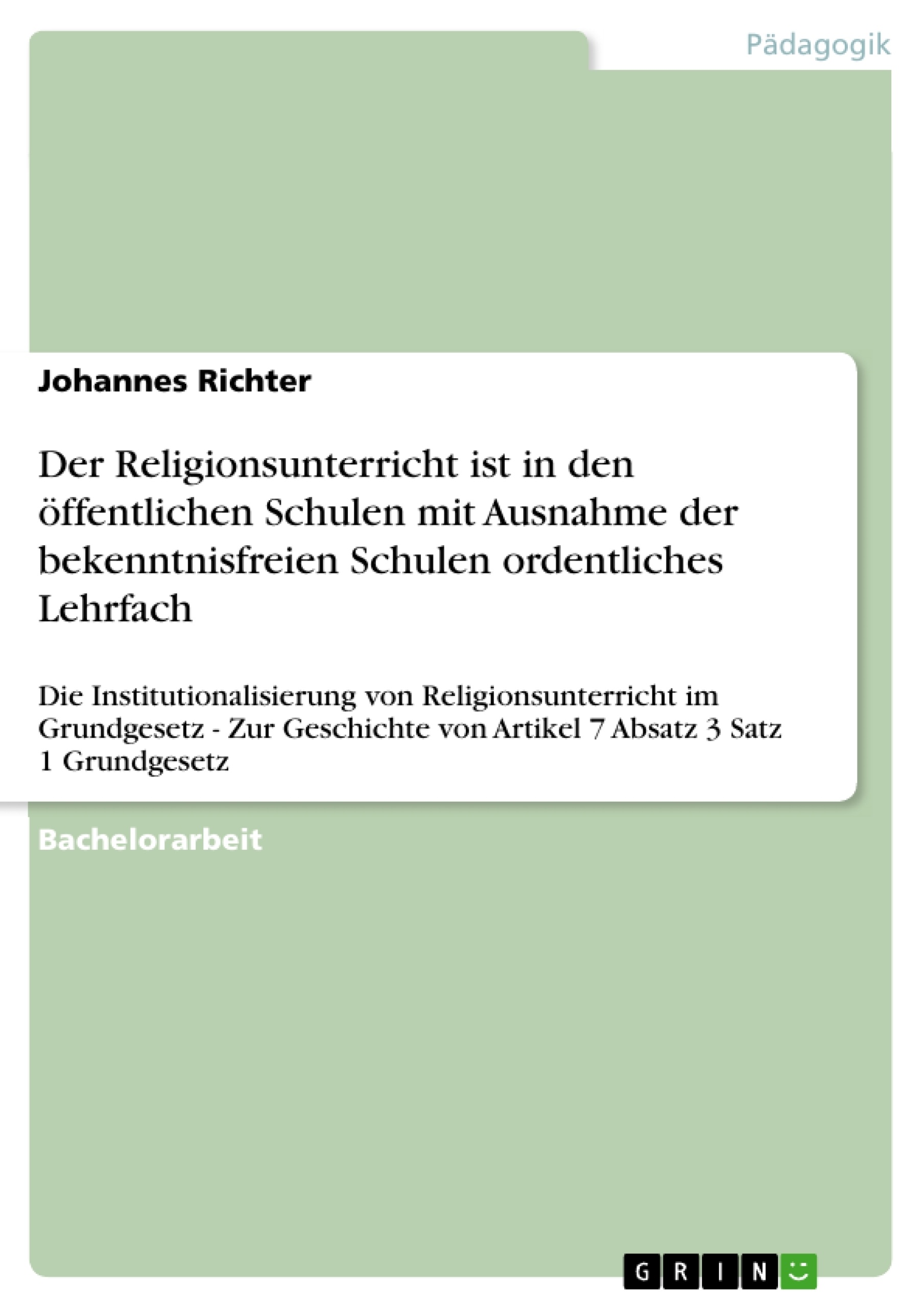„Ein Vorhaben, daß sich nach dem herkömmlichen Verständnis der Staatsräson zum Widerspruch zum nationalen Interesse der Deutschen befand, konnte Aussicht auf Realisierung nur dann haben, wenn hierüber – über alle divergierenden Interessen und politischen Zielvorstellungen hinweg – ein breiter Konsensus zwischen den maßgeblichen politischen Kräften bestand oder hergestellt werden konnte.“ – Das Vorhaben, welches Sörgel hier beschreibt, ist die Schaffung des Grundgesetzes für die sich im Begriff zu gründende Bundesrepublik Deutschland. Ein spannender Prozess mit vielen Hürden. Eine davon war die Institutionalisierung des Religionsunterrichts in öffentlichen Schulen.
„Art. 7 Abs. 3 garantiert den Religionsunterricht zunächst als institutionelle Gewährleistung. Er ist die einzige Norm des Grundgesetzes, die ein bestimmtes Unterrichtsfach an den Schulen verbindlich vorschreibt. Dadurch wird der Religionsunterricht gegenüber anderen Fächern zwar nicht besonders privilegiert, jedoch hervorgehoben und gesichert.“ – Mit diesen Worten beschreibt Starck in den Kommentaren zum Grundgesetz die Besonderheit dieses Artikels. Es ist das einzige Lehrfach, welches vom Grundgesetz garantiert wird.
„Es stünde nichts im Wege, daß man die Jugend, falls die Eltern so wollen, in derselben Schule Religion lehrte, wo man sie über alle Dinge belehrt.“ – stellte John Stuart Mill, der liberale Staatsphilosoph, in seinem Essay „Über die Freiheit“ fest. Doch welche Gründe existierten für die Einführung von Religionsunterricht im schulischen Bereich? Immerhin widerspricht dies der traditionellen Trennung von Kirche und Staat.
„So wäre dieses Verfassungswerk [...] beinah an der für das Gesamtwerk an sich nebensächlichen Frage des Schulwesens gescheitert.“ – beschreibt Deuschle zusammenfassend die Diskussion um den Religionsunterricht. Demnach war es eine kontroverse Entscheidung, um die im Parlamentarischen Rat gerungen wurde.
Die vorangegangenen vier Zitate zeigen die Spannweite, welche der Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz beinhaltet. Als Artikel des neu auszuarbeitenden Grundgesetzes stellt er eine Einzigartigkeit dar und die Diskussion darum hätte beinah das ganze Grundgesetz scheitern lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen
- 3. Vom Elternrecht zum Religionsunterricht
- 3.1. Die Verbindung von Elternrecht und Religionsunterricht
- 3.2. Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee
- 3.3. Wissenswertes und Relevantes zum Aufbau und Funktion des Parlamentarischen Rates
- 3.4. Die beteiligten Akteure
- 3.4.1. Die Fraktionen
- 3.4.1.1. Die CDU/CSU Fraktion
- 3.4.1.2. Die FDP Fraktion
- 3.4.1.3. Die SPD Fraktion
- 3.4.1.4. Die Fraktionen von DP, KPD und Zentrum
- 3.4.2. Die Kirchen
- 3.4.2.1. Die Kirchen im Allgemeinen
- 3.4.2.2. Die Römisch Katholische Kirche
- 3.4.2.3. Die Evangelische Kirche
- 3.4.3. Die Öffentlichkeit
- 3.4.4. Die Besatzungsmächte
- 3.4.1. Die Fraktionen
- 3.5. Der Verlauf der Debatte und die darin verwendeten Argumente
- 3.5.1. Die Abkopplung des Religionsunterrichts vom Elternrecht
- 3.5.1.1. Forderungen der Kirchen
- 3.5.1.2. Fraktionsgespräche der Unionsparteien
- 3.5.1.3. Ausschuss für Grundsatzfragen
- 3.5.1.4. Hauptausschuss
- 3.5.2. Probleme bis zur endgültigen Annahme des Art. 7 Abs. 3 Satz 1
- 3.5.2.1. Die Formulierung
- 3.5.2.2. Das Föderalproblem
- 3.5.2.3. Das Alliiertenmemorandum
- 3.5.2.4. Die endgültige Annahme des Artikels
- 3.5.3. Fazit der einzelnen Akteure
- 3.5.4. Auswertung der Argumente
- 3.5.1. Die Abkopplung des Religionsunterrichts vom Elternrecht
- 4. Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Institutionalisierung des Religionsunterrichts im Grundgesetz, speziell Artikel 7 Absatz 3 Satz 1. Sie analysiert die Debatten im Parlamentarischen Rat (1948-1949) und konzentriert sich auf die beteiligten Akteure und deren Argumentationen. Das Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Argumenten zu identifizieren und zu analysieren, ob das heutige Ergebnis ein Kompromiss oder Konsens darstellt.
- Die Rolle der verschiedenen Akteure (Kirchen, Parteien, Besatzungsmächte) in der Debatte
- Die verwendeten Argumentationsstrategien (funktionalistisch, genetisch, historisch, wirtschaftlich)
- Der Prozess der Abkopplung des Religionsunterrichts vom Elternrecht
- Die Herausforderungen bei der Formulierung und Verabschiedung des Artikels
- Die Bedeutung des Artikels 141 GG (Bremer Klausel)
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung, die die Bedeutung von Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes hervorhebt. Kapitel 2 beschreibt den Aufbau und die Methodik der Arbeit, inklusive der verwendeten Argumentationskategorien. Kapitel 3 analysiert die Debatte um den Religionsunterricht, beginnend mit der Verbindung zum Elternrecht und dem Herrenchiemsee-Konvent. Es beleuchtet die Positionen und Argumentationen der verschiedenen Akteure (Fraktionen, Kirchen, Öffentlichkeit, Besatzungsmächte) bis zur endgültigen Formulierung des Artikels. Die Kapitel 3.1 - 3.4 untersuchen die jeweiligen Beteiligten, während Kapitel 3.5 den Verlauf der Debatte im Detail darstellt.
Schlüsselwörter
Grundgesetz, Artikel 7 Absatz 3 Satz 1, Religionsunterricht, Parlamentarischer Rat, Elternrecht, Kirchen, CDU/CSU, SPD, FDP, funktionalistische Argumentation, historische Argumentation, genetische Argumentation, föderale Struktur, Alliiertenmemorandum, Bremer Klausel, Kompromiss, Konsens.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Religionsunterricht im Grundgesetz verankert?
Art. 7 Abs. 3 GG garantiert Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach, was auf einen breiten politischen Konsens im Parlamentarischen Rat zurückgeht, um das Elternrecht und die religiöse Freiheit zu sichern.
Was ist die „Bremer Klausel“ (Art. 141 GG)?
Sie besagt, dass Art. 7 Abs. 3 keine Anwendung in Ländern findet, in denen am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand (insbesondere Bremen).
Welche Rolle spielten die Kirchen bei der Verfassungsgebung?
Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche übten starken Einfluss auf den Parlamentarischen Rat aus, um den Religionsunterricht institutionell abzusichern.
War der Religionsunterricht im Parlamentarischen Rat umstritten?
Ja, die Diskussion war so kontrovers, dass das gesamte Grundgesetz beinahe an der Schulfrage gescheitert wäre, insbesondere wegen Differenzen zwischen CDU/CSU, SPD und FDP.
Wie wird Religionsunterricht rechtlich definiert?
Er ist ordentliches Lehrfach in öffentlichen Schulen (außer bekenntnisfreien Schulen) und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.
- Quote paper
- Johannes Richter (Author), 2009, Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123797