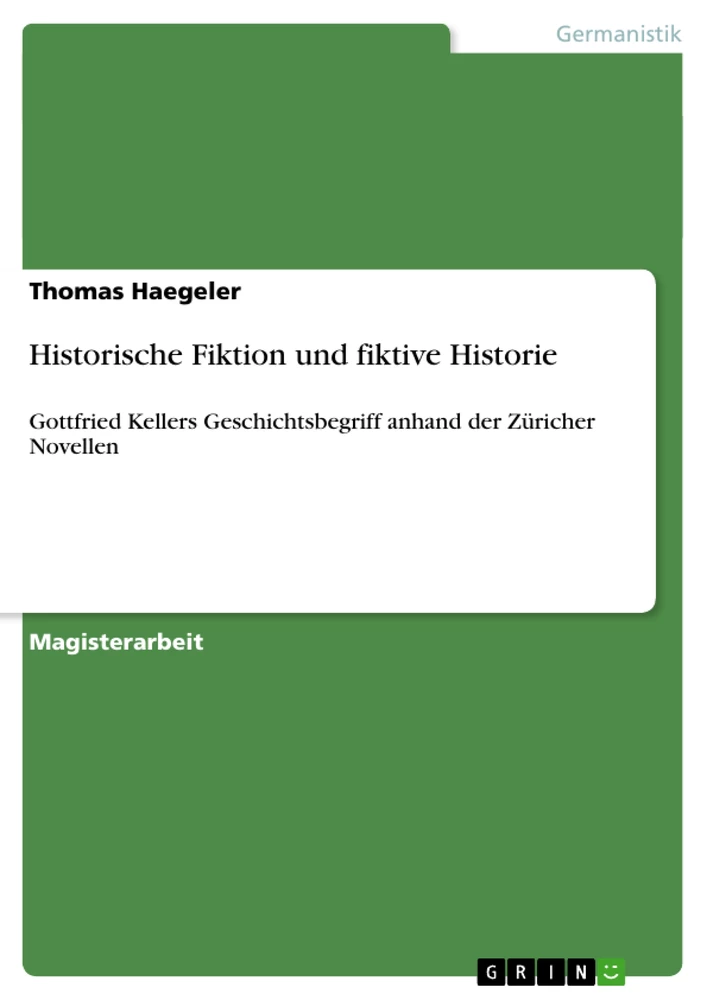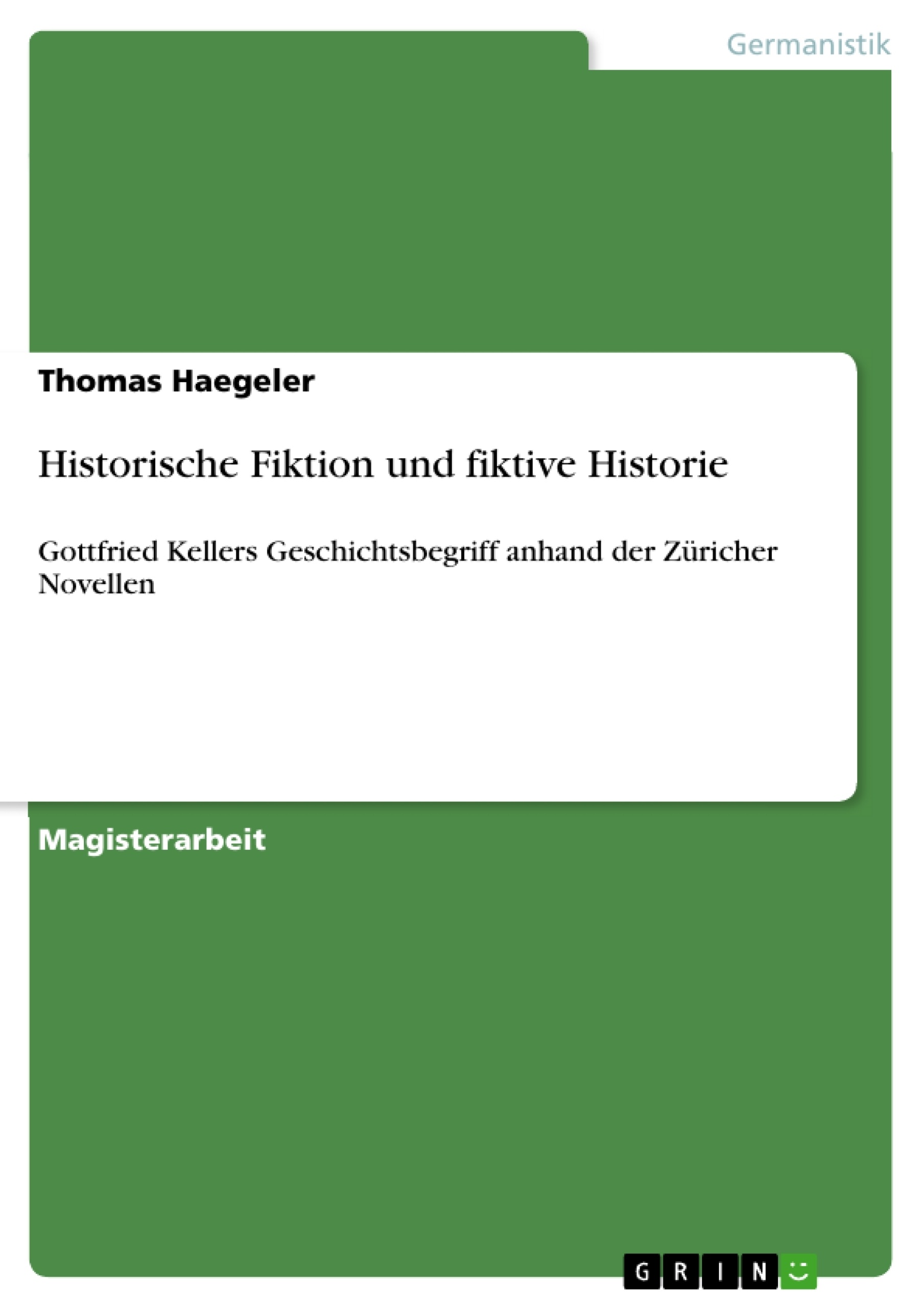In Bezug auf die Verarbeitung geschichtlicher Themen und Stoffe in der Literatur gilt das 19. Jahrhundert als Blütezeit. Seit Walter Scotts Roman Waverley (1814) kam es zu einer ganzen Flut von historischen Erzählungen und Romanen, so dass Geschichte als Leitmotiv in der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts anzusehen ist. Dieser Dynamik konnte sich auch Gottfried Keller, eine der Leitfiguren des literarischen Realismus, nicht entziehen. Auf dem Höhepunkt des gründerzeitlichen Historismus erscheint Ende 1877 sein einziger expliziter Beitrag zur historischen Dichtung in Form der Züricher Novellen. Zieht man hinzu, dass Geschichtsforschung und das damit in Verbindung stehende Fortschreiben der Geschichte hauptsächlich deshalb betrieben werden, damit der Mensch seine eigene Gegenwart besser verstehen und erklären lernt, so lässt sich die immense Bedeutung der Geschichte für die Menschen im Allgemeinen, wie für die Dichter im Speziellen bereits erahnen. Dadurch wird nicht nur eine bestimmte Funktion, die Geschichte in Dichtung erfüllt bzw. erfüllen kann, impliziert, sondern auch ein damit einhergehendes Verständnis von und Verhältnis zu Geschichte, was sich unter einem dem entsprechenden Geschichtsbegriff subsumieren lässt.
Mit diesen Gedanken ist der Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung umrissen. Da es in dieser Arbeit um die Rekonstruktion von Kellers Geschichtsbegriff geht, er selbst eine historische Person ist und auch der Untersuchungsgegenstand, die Züricher Novellen, Produkte einer längst vergangenen Zeit sind, kann dies nicht unter Ausblendung des historischen Kontextes des Autors sowie der Entstehungszeit der Erzählungen bzw. der dafür maßgeblichen historischen Bedingungen geschehen. Im Anschluss daran soll eine Analyse des Novellenzyklus’ zeigen, worauf sich Kellers Geschichtsinteresse konzentriert, wie die entsprechenden Bilder aus der Geschichte vermittelt werden und welche Anliegen sich damit bei ihm verbinden. Kurz, es geht um Intention, Erscheinungsbild und Poetik seines historischen Erzählens. Zum Abschluss der Arbeit werden die Analyseergebnisse dann auf ihre Konsequenzen hinsichtlich des Kellerschen Geschichtsbegriffes befragt und dieser rekonstruiert und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Die Hochphase der historischen Literatur im 19. Jahrhundert – eine Einleitung
- Die Wirklichkeit“ des „literarischen Realisten“ Keller - Eine Darstellung der historischen Situation im 19. Jahrhundert
- Strukturwandel auf ganzer Linie zur politischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung in der Schweiz des 19. Jahrhunderts
- Das Feuerbacherlebnis – Philosophisch-weltanschauliche Tendenzen und ihre Wirkung auf Keller
- Die Bedeutung von Kellers Sozialisation und Weltanschauung für eine Rekonstruktion seines Geschichtsbegriffes – einige Arbeitshypothesen
- Historische Fiktion und fiktive Historie – Analogien und Differenzen der Züricher Novellen hinsichtlich der Geschichtskonzeption
- Die problematische Entstehung der Züricher Novellen
- Die strukturellen Besonderheiten der Novellensammlung
- Herr Jacques oder der multifunktionale Rahmen
- Hadlaub und der Beginn der bürgerlichen Gesellschaft
- Die erste bürgerliche Blütezeit - Der Narr auf Manegg
- Individuelle Bewältigung geschichtlicher Veränderung – Der Landvogt von Greifensee
- Versöhnung von Generationen durch nationale Festtradition: Das Fähnlein der sieben Aufrechten
- Ursula - der neuralgische Punkt
- Grundlagen und Bestandteile des Geschichtsbegriffes
- Die Akzentuierung des Privaten gegenüber der Öffentlichkeit
- Die zerstörerische Grundlage der Geschichte
- Die Inszenierung von Dauerhaftigkeit
- Wiederkehrende Generationskonflikte und deren Versöhnung als Zeichen des Reformationsprinzips
- Gesegnetes Fleckchen Erde oder der Glaube an eine natürliche Ordnung der Geschichte
- Rekonstruktion und Diskussion des Kellerschen Geschichtsbegriffes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit rekonstruiert Gottfried Kellers Geschichtsbegriff anhand seiner Züricher Novellen. Die Arbeit untersucht den historischen Kontext von Kellers Leben und Werk und analysiert, wie sich sein Geschichtsverständnis in seinen Erzählungen manifestiert. Dabei wird besonders auf die Darstellung von Geschichte, die Beziehung zwischen Individuum und Geschichte sowie Kellers Intentionen eingegangen.
- Kellers Geschichtsverständnis im Kontext des 19. Jahrhunderts
- Die Darstellung von Geschichte in den Züricher Novellen
- Das Verhältnis von Individuum und Geschichte bei Keller
- Die Rolle des Privaten und Öffentlichen in Kellers Geschichtsbild
- Generationskonflikte und deren Bewältigung in den Novellen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Dieses Kapitel beleuchtet die Hochphase der historischen Literatur im 19. Jahrhundert und positioniert Gottfried Keller und seine Züricher Novellen innerhalb dieses Kontextes. Es thematisiert die Bedeutung von Scotts Waverley und den Einfluss des Historismus.
Kapitel 2: Dieses Kapitel beschreibt den historischen und gesellschaftlichen Kontext, in dem Keller lebte und schrieb, inklusive der politischen, ökonomischen und sozialen Entwicklungen in der Schweiz. Es befasst sich mit Kellers Biografie und Weltanschauung.
Kapitel 3: Dieses Kapitel analysiert die Züricher Novellen im Hinblick auf Kellers Geschichtsverständnis. Es untersucht die einzelnen Novellen, ihre Struktur und ihre jeweiligen Bezüge zu historischen Ereignissen und Entwicklungen. Der Fokus liegt auf den Hauptthemen und Erzählstrukturen.
Schlüsselwörter
Gottfried Keller, Züricher Novellen, Historische Fiktion, Fiktive Historie, Geschichtsbegriff, 19. Jahrhundert, Realismus, Historismus, Schweiz, Individuum und Geschichte, Generationskonflikt, Soziale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gottfried Kellers Geschichtsbegriff?
Kellers Geschichtsbegriff ist geprägt durch die Verbindung von Privatem und Öffentlichem sowie dem Wunsch, die eigene Gegenwart durch historische Bilder besser zu verstehen.
Welche Bedeutung haben die "Züricher Novellen"?
Sie sind Kellers einziger expliziter Beitrag zur historischen Dichtung und reflektieren die gesellschaftliche Entwicklung der Schweiz über verschiedene Epochen.
Wie beeinflusste Ludwig Feuerbach Gottfried Keller?
Das "Feuerbacherlebnis" prägte Kellers philosophisch-weltanschauliche Ausrichtung hin zu einem literarischen Realismus, der die Wirklichkeit ohne religiöse Verklärung betrachtet.
Was thematisiert die Novelle "Hadlaub"?
Sie behandelt den Beginn der bürgerlichen Gesellschaft und zeigt Kellers Interesse an der Entstehung kultureller Identität.
Warum sind Generationskonflikte in Kellers Werk zentral?
Sie dienen als Zeichen des Reformationsprinzips und zeigen die ständige Erneuerung der Gesellschaft durch die Versöhnung zwischen Alt und Jung.
- Quote paper
- Thomas Haegeler (Author), 2006, Historische Fiktion und fiktive Historie , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123829