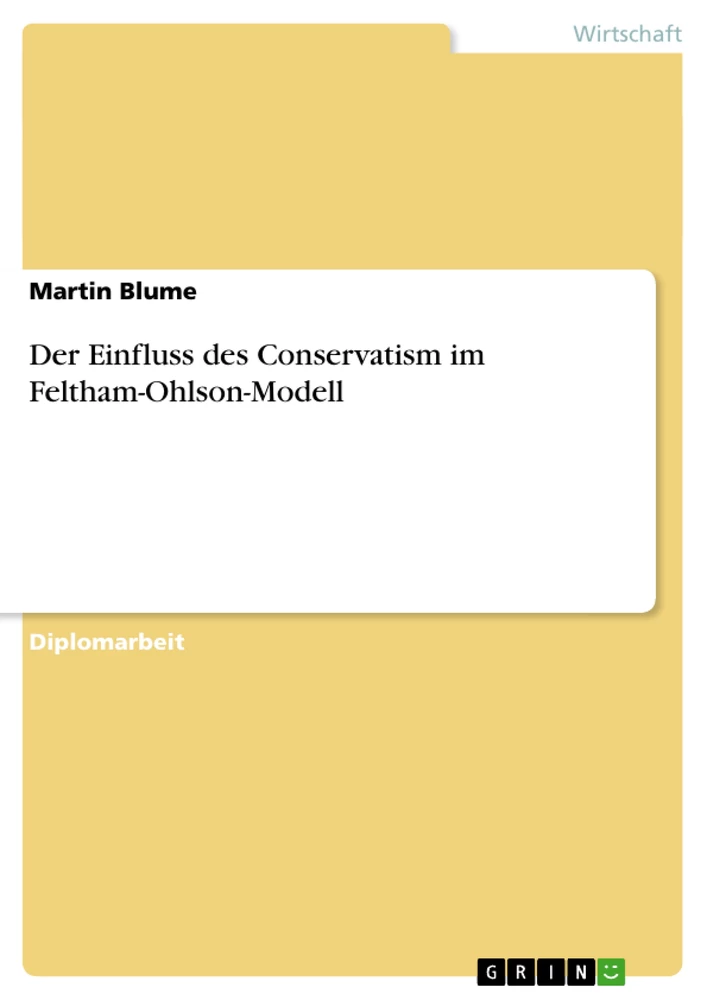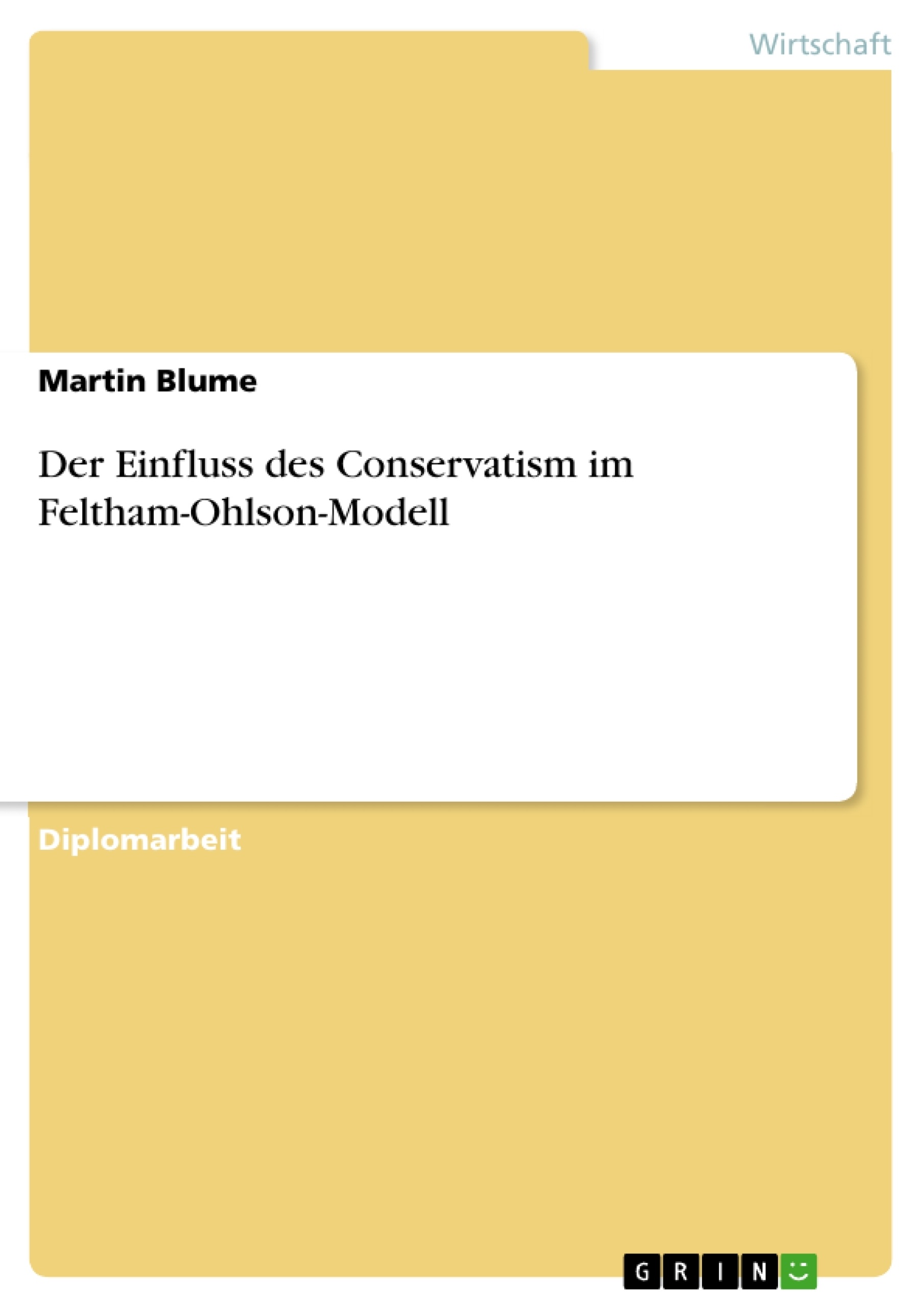[…]
In dieser Arbeit sollen die folgenden Fragestellungen untersucht werden: Warum wird konservative Rechnungslegung betrieben? Welchen Einfluss hat das Vorsichtsprinzip auf die Größen des Jahresabschlusses? Wie stellt das grundlegende Ohlson-Modell eine Beziehung zwischen Rechnungslegungsdaten und dem Marktwert des Eigenkapitals her? Wie wird eine durch den Conservatism ausgelöste Veränderung dieser Daten in den Feltham-Ohlson-Modellen berücksichtigt? Wie gut können die drei genannten Modelle den tatsächlichen Marktwert abbilden?
Um diese Fragen zu beantworten, ist die Arbeit wie folgt gegliedert: An diese einführende Problemstellung schließt sich Kapitel 2 an, in dem das Konzept des Conservatism näher beleuchtet werden soll. Dabei stehen sowohl die Motive einer konservativen Rechnungslegung als auch deren Auswirkungen auf die Jahresabschlussdaten im Blickpunkt. In Kapitel 3 werden die Prämissen und die Herleitung der Modelle von Ohlson und Feltham/Ohlson ausführlich vorgestellt, kritisch hinterfragt sowie wesentliche Unterschiede zwischen den Modellen herausgearbeitet. Kapitel 4 thematisiert anschließend empirische Umsetzungen der Modelle, die dabei auftretenden Probleme und Ergebnisse der entsprechenden Studien. Ein kritisches Fazit schließt diese Arbeit in Kapitel 5 ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Das Konzept des Conservatism in der externen Rechnungslegung
- 2.1 Motive konservativer Rechnungslegung
- 2.1.1 Ein Exkurs: Der Prinzipal-Agenten-Ansatz
- 2.1.2 Das Kontraktmotiv in Bezug auf Managemententlohnungsverträge
- 2.1.3 Das Kontraktmotiv in Bezug auf Kreditverträge
- 2.1.4 Das Rechtsstreitmotiv
- 2.1.5 Das Steuerbemessungsmotiv
- 2.1.6 Das Regierungsinterventionsmotiv
- 2.1.7 Das Motiv der Standardsetter
- 2.1.8 Zwischenfazit zu den Motiven
- 2.2 Ausprägungen konservativer Rechnungslegung
- 2.2.1 Ex ante Conservatism
- 2.2.2 Ex post Conservatism
- 2.2.3 Zwischenfazit zu den Ausprägungen konservativer Rechnungslegung
- 2.3 Zwischenfazit zum Conservatism
- 2.1 Motive konservativer Rechnungslegung
- 3. Die Modelle von Ohlson (1995) und Feltham-Ohlson (1995/1996)
- 3.1 Bedeutung der Modelle
- 3.2 Das Ohlson-Modell 1995
- 3.2.1 Das Residualgewinnmodell: Bewertung mit zukünftigen Rechnungslegungsdaten
- 3.2.2 Das lineare Informationsmodell: Bewertung mit aktuellen Rechnungslegungsdaten
- 3.2.3 Zwischenfazit zum Ohlson-Modell 1995
- 3.3 Das Feltham-Ohlson-Modell 1995
- 3.3.1 Das operative Residualgewinnmodell
- 3.3.2 Berücksichtigung von Conservatism und Wachstum im linearen Informationsmodell
- 3.3.3 Zwischenfazit zum Feltham-Ohlson-Modell 1995
- 3.4 Das Feltham-Ohlson-Modell 1996
- 3.4.1 Bewertung mit aktuellen Kapitalflussgrößen
- 3.4.2 Abschreibungspolitik und positive Kapitalwerte
- 3.4.3 Sonstige Informationen und ereignisabhängige Abschreibungen
- 3.4.4 Zwischenfazit zum Feltham-Ohlson-Modell 1996
- 3.5 Zwischenfazit zu den Ohlson- und Feltham-Ohlson-Modellen
- 4. Empirische Untersuchungen der Modelle
- 4.1 Ein erster Praxistest der Modelle
- 4.2 Analystenprognosen als sonstige Informationen
- 4.3 Informationsineffizienz als mögliche Fehlerquelle
- 4.4 Modifikation der Modellierung des Conservatism
- 4.5 Zwischenfazit zu den empirischen Untersuchungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einfluss des Conservatism im Feltham-Ohlson-Modell. Ziel ist es, die Bedeutung und Ausprägungen von Conservatism in der externen Rechnungslegung zu beleuchten und dessen Auswirkungen auf die Bewertung von Unternehmen im Rahmen der genannten Modelle zu analysieren.
- Das Konzept des Conservatism in der externen Rechnungslegung
- Die Modelle von Ohlson (1995) und Feltham-Ohlson (1995/1996)
- Motive und Ausprägungen konservativer Rechnungslegung
- Empirische Untersuchungen der Modelle
- Bewertung von Unternehmen unter Berücksichtigung von Conservatism
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein. Kapitel 2 beleuchtet das Konzept des Conservatism, seine Motive (z.B. Prinzipal-Agenten-Problematik, Vertragsgestaltung) und Ausprägungen (ex ante und ex post). Kapitel 3 beschreibt detailliert die Modelle von Ohlson (1995) und Feltham-Ohlson (1995/1996), inklusive der Berücksichtigung von Conservatism und Wachstum. Kapitel 4 präsentiert empirische Untersuchungen zu den Modellen und möglichen Fehlerquellen.
Schlüsselwörter
Conservatism, Feltham-Ohlson-Modell, Ohlson-Modell, externe Rechnungslegung, Unternehmensbewertung, Prinzipal-Agenten-Problem, empirische Untersuchung, Informationsineffizienz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept des Conservatism in der Rechnungslegung?
Conservatism (Vorsichtsprinzip) bedeutet, dass Gewinne erst ausgewiesen werden, wenn sie realisiert sind, während Verluste bereits bei ihrem Bekanntwerden berücksichtigt werden müssen. Dies beeinflusst die Bilanzwerte maßgeblich.
Welche Rolle spielt das Feltham-Ohlson-Modell bei der Unternehmensbewertung?
Das Modell stellt eine Beziehung zwischen Rechnungslegungsdaten und dem Marktwert des Eigenkapitals her. Es erweitert das grundlegende Ohlson-Modell, indem es den Einfluss von Wachstum und konservativer Rechnungslegung explizit berücksichtigt.
Was sind Motive für eine konservative Rechnungslegung?
Wichtige Motive sind die Lösung von Prinzipal-Agenten-Problemen, die Gestaltung von Kreditverträgen zur Sicherung von Gläubigerinteressen, Steuervermeidung sowie die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.
Was ist der Unterschied zwischen ex ante und ex post Conservatism?
Ex ante Conservatism bezieht sich auf die Wahl vorsichtiger Bewertungsmethoden von Beginn an, während ex post Conservatism die asymmetrische Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten bei späteren Ereignissen beschreibt.
Wie genau können diese Modelle den tatsächlichen Marktwert abbilden?
Empirische Studien zeigen, dass die Berücksichtigung von Conservatism die Prognosegenauigkeit verbessert, jedoch Informationsineffizienzen am Markt die Ergebnisse verzerren können.
- Citation du texte
- Dipl.-Kfm. Martin Blume (Auteur), 2008, Der Einfluss des Conservatism im Feltham-Ohlson-Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123846