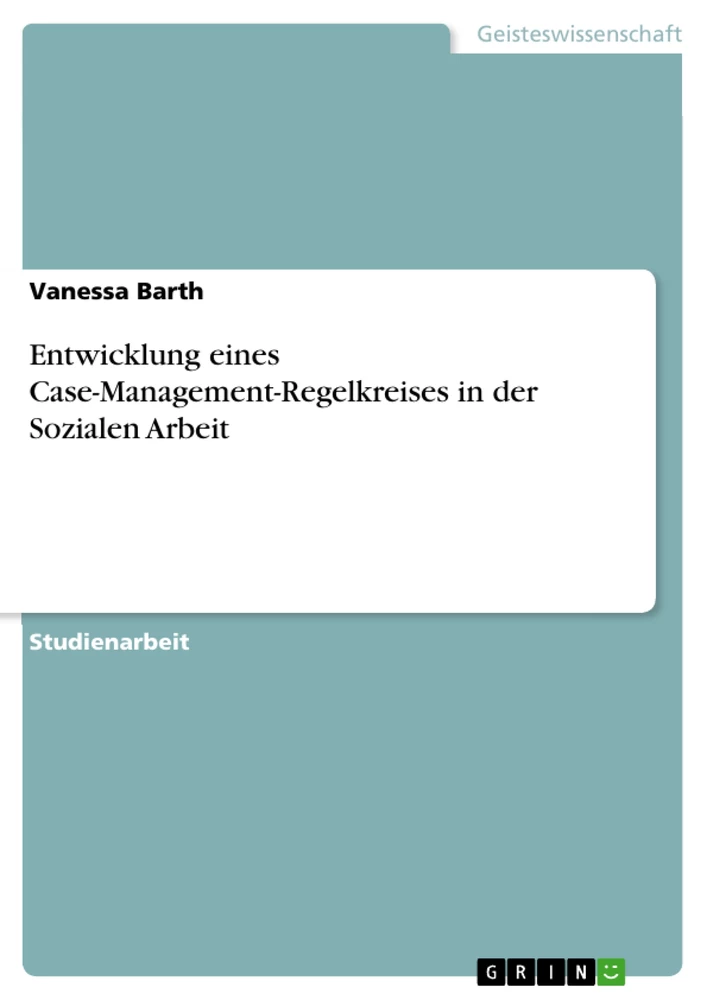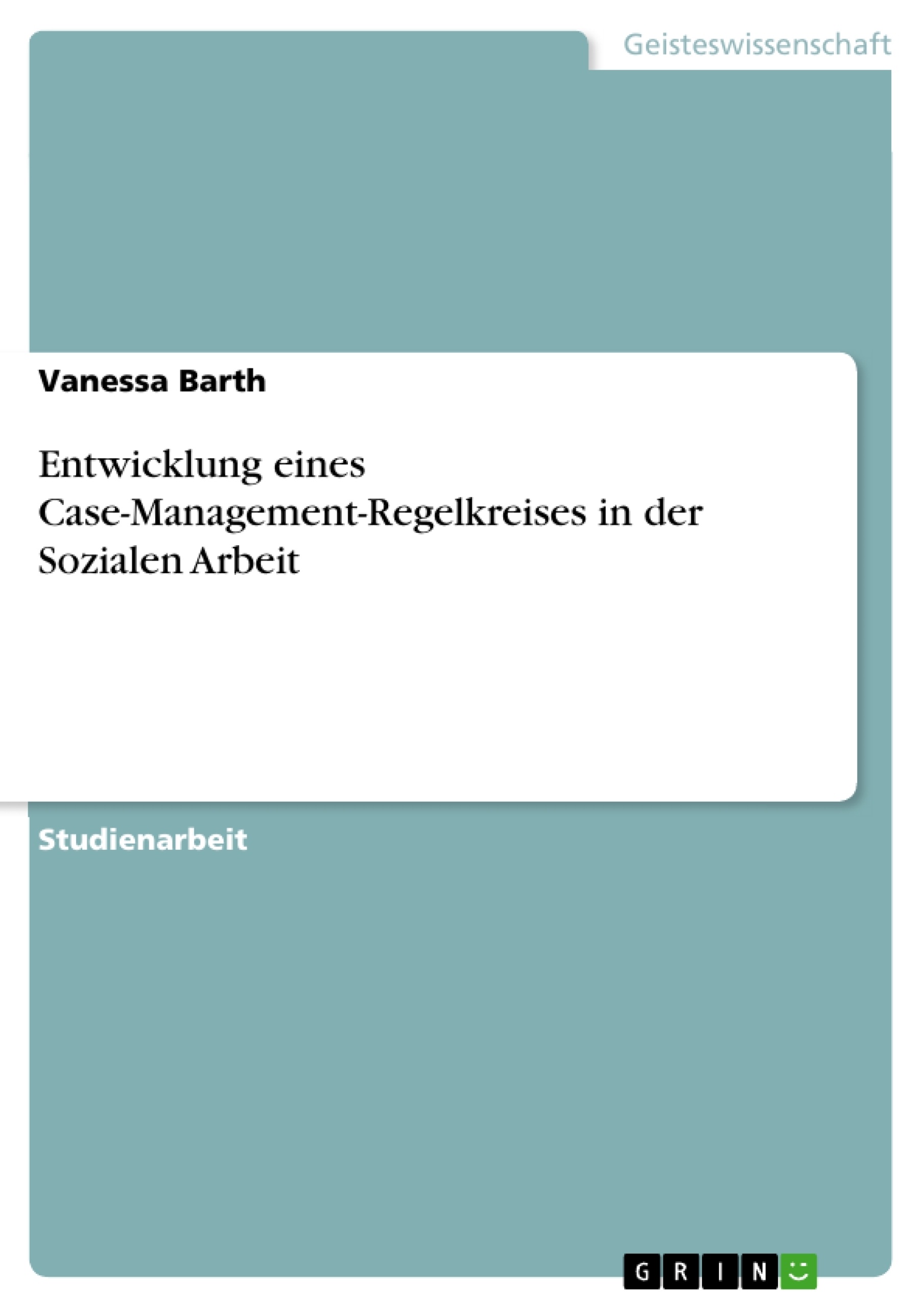Das Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist, das Konzept des Case Managements für die Soziale Arbeit näher zu beleuchten und speziell die sechs Phasen bzw. den gleichwertigen Regelkreis für diesen Bereich zu erfassen. Im Praxistransfer wird abschließend die hohe Relevanz für eine Entwicklung und Anwendung des Regelkreises anhand eines dargestellten Beispiels aus der Sozialen Arbeit aufgezeigt.
Case Management (Case Management = CM) tritt vermehrt in die Kritik, ein inhaltsleeres Konzept und nur eine Art Modeerscheinung darzustellen. Doch das seit den 1990er-Jahren in der deutschen Sozialarbeit rezipierte Case Management ist heute nicht nur in der Sozialen Arbeit gefragter denn je. Zudem wird kritisiert, dass CM mittlerweile ausschließlich zur Kostenoptimierung betrieben wird und aufgrund dessen keine Rücksicht mehr auf Wünsche
und Bedürfnisse der KlientInnen gelegt werden kann. Abläufe optimieren und Kosten sparen wird zugleich als eines der Hauptziele von Mitarbeitenden aus dem Sozial- und Gesundheitswesen genannt und auch die Mitgliederzahlen der SozialarbeiterInnen, die sich für den CM-Bereich noch aus- und weiterbilden lassen, sinken. Doch Fakt ist, dass eine große Anzahl an Menschen, die verstrickte Mehrfachbelastungen und Problematiken mit sich tragen, geballt auf Bereiche des Gesundheits- und Sozialsektors treffen und bislang von einer Einrichtung und Hilfeform in die Nächste weitergeschoben werden. Meist hatten diese Hilfen jedoch wenig Aussicht auf Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen.
Es stellt sich deshalb vermehrt die Frage, ob Case Management schon längst seinen Bezug und die Akzeptanz zur Sozialen Arbeit verloren hat und welche positiven Aspekte aufgezeigt werden können, wenn die Implementierung eines Regelkreises stattfindet. Zugleich soll die Seminararbeit kritischen Stimmen entgegenwirken und positive Auswirkungen für den sozialen Bereich in den Vordergrund stellen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einführung in das Case Management
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Methodik
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Entstehung
- 2.2 Begriffsdefinition
- 3. Der Regelkreis/ Phasen des Case Managements
- 4. Case Management in der Sozialen Arbeit
- 5. Praxistransfer
- 5.1 Fallsituation
- 5.2 Anwendung der Fallsituation
- 6. Fazit und Schlussfolgerungen für Professionelle in der Sozialen Arbeit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept des Case Managements in der Sozialen Arbeit, insbesondere mit dem Regelkreis und seinen sechs Phasen. Ziel ist es, die Relevanz des Regelkreises für die Entwicklung und Anwendung des Case Managements in der Sozialen Arbeit zu verdeutlichen.
- Die Kritik am Case Management als inhaltsleerem Konzept und Modeerscheinung
- Die Bedeutung von Case Management in der Sozialen Arbeit trotz Kritik an der Kostenoptimierung
- Die Herausforderungen, denen sich Mehrfachbelastete im Gesundheits- und Sozialwesen gegenübersehen
- Die Entwicklung des Case Managements als ganzheitliches Konzept, das das System und das Netzwerk des Betroffenen miteinbezieht
- Die Relevanz des Case Managements angesichts komplexer Lebenssituationen und gesteigertem Bedarf an Hilfestellungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einführung in das Case Management behandelt die Kritik am Konzept als inhaltsleer und als Modeerscheinung. Es wird betont, dass Case Management trotz dieser Kritik in der Sozialen Arbeit gefragter denn je ist.
- Kapitel 2: Der theoretische Hintergrund beleuchtet die Entstehung des Case Managements in den USA und seine spätere Verbreitung im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen. Es wird auf die Problematik von Mehrfachbelastungen eingegangen, die Menschen in die Notwendigkeit von Unterstützung von außen bringt.
- Kapitel 3: Dieser Abschnitt widmet sich dem Regelkreis und den einzelnen Phasen des Case Managements.
- Kapitel 4: Es werden die Anwendungen des Case Managements in der Sozialen Arbeit genauer betrachtet.
- Kapitel 5: Der Praxistransfer zeigt die Anwendung des Regelkreises anhand eines Beispiels aus der Sozialen Arbeit auf.
Schlüsselwörter
Case Management, Sozialarbeit, Regelkreis, Mehrfachbelastungen, Hilfestellungen, Netzwerk, Ganzheitliches Konzept, Praxistransfer.
- Quote paper
- Vanessa Barth (Author), 2021, Entwicklung eines Case-Management-Regelkreises in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1239062