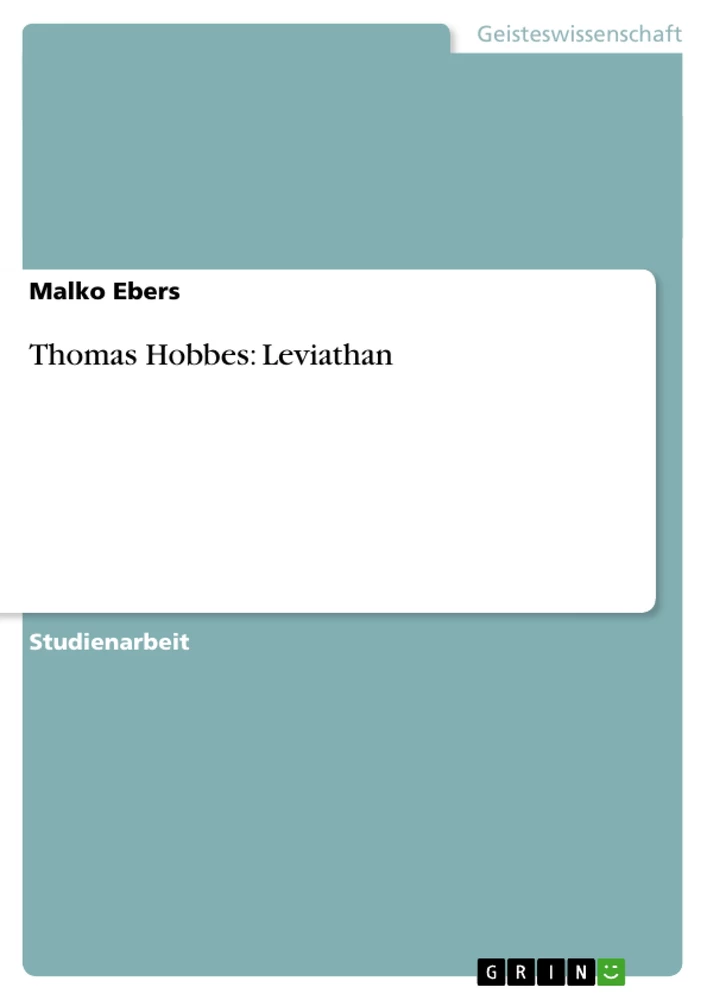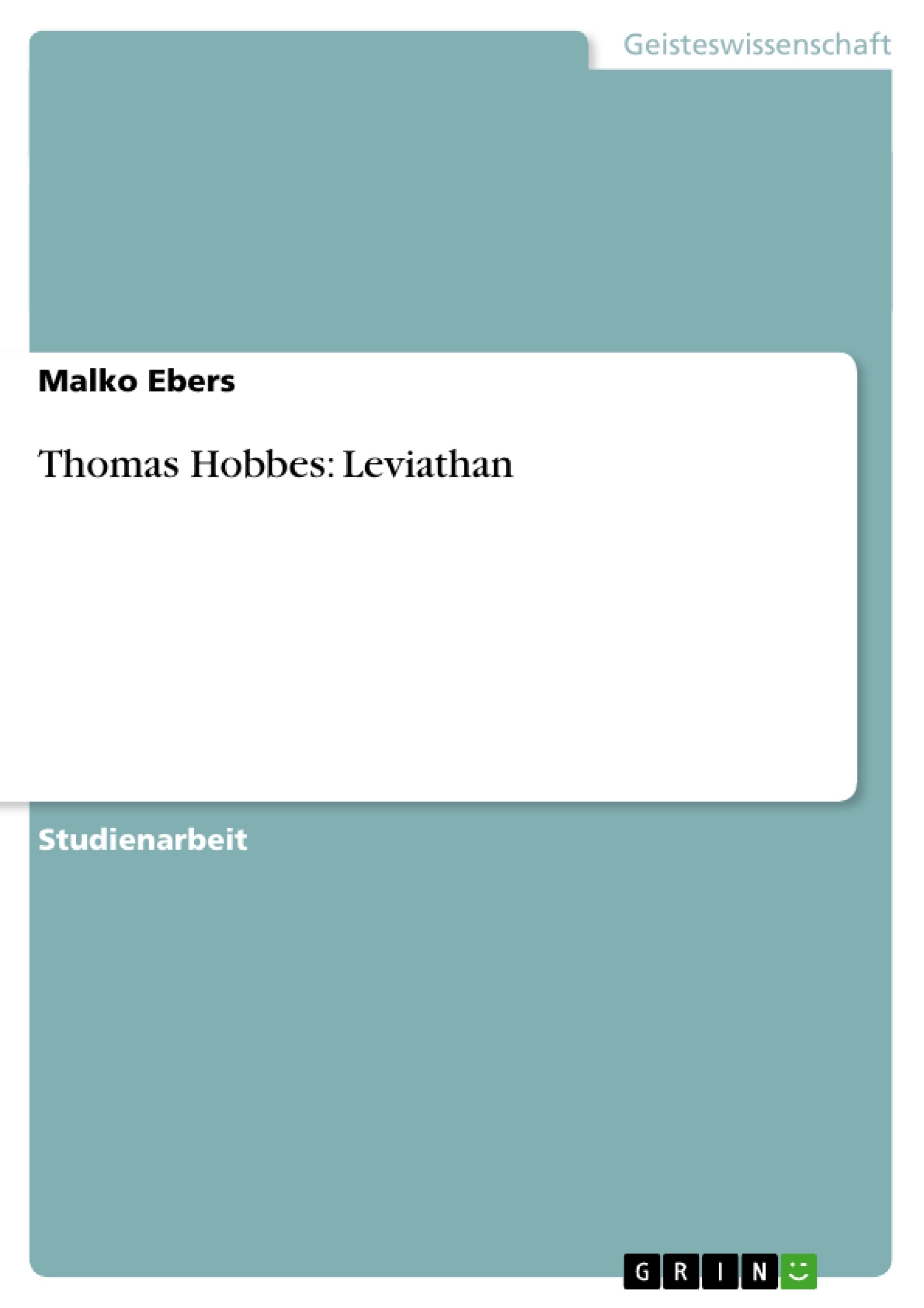Das Buch “Leviathan" des englischen Philosophen und Staatstheoretikers Thomas Hobbes (1588-1679) erschien erstmals 1651 und zählt zu den zentralen Texten der politischen Theorie der Neuzeit. Es ist eine Darstellung seiner Lehre von der höchsten Staatsgewalt.
Die Bedeutung des Leviathan besteht vor allem darin, dass Hobbes die staatliche Ordnung nicht auf göttliche Fügung, sondern allein auf einen Vertrag zwischen gleichen und freien Individuen zurückführt. Der Staat besteht weder auf Grund einer geselligen Natur der Menschen, noch Kraft einer bestimmten Form der göttlichen Einsetzung, sondern er wird von den Menschen eingerichtet zu dem Zweck, Leben und Eigentum der Bürger vor Angriffen von außen und vor Übergriffen im Inneren zu schützen. Hobbes zählt damit zu den Begründern einer modernen, liberalen Staatsauffassung, wonach die politische Ordnung auf das rationale Kalkül individueller Interessen gründet. Er war damit aber auch ein Vordenker der absolutistischen Monarchie.
Diese Arbeit ordnet Hobbes Leviathan in den historischen Kontext ein und bezieht sich auf verwandte Begriffe und Autoren wie beispielsweise Jean Bodin (Souveräntität) und Hugo Grotius (Gesellschaftsvertrag).
Inhaltsverzeichnis
- Historische Vorläufer des modernen Staates
- Der mittelalterliche Staat
- Der absolutistische Fürstenstaat
- Historischer Kontext
- Hobbes' Menschenbild
- Der Naturzustand
- Staatsgründung und Souveränität
- Der Leviathan
- Recht und Eigentum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay "Leviathan" von Thomas Hobbes ist eine tiefgründige Analyse der staatlichen Ordnung und der Natur des Menschen. Er strebt danach, die Notwendigkeit und Funktionsweise einer starken Staatsgewalt zu beleuchten und eine theoretische Grundlage für den Absolutismus zu schaffen.
- Das Menschenbild und die Natur des Krieges
- Der Gesellschaftsvertrag und die Entstehung des Staates
- Souveränität und Macht im Leviathan
- Recht, Eigentum und die Funktion des Staates
- Die Bedeutung des Leviathan im Kontext des gesellschaftlichen Umbruchs
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay "Leviathan" lässt sich in mehrere Abschnitte unterteilen, die verschiedene Aspekte der Hobbes'schen Staatslehre behandeln. Im ersten Abschnitt wird der mittelalterliche Staat mit seiner überirdischen Zielsetzung und ständischen Ordnung vorgestellt. Im zweiten Abschnitt wird der absolutistische Fürstenstaat als eine Neuordnung der Machtverhältnisse beschrieben. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit dem historischen Kontext des Leviathan und den Ursachen für den gesellschaftlichen Umbruch. Hobbes' Menschenbild, geprägt von der Gleichheit und der Eigenschaft, nach Macht zu streben, wird im vierten Abschnitt vorgestellt. Der fünfte Abschnitt behandelt den Naturzustand, der aufgrund der menschlichen Natur als ein Zustand des Krieges aller gegen alle dargestellt wird. Im sechsten Abschnitt wird die Staatsgründung als ein notwendiger Schritt zur Beendigung des Naturzustandes beschrieben. Dabei wird die Übertragung der Rechte des Volkes auf den Souverän und die Entstehung des Leviathan als absolut herrschende Macht analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe im Essay "Leviathan" sind: Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Souveränität, Leviathan, Macht, Recht, Eigentum, Absolutismus und Bürgerkrieg.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Aussage von Hobbes' "Leviathan"?
Hobbes begründet die Notwendigkeit einer absoluten Staatsgewalt, um den "Krieg aller gegen alle" im Naturzustand zu beenden und Sicherheit zu garantieren.
Wie definiert Thomas Hobbes den Naturzustand?
Als einen Zustand ohne staatliche Ordnung, in dem der Mensch dem Menschen ein Wolf ist (homo homini lupus) und ständige Angst um Leben und Eigentum herrscht.
Was ist der Gesellschaftsvertrag?
Ein fiktiver Vertrag, bei dem freie Individuen ihre Rechte auf einen Souverän übertragen, um im Gegenzug Schutz und Frieden zu erhalten.
Warum gilt Hobbes als Vordenker des modernen Staates?
Weil er die staatliche Ordnung nicht mehr göttlich, sondern rational durch das Kalkül individueller Interessen begründet.
Welche Rolle spielt die Souveränität im Leviathan?
Der Souverän besitzt uneingeschränkte Macht, um Gesetze zu erlassen und durchzusetzen, da nur eine starke Gewalt den inneren Frieden sichern kann.
- Arbeit zitieren
- Malko Ebers (Autor:in), 2002, Thomas Hobbes: Leviathan, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12391