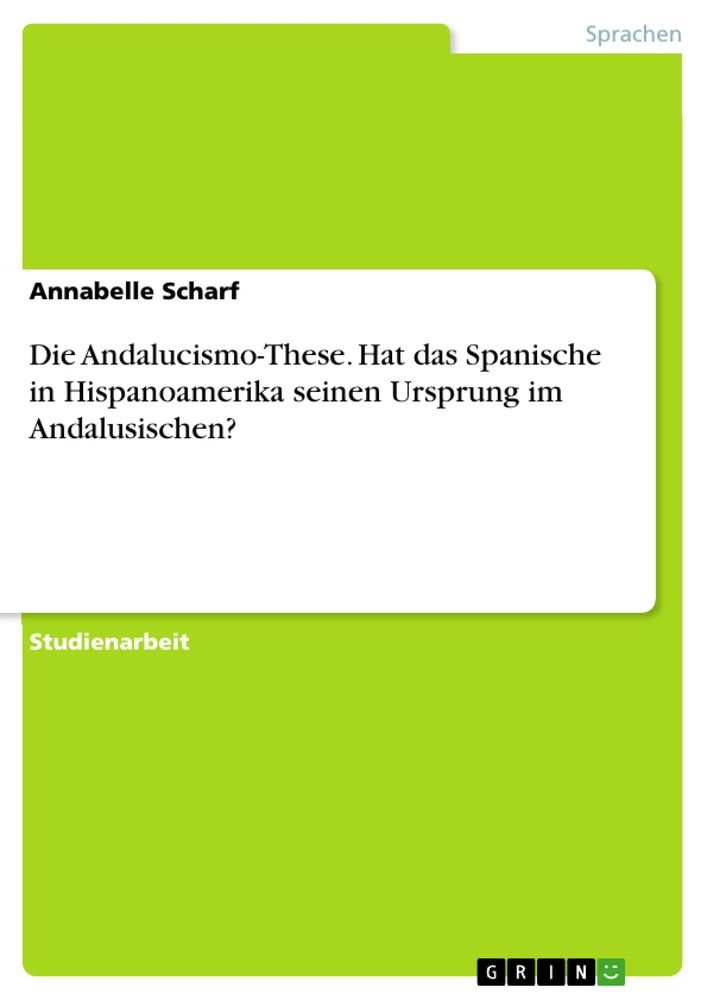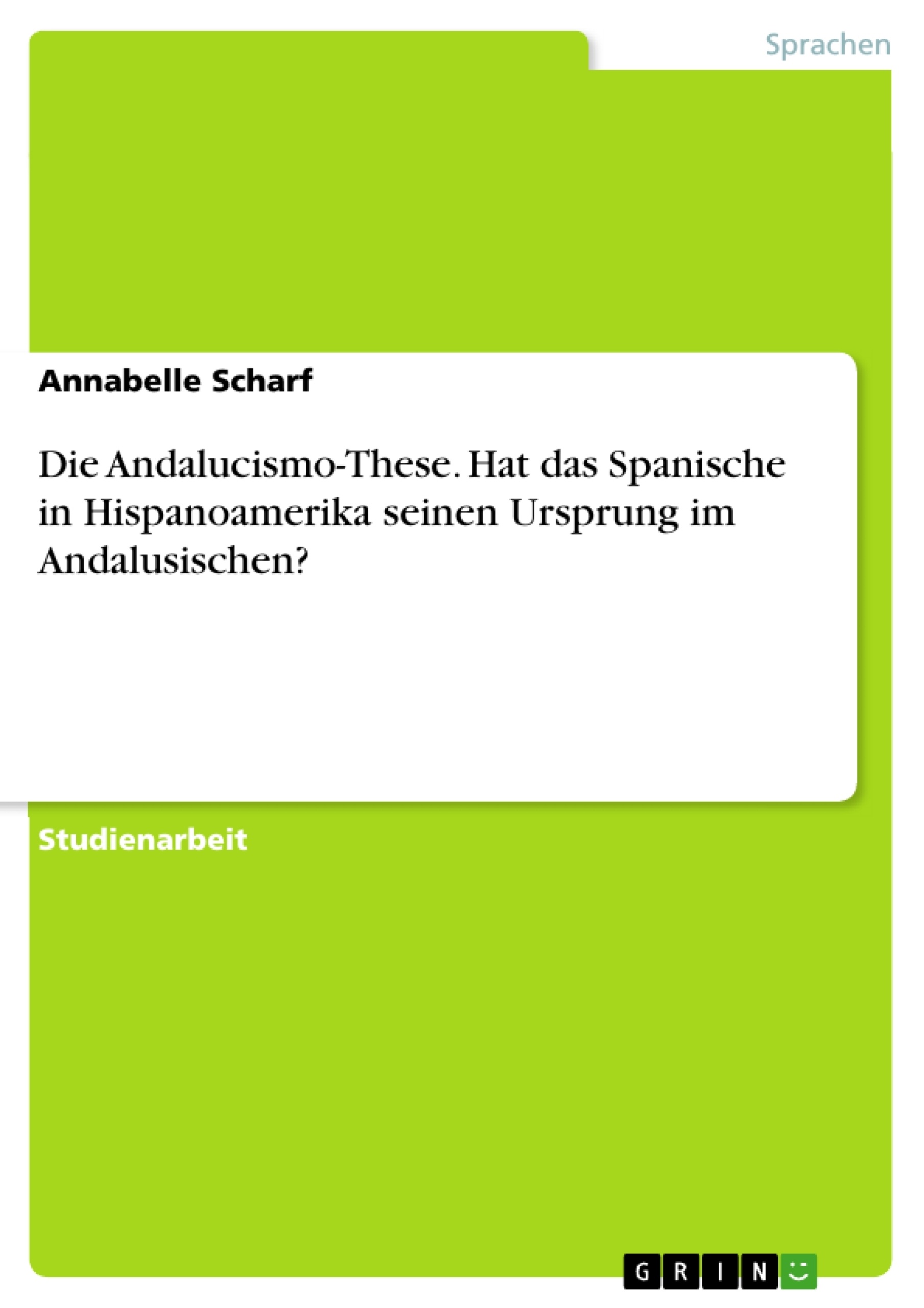Ziel dieser Hausarbeit ist es, mithilfe der Erhebungen, die zu den Theorien bezüglich des Andalucismo gemacht wurden, die These "Das Spanische in Hispanoamerika hat seinen Ursprung im Andalusischem" genauer zu untersuchen. Hierbei gehe ich insbesondere auf die Herkunft, Vertreter und den Inhalt über die Herausbildung des amerikanischen Spanisch ein.
Ich habe diese Arbeit in vier verschieden Abschnitte aufgeteilt. Zuerst werden die markantesten phonetischen Gemeinsamkeiten des Andalusischen Dialekts und der hispanoamerikanischen Sprache anhand von Beispielen präsentiert. Hierbei spielen der seseo, yeísmo und die Aspiration bzw. Verstummung von /s/ in implosiver Stellung eine
besonders wichtige Bedeutung. Die Debatte um die Andalucismo‐These wird chronologisch vorgestellt, angefangen mit den wahrscheinlichen Gründern der These Rufino José Cuervo und Max Leopold Wagner, folgend mit den wichtigsten als Andalucismo‐Gegner geltenden Vertretern Henríquez Ureña und Amado Alonso. In dem letzten Abschnitt werden die von Peter Boyd‐Bowman erbrachten statistischen Beweise mit denen von Ureña in Zusammenhang gesetzt sowie die wichtigsten Ansichten von Hispanisten wie Menéndez Pidal, Zamora Munné & Guitart und Fernández‐Sevilla miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Phonische Gemeinsamkeiten
- Der Beginn der Andalucismo - Debatte
- Antiandalucismo
- Neuere Entwicklungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der These, dass das Spanische in Hispanoamerika seinen Ursprung im Andalusischen hat. Die Arbeit analysiert die phonetischen Gemeinsamkeiten zwischen dem Andalusischen Dialekt und dem Hispanoamerikanischen Spanisch, beleuchtet die Entwicklung der Andalucismo-Debatte mit ihren wichtigsten Vertretern und untersucht die gegensätzlichen Theorien zur Entstehung des amerikanischen Spanisch.
- Phonetische Gemeinsamkeiten zwischen dem Andalusischen und dem Hispanoamerikanischen Spanisch
- Die Andalucismo-These und ihre Ursprünge
- Die Gegenargumente zur Andalucismo-These und die Antiandalucismo-These
- Statistische Beweise und die verschiedenen Perspektiven von Hispanisten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Andalucismo-These als ein zentrales Thema der spanischen Sprachgeschichte vor und erklärt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Ursprungs des amerikanischen Spanisch. Sie erläutert die Struktur der Hausarbeit, die in vier Abschnitte gegliedert ist.
- Hauptteil:
- Phonische Gemeinsamkeiten: Dieser Abschnitt untersucht die sprachlichen Übereinstimmungen zwischen dem Andalusischen Dialekt und dem Hispanoamerikanischen Spanisch, insbesondere im Bereich der Phonetik. Hierbei werden wichtige phonetische Phänomene wie der seseo, der yeísmo und die Aspiration von /s/ in implosiver Stellung vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert.
- Der Beginn der Andalucismo - Debatte: Dieser Abschnitt beleuchtet die Entstehung der Andalucismo-These und stellt die Beiträge von Rufino José Cuervo und Max Leopold Wagner vor. Er fokussiert auf die These von Wagner, die auf einer intensiven südspanischen Einwanderung während der Kolonialzeit basiert.
- Antiandalucismo: Dieser Abschnitt untersucht die Gegenposition zur Andalucismo-These, die von Henríquez Ureña vertreten wird. Er stellt Ureñas Theorie vor, die davon ausgeht, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Südspanien und Südamerika unabhängig voneinander entstanden sind und nicht auf Migration zurückzuführen sind.
Schlüsselwörter
Andalucismo, Hispanoamerikanisches Spanisch, Phonetik, seseo, yeísmo, Aspiration, Antiandalucismo, Henríquez Ureña, Max Leopold Wagner, Rufino José Cuervo, Einwanderung, Kolonialisierung, Sprachgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Andalucismo-These?
Die These besagt, dass die sprachlichen Besonderheiten des Spanischen in Amerika (Hispanoamerika) ihren Ursprung vor allem im andalusischen Dialekt Südspaniens haben.
Was sind die wichtigsten phonetischen Gemeinsamkeiten?
Dazu gehören der seseo (gleiche Aussprache von 's' und 'z'), der yeísmo (Aussprache von 'll' als 'y') und die Aspiration des Endungs-'s'.
Wer waren die Begründer der Andalucismo-Debatte?
Rufino José Cuervo und Max Leopold Wagner gelten als die frühen Vertreter dieser Theorie, wobei Wagner sie statistisch und historisch untermauerte.
Was ist die Antiandalucismo-Position?
Vertreter wie Henríquez Ureña argumentierten, dass sich die sprachlichen Phänomene in Amerika unabhängig von Andalusien entwickelt haben oder auf andere Regionen Spaniens zurückzuführen sind.
Welche Rolle spielt die Einwanderungsstatistik von Peter Boyd-Bowman?
Boyd-Bowman lieferte Daten, die belegen, dass ein Großteil der Siedler in der frühen Kolonialzeit tatsächlich aus Andalusien stammte, was die These stützt.
- Citation du texte
- Annabelle Scharf (Auteur), 2022, Die Andalucismo-These. Hat das Spanische in Hispanoamerika seinen Ursprung im Andalusischen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1239263