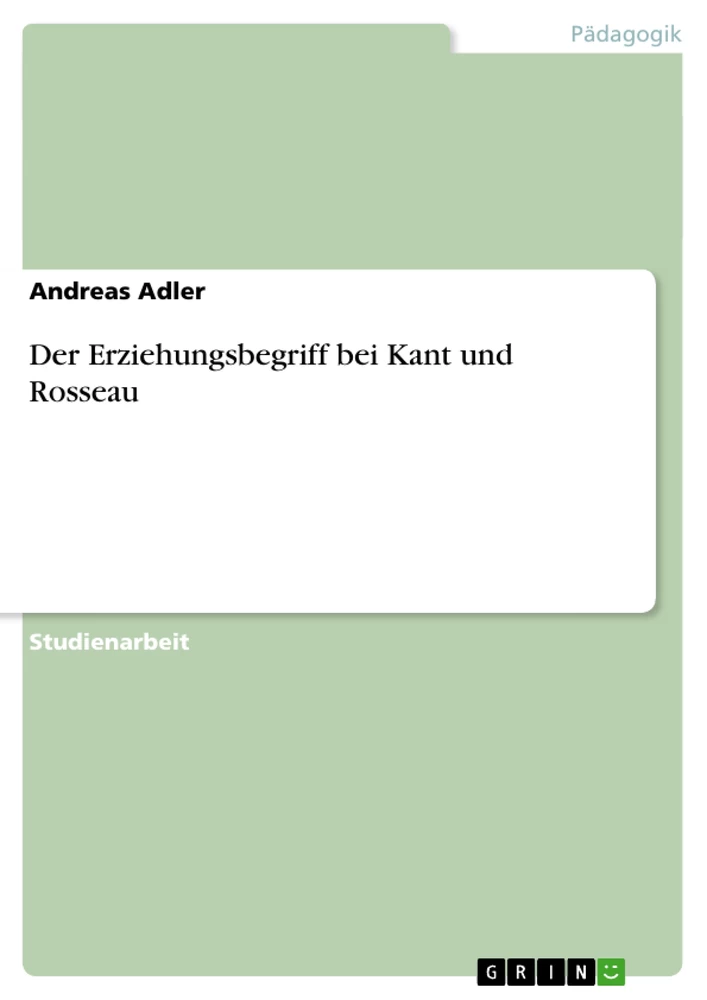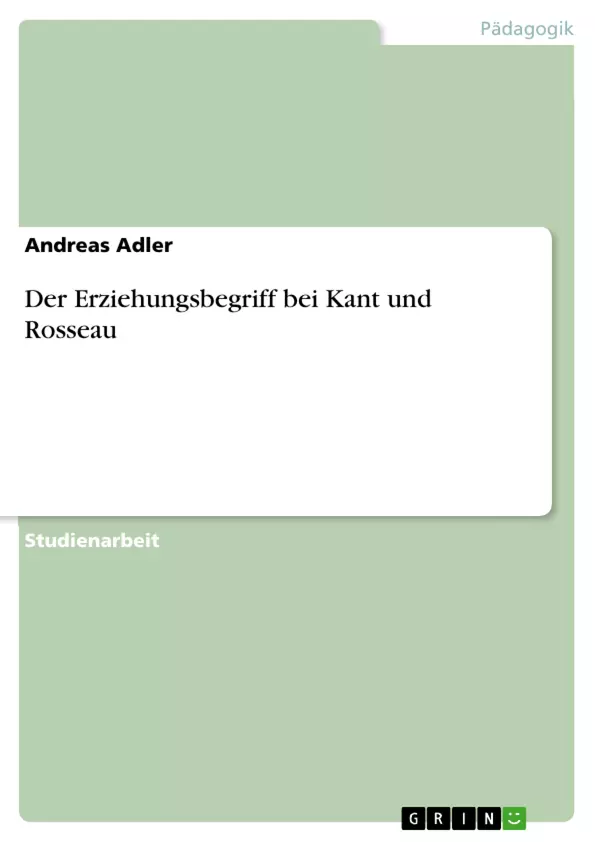Diese Arbeit befaßt sich mit dem Themenkomplex der Erziehung bei Immanuel Kant
und Jean-Jacques Rosseau. Zuerst wird der Erziehungsbegriff bei Kant genauer
durchleuchtet, um ihn anschließend dem von Rosseau gegenüberzustellen. Der
Schwerpunkt hierbei liegt bei dem Vergleich der möglichen Ziele der Erziehung,
sowie dem Widerspruch zwischen Zwang und Freiheit.
Die ersten Grundsteine für unser heutiges Erziehungssystem wurden im 18.
Jahrhundert gelegt, welches dadurch auch als das „pädagogische Jahrhundert“
bekannt wurde. (vgl. Koller, S. 27) Hierfür sorgten nicht nur die Entdeckung der
Kindheit, sondern auch die Etablierung der Schule. Hinzu kam die in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnende Entwicklung eines pädagogischen
Diskurses. Bis dato lediglich eine Teilbereich der Philosophie gewesen, geriet die
Pädagogik immer mehr in den Mittelpunkt von Immanuel Kants Vorlesungen.
Worin nun besteht der spezifische Beitrag Kants zur theoretischen Fassung des
Erziehungsbegriffs, und inwieweit wurde dieser von den Theorien Rosseaus
beeinflusst?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Fragestellung der Arbeit
- Der Erziehungsbegriff bei Kant
- Der Erziehungsprozess
- Zwang und Freiheit
- Der Erziehungsbegriff bei Rousseau
- Wozu Erziehung?
- Das Paradoxon der Erziehung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Erziehungsbegriffe von Immanuel Kant und Jean-Jacques Rousseau. Der Fokus liegt auf den Zielen der Erziehung und dem Spannungsverhältnis zwischen Zwang und Freiheit im Erziehungsprozess. Die Arbeit untersucht die spezifischen Beiträge beider Denker zur pädagogischen Theorie des 18. Jahrhunderts.
- Kants Erziehungsbegriff und dessen Stufen (Disziplinierung, Zivilisierung, Kultivierung, Moralisierung)
- Das Verhältnis von Zwang und Freiheit in Kants Pädagogik
- Rousseaus Verständnis von Erziehung und dessen zentrale Paradoxien
- Ein Vergleich der Erziehungsziele bei Kant und Rousseau
- Die Bedeutung des 18. Jahrhunderts als „pädagogisches Jahrhundert“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Vergleich der Erziehungsbegriffe von Kant und Rousseau vor. Kapitel 2 analysiert Kants Erziehungsbegriff, mit detaillierter Betrachtung des Erziehungsprozesses, welcher in vier Stufen gegliedert ist: Disziplinierung, Zivilisierung, Kultivierung und Moralisierung. Die Rolle von Zwang und Freiheit innerhalb dieses Prozesses wird ebenfalls untersucht. Kapitel 3 wendet sich Rousseau zu, beleuchtet dessen Verständnis von Erziehung und den damit verbundenen Paradoxien.
Schlüsselwörter
Erziehung, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Zwang, Freiheit, Disziplinierung, Zivilisierung, Kultivierung, Moralisierung, Pädagogik, 18. Jahrhundert, pädagogischer Diskurs, Menschwerdung, Selbstständigkeit, Mündigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich die Erziehungsziele von Kant und Rousseau?
Die Arbeit vergleicht Kants Fokus auf die Menschwerdung durch Disziplin und Moral mit Rousseaus Ansätzen und dem Paradoxon zwischen gesellschaftlicher Anpassung und individueller Freiheit.
Was sind die vier Stufen des Erziehungsprozesses nach Kant?
Kant gliedert den Prozess in Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung und schließlich Moralisierung.
Wie wird das Spannungsverhältnis von Zwang und Freiheit gelöst?
In der Pädagogik des 18. Jahrhunderts wird untersucht, wie man ein Kind dem Zwang unterwerfen kann, damit es später lernt, seine Freiheit vernunftgemäß und selbstständig zu nutzen.
Warum wird das 18. Jahrhundert als „pädagogisches Jahrhundert“ bezeichnet?
In dieser Zeit wurde die Kindheit als eigene Lebensphase „entdeckt“, Schulen etabliert und die Pädagogik entwickelte sich zu einem eigenständigen theoretischen Diskurs.
Was versteht Rousseau unter dem Paradoxon der Erziehung?
Es beschreibt den Widerspruch, dass Erziehung einerseits die natürliche Entwicklung schützen soll, andererseits aber immer einen gestaltenden Einfluss auf das Kind ausübt.
- Citar trabajo
- Andreas Adler (Autor), 2008, Der Erziehungsbegriff bei Kant und Rosseau, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123951