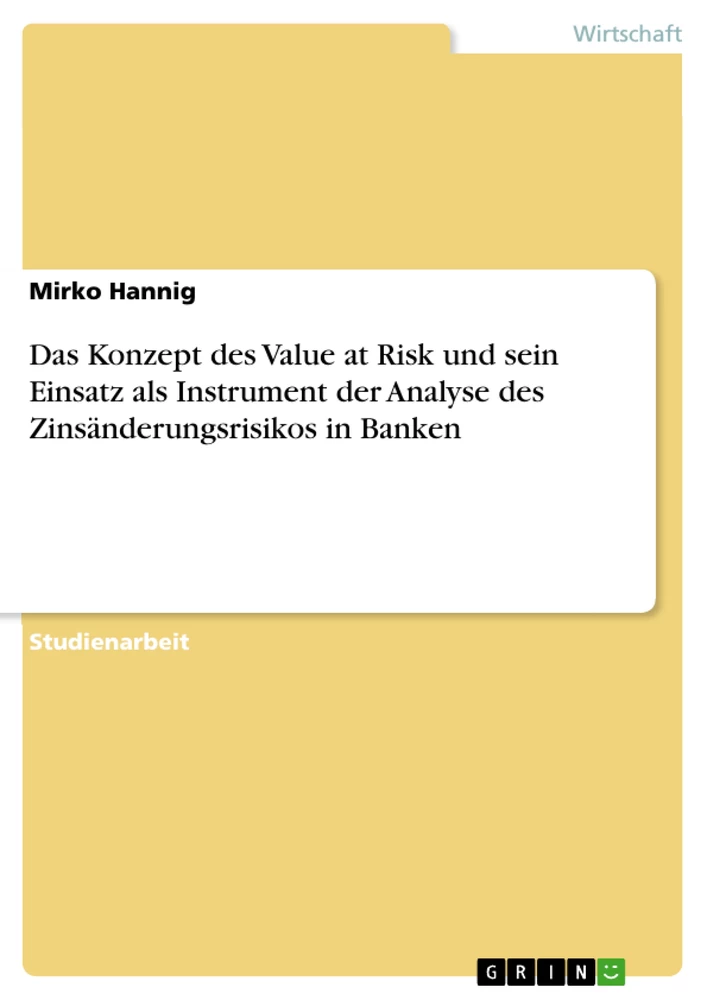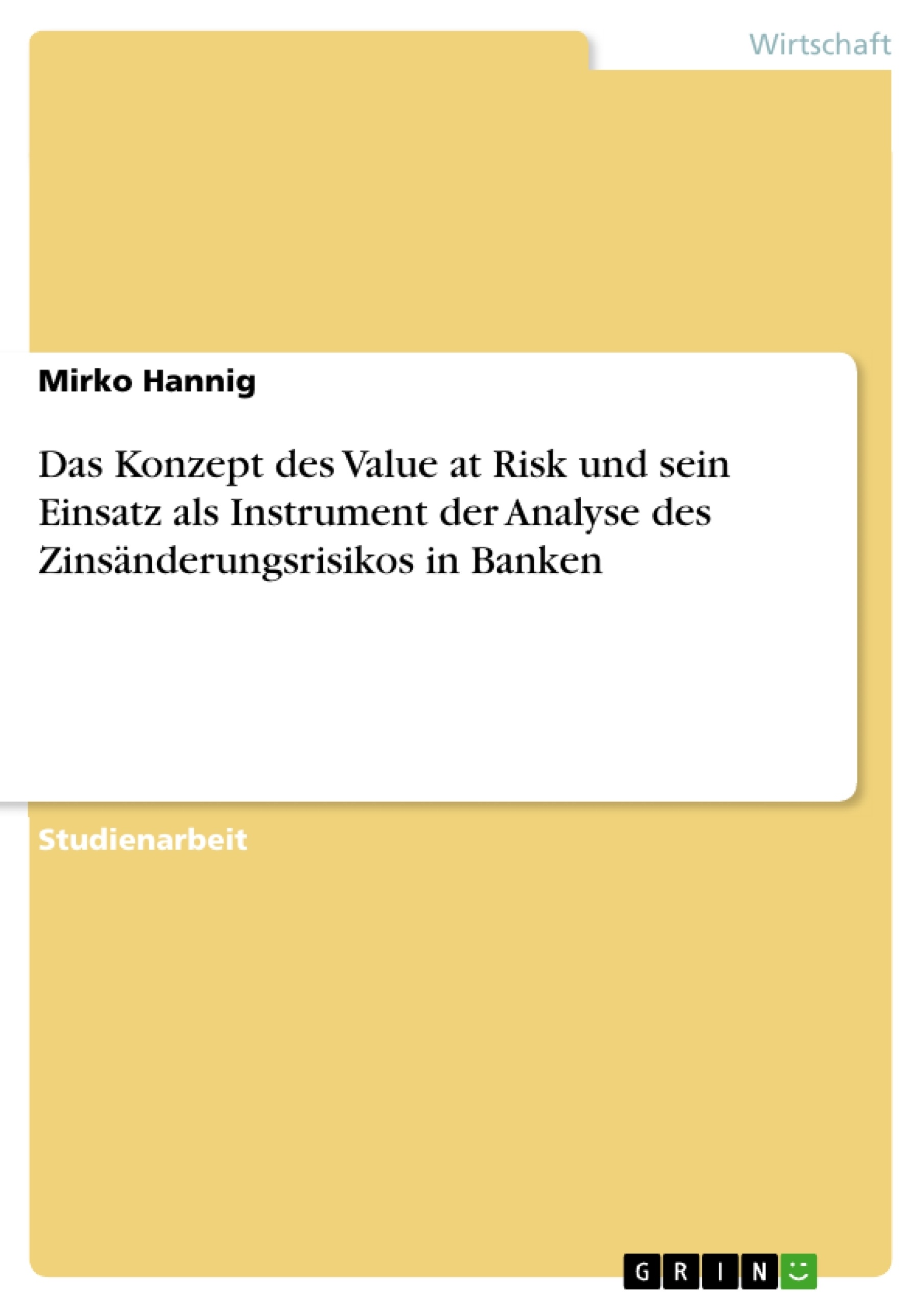Gegenstand dieser Arbeit soll zunächst in die Vorstellung des Konzeptes des Value at Risk sein, in dessen Rahmen die zugrunde liegenden Prämissen, die in der Literatur beschriebenen Ermittlungsverfahren sowie die Interpretierbarkeit der Ergebnisgröße vorgestellt werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei ganz bewusst auf dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, da dieser als Grundmodell zu verstehen ist und alle anderen Ansätze an dessen Schwächen ansetzen und versuchen, das Verfahren zu verbessern. Mathematisches bzw. stochastisches Fachwissen wird dabei grundsätzlich vorausgesetzt. Zudem wird in den Verfahrensbeschreibungen nicht auf alle Konstellationen und Besonderheiten eingegangen, die sich in der wissenschaftlichen Literatur finden. Vielmehr soll ein Grundverständnis vermittelt werden, das zur Einordnung der Erkenntnisse aus Kapitel 3 notwendig ist. Im letzten Kapitel dieser Arbeit folgt dem zuvor rein theoretischen Teil eine Betrachtung der aktuellen aufsichtsrechtlichen Vorgaben, da diese zusammen mit den wissenschaftlichen Modell-Erkenntnissen aus Kapitel 2 die Determinanten für den Einsatz des VaR-Konzeptes in der Bankpraxis darstellen. Aufsichtsrechtliche Grundkenntnisse werden hier vorausgesetzt, um die Ausführungen entsprechend einordnen zu können. Dem folgend wird im weiteren Verlauf des Kapitels anhand der letzten Geschäftsberichte gezeigt, in welcher Form deutsche Kreditinstitute VaR-Konzepte einsetzen und welche Ergebnisqualität sie hiermit erzielen konnten. Enden soll diese Arbeit mit einer kritischen Würdigung der gewonnen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzept des Value at Risk
- 2.1 Definition und Grundlagen
- 2.2 Berechnungsverfahren
- 2.2.1 Varianz-Kovarianz-Ansatz
- 2.2.2 Historische Simulation
- 2.2.3 Monte-Carlo-Simulation
- 3. Der Value at Risk in Aufsichtsrecht und Bankpraxis
- 3.1 Aufsichtsrechtliche Vorgaben
- 3.2 Einsatz des Instruments in der Bankpraxis
- 4. Zusammenfassung & kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Value at Risk (VaR)-Konzept und dessen Anwendung zur Analyse von Zinsänderungsrisiken in Banken. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen des VaR, verschiedene Berechnungsmethoden und deren praktische Anwendung im Kontext der aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
- Definition und Grundlagen des Value at Risk
- Vergleichende Analyse verschiedener VaR-Berechnungsverfahren (Varianz-Kovarianz-Ansatz, historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation)
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das VaR-Konzept
- Praktische Anwendung des VaR in deutschen Kreditinstituten
- Kritische Würdigung des VaR-Konzeptes
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung führt in die Thematik des Risikomanagements im Bankensektor ein und definiert den Begriff des Zinsänderungsrisikos.
Kapitel 2: Konzept des Value at Risk stellt das VaR-Konzept vor, erläutert die zugrundeliegenden Prinzipien und beschreibt verschiedene Berechnungsmethoden. Der Varianz-Kovarianz-Ansatz wird als Basismodell detailliert behandelt.
Kapitel 3: Der Value at Risk in Aufsichtsrecht und Bankpraxis befasst sich mit den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zum VaR und analysiert die praktische Anwendung des Konzepts in deutschen Banken anhand von Geschäftsberichten.
Schlüsselwörter
Value at Risk (VaR), Zinsänderungsrisiko, Risikomanagement, Banken, Aufsichtsrecht, Varianz-Kovarianz-Ansatz, Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Finanzdienstleistungsaufsicht.
- Quote paper
- Mirko Hannig (Author), 2009, Das Konzept des Value at Risk und sein Einsatz als Instrument der Analyse des Zinsänderungsrisikos in Banken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123971