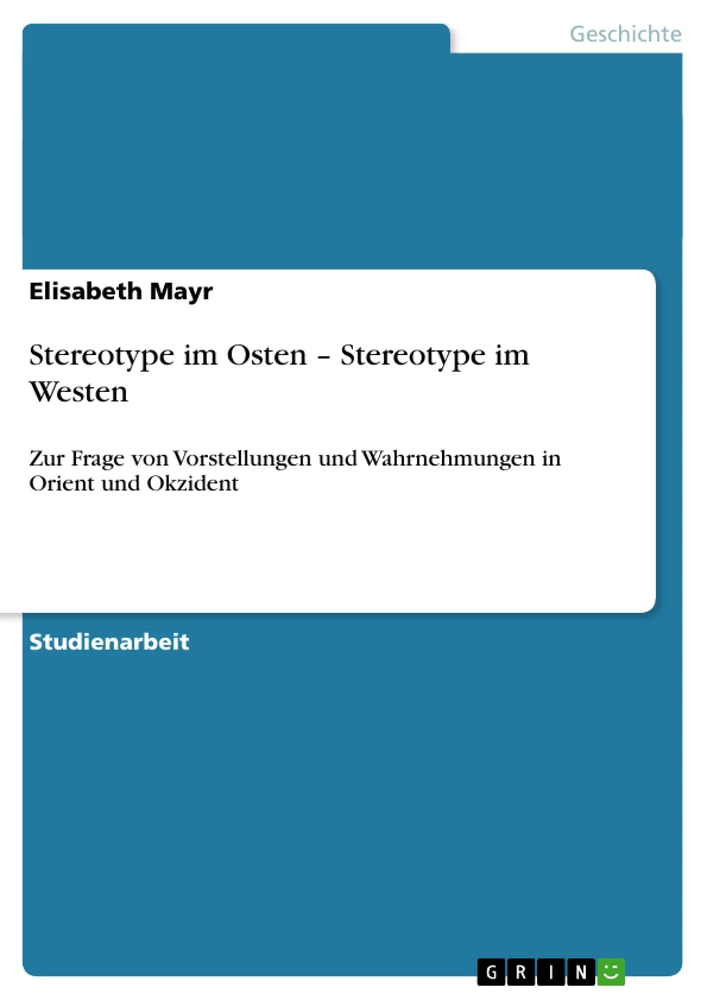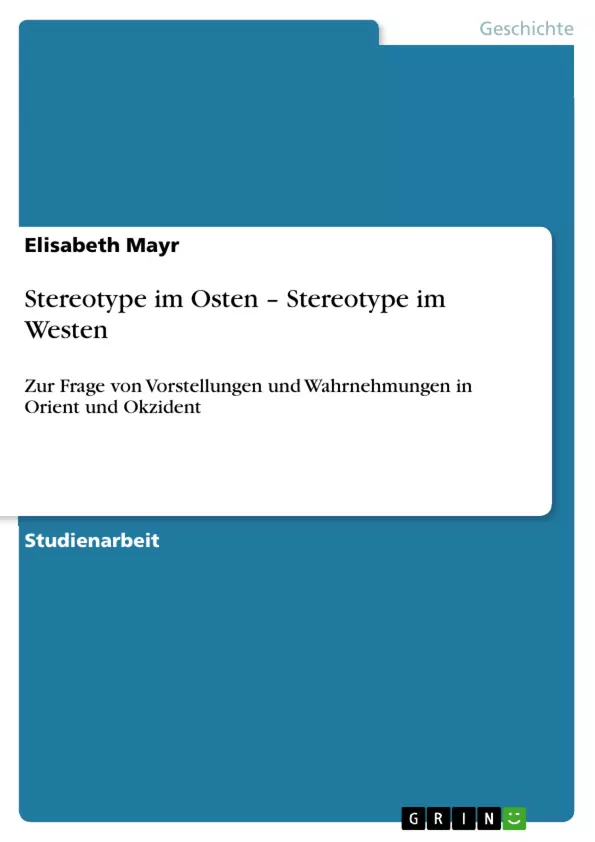Dass das Thema Türkei – Europa heute ein sehr aktuelles ist, sieht man daran, dass bei der Frage eines EU Beitritts dieses Landes oder nicht die Wogen hochgehen. Wie es scheint, kommt man schon seit nahezu dreißig Jahren auf keinen gemeinsamen Nenner. Die Türkei wird politisch zwar außen vor gelassen, doch verzeichnete der Westen in den letzten Jahrzehnten einen großen Zustrom an türkischen Emigranten, dass - verfolgt man die Thematik in den Tageszeitungen - zu einem wahren Zusammenprall der Kulturen führte. Doch ist die heutige Begegnung nur eine in einer Kette von vielen. Der Türke ist schon lange in den Köpfen der Menschen verankert und hat sich auch schon lange im Sprachgebrauch niedergeschlagen: „einen Türken bauen“, „Türkenblut“ (Rotwein) trinken, etwas „getürkt haben“. In dem beliebten Kinderlied „C-A-F-F-E-E“ wird vor dem Türkensaft, der die Nerven schwächt und einem blass und krank macht, gewarnt.
Die heutige Generation hat das Gefühl, das Zusammenkommen zwischen Türkei und Europa sei jüngeren Datums, genauer gesagt, seit der Gastarbeiterbewegung in den 1960er Jahren. Dass es aber schon in Mittelalter und Früher Neuzeit zu einem wahren Kampf der Kulturen kam, wird oft vergessen.
Diese Begegnungen während der Türkenbedrohung im 15-17. Jahrhunderts haben nachhaltig auf die Menschen gewirkt. Bilder, die dort entstanden sind, werden – großteils unbewusst – von Generation zu Generation weitergegeben und wirken großteils bis heute, weil der Türke auch nie ganz aus dem europäischen Gesichtsfeld verschwunden ist. In dieser Arbeit soll nun ein kurzer Abriss der Geschichte Europas, aber auch des Osmanischen Reiches gegeben werden, wobei das Hauptaugenmerk auf die Vorstellung und Wahrnehmung voneinander liegen wird.
Auf europäischer Seite spielt das religiöse Türkenbild eine ganz besondere Rolle, da die Kirche zur Zeit der Türkenbedrohung massive Propaganda gegen die Türken betrieb. Dabei wurde das Bild des grausamen, meuchelnden Türken in die Köpfe der Menschen regelrecht eingehämmert. Doch auch die früheren Begegnungen zwischen Osten und Westen in der Antike sollen erwähnt werden. Abgerundet wird dieses Bild von drei Reiseberichten von Gesandten, die das Osmanische Reich besucht haben und mit eigenen Augen die andere Kultur erlebten.
Auf islamischer Seite wird gezeigt werden, dass die Vorstellung vom Europäer weitestgehend von Mohammed, dem Koran und den ersten Kontakten im Mittelalter geprägt ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Begegnungen
- I. Der Westen blickt nach Osten
- 1. Frühe Wurzeln
- 1.1. Klimazonenlehre
- 1.1.1. Despot und Tyrann
- 2. Die röm-kath. Kirche und der Türke
- 2.1. Türkenhoffnung
- 2.3. Türken-Propaganda
- 2.3.1. Welches Bild?
- 2.3.2. Zu Welchem Zweck?
- a) Türkenpredigten
- b) Türkenglocken
- c) Türkengebet
- 3. Die Reiseberichte
- 4. Nach der Gefahr
- 1. Frühe Wurzeln
- II. Der Osten blickt nach Westen
- 1. Mohammed und das Mittelalter: Erste Kontakte
- 2. Die Lage ändert sich
- 3. Ein Osmanischer Gesandter in Wien: Evliyâ Çelebi
- 4. Nach dem 16. Jahrhundert: Der Stern sinkt
- Westen kontra Osten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wechselseitige Wahrnehmung und Vorstellung zwischen Europa und dem Osmanischen Reich über die Jahrhunderte. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Stereotypen und Vorurteilen, beginnend mit frühen Begegnungen bis hin zur Neuzeit. Dabei wird sowohl die europäische, als auch die osmanische Perspektive beleuchtet.
- Entwicklung von Stereotypen über den "Türken" im europäischen Kontext
- Der Einfluss der Religion (Christentum und Islam) auf die wechselseitige Wahrnehmung
- Die Rolle von Reiseberichten in der Konstruktion von Bildern des "Anderen"
- Vergleichende Analyse der Perspektiven von Ost und West
- Die Kontinuität und Veränderung von Stereotypen über die Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel, "Begegnungen," führt in die Thematik ein und stellt den aktuellen Diskurs über die Beziehungen zwischen der Türkei und Europa in den Kontext historischer Begegnungen. Der erste Teil, "Der Westen blickt nach Osten," erforscht die Entstehung von Stereotypen über die Türken in Europa, beginnend mit frühen Einflüssen aus der Antike und der Rolle der katholischen Kirche während der Türkenkriege. Reiseberichte aus der Zeit werden als wichtige Quellen analysiert. Der zweite Teil, "Der Osten blickt nach Westen," beleuchtet die osmanische Wahrnehmung Europas, ausgehend von den ersten Kontakten im Mittelalter und der Entwicklung der Perspektive über die Jahrhunderte. Die Kapitel vermeiden abschließende Interpretationen und konzentrieren sich auf die Darstellung historischer Entwicklungen und Perspektiven.
Schlüsselwörter
Türkei, Europa, Osmanisches Reich, Stereotype, Vorurteile, Wahrnehmung, Christentum, Islam, Reiseberichte, Kulturkontakt, Antike, Mittelalter, Neuzeit, Propaganda.
Häufig gestellte Fragen
Wann entstanden die ersten Stereotype über Türken in Europa?
Erste Bilder entstanden bereits in der Antike und im Mittelalter, verfestigten sich aber massiv während der Türkenbedrohung im 15. bis 17. Jahrhundert.
Welche Rolle spielte die Kirche bei der Entstehung dieser Bilder?
Die Kirche betrieb massive Propaganda, nutzte Türkenpredigten und Gebete, um das Bild des „grausamen Feindes“ zu festigen und so den religiösen Zusammenhalt zu stärken.
Wie nahmen Osmanen die Europäer wahr?
Die osmanische Sicht war stark durch den Koran und die frühen Kontakte im Mittelalter geprägt, wobei Europäer oft als „Ungläubige“ oder politisch unterlegen wahrgenommen wurden.
Was berichten Reiseberichte aus dieser Zeit?
Gesandte lieferten oft detaillierte, aber auch subjektive Berichte über die andere Kultur, die zwischen Faszination für die Pracht und Abscheu vor dem Fremden schwankten.
Wirken diese historischen Stereotype heute noch?
Ja, viele Bilder und Redewendungen haben sich tief im kollektiven Gedächtnis und im Sprachgebrauch verankert und beeinflussen unbewusst aktuelle Debatten über EU-Beitritte.
- Quote paper
- Elisabeth Mayr (Author), 2008, Stereotype im Osten – Stereotype im Westen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123975