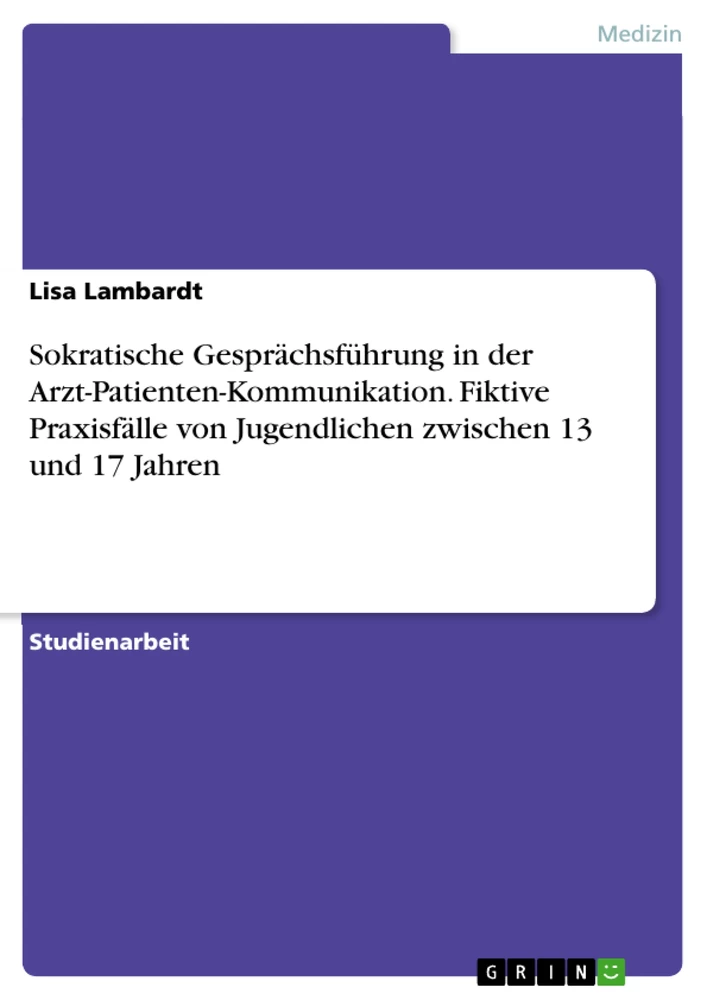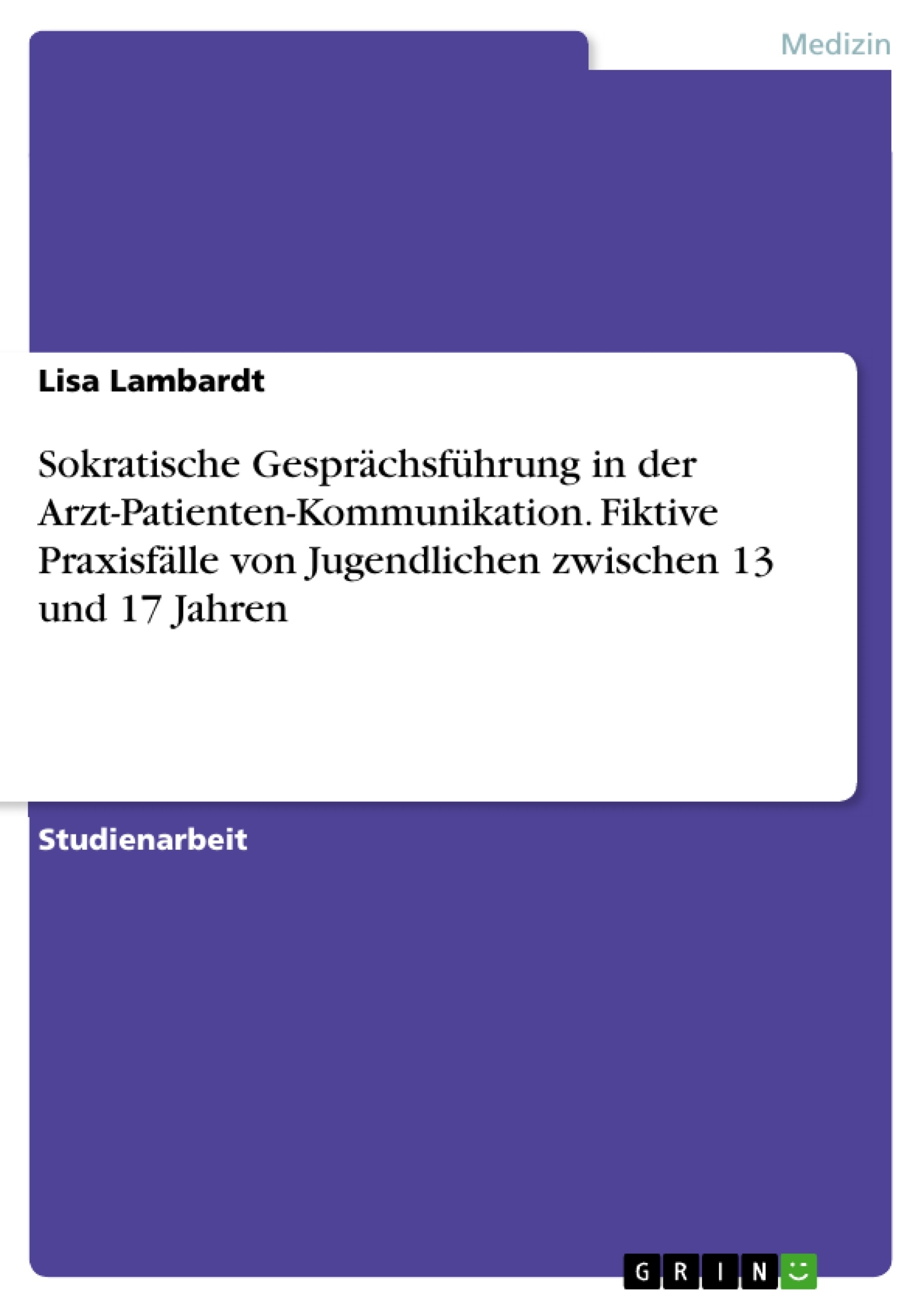Die theoretischen Grundlagen gelingender Kommunikation werden im zweiten, theoretischen Kapitel dieser Arbeit vorgestellt. Dazu werden die Kommunikationsmodelle von Paul Watzlawick (1967/ 2011) (Kapitel 2.2.1) und Friedmann Schulz von Thun (2013) (Kapitel 2.2.2), sowie Empathie, Wertschätzung und Kongruenz im Sinne der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie (Kapitel 2.2.3) und darüber hinaus Gründe für gelingende Arzt-Patienten-Gespräche (Kapitel 2.2.4) dargestellt. Des Weiteren wird auf die besonderen Anforderungen der Arzt-Patienten-Kommunikation eingegangen (Kapitel 3). Hierzu werden Gründe für misslingende Arzt-Patienten-Gespräche aufgeführt (Kapitel 3.3.1), und die
Kommunikation mit Kindern- und Jugendlichen beleuchtet (Kapitel 3.3.2). Auch das Modell der sokratischen Gesprächsführung wird hier dargelegt (Kapitel 3.3.3).
Darauf aufbauend werden im anwendungsbezogenen Kapitel dieser Arbeit (4) drei fiktive Fallbeispiel der Arzt-Patienten-Kommunikation mit Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren vorgestellt. Zunächst berichten die Jugendlichen von in ihren Augen missglücken Gesprächen mit Ärzten (Kapitel 4.4.1). Darauf hin werden die drei Praxisfälle im Lichte gelingender Kommunikation diskutiert und für jeden Fall beispielhafte Dialoge zu gelingender Kommunikation mittels sokratischer Gesprächsführung vorgestellt (Kapitel 4.2). Abschließend möchte ich aus den gewonnenen Erkenntnissen konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen, um zu zeigen wie eine gelingende Kommunikation zwischen Arzt
7 und Patient gefördert werden kann (Kapitel 5). Es folgen Diskussion, sowie Ausblick und Fazit (Kapitel 6&7).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2.Theoretische Grundlagen gelingender Kommunikation
- 2.1 Kommunikation nach Paul Watzlawick
- 2.2 Die vier Seiten einer Nachricht von Friedmann Schulz von Thun
- 2.3 Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Empathie, Wertschätzung und Kongruenz
- 2.4 Gründe für gelingende Arzt-Patienten-Gespräche
- 3.Besondere Anforderungen der Arzt-Patienten-Kommunikation
- 3.1 Gründe für eine misslingende Arzt-Patienten-Kommunikation
- 3.2 Kommunikation mit Kindern- und Jugendlichen
- 3.3 Das Modell der sokratischen Gesprächsführung
- 4.Anwendungsbezogener Teil
- 4.1 Missglücke Arzt-Patienten-Gespräche
- 4.1.1 Der Fall Johanna
- 4.1.2 Der Fall Maximilian
- 4.1.3 Der Fall Mika
- 4.2 Gelingende Arzt-Patienten-Gespräche mittels sokratischer Gesprächsführung
- 4.2.1 Der Fall Johanna
- 4.2.2 Der Fall Maximilian
- 4.2.3 Der Fall Mika
- 5. Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt & Patient
- 5.1 Empfehlungen für Kinder und Jugendliche
- 5.2 Umfassende Empfehlungen
- 6. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die sokratische Gesprächsführung als Methode der Arzt-Patienten-Kommunikation zu untersuchen und ihren Einsatz bei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren zu analysieren.
- Die Bedeutung gelingender Kommunikation im Arzt-Patienten-Verhältnis
- Die Herausforderungen der Kommunikation mit Jugendlichen in medizinischen Kontexten
- Das Prinzip der sokratischen Gesprächsführung und seine Anwendungsmöglichkeiten in der Arzt-Patienten-Kommunikation
- Die Analyse von fiktiven Praxisfällen, die sowohl misslungene als auch gelingende Kommunikationssituationen zwischen Arzt und jugendlichen Patienten darstellen
- Die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz der sokratischen Gesprächsführung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung der Arzt-Patienten-Kommunikation beleuchtet und die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit darlegt. Anschließend werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen gelingender Kommunikation behandelt. Hier werden wichtige Kommunikationsmodelle und Ansätze vorgestellt, wie beispielsweise die Kommunikationstheorie nach Paul Watzlawick, das Vier-Seiten-Modell von Friedmann Schulz von Thun und die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Kapitel 3 widmet sich den besonderen Anforderungen der Arzt-Patienten-Kommunikation, insbesondere im Hinblick auf die Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. Hier wird auch das Modell der sokratischen Gesprächsführung näher erläutert. Im anschließenden Kapitel 4 werden Anwendungsbeispiele für die sokratische Gesprächsführung im Rahmen von Arzt-Patienten-Gesprächen mit Jugendlichen dargestellt. Dabei werden sowohl misslungene als auch gelingende Kommunikationssituationen analysiert. In Kapitel 5 werden Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient gegeben, wobei ein besonderer Fokus auf den Einsatz der sokratischen Gesprächsführung liegt.
Schlüsselwörter
Arzt-Patienten-Kommunikation, sokratische Gesprächsführung, Jugendliche, Kommunikationstheorie, Watzlawick, Schulz von Thun, klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Empathie, Wertschätzung, Kongruenz, Praxisfälle, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die sokratische Gesprächsführung in der Medizin?
Es ist eine Methode der Gesprächsführung, bei der der Arzt durch gezieltes Fragen dem Patienten hilft, eigene Einsichten zu gewinnen, anstatt ihm Lösungen vorzugeben. Dies ist besonders bei Jugendlichen effektiv.
Welche Kommunikationsmodelle werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit nutzt die Modelle von Paul Watzlawick (Axiome der Kommunikation) und Friedmann Schulz von Thun (Vier-Seiten-Modell einer Nachricht).
Warum ist die Kommunikation mit Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren schwierig?
Jugendliche befinden sich in einer Entwicklungsphase, in der Autonomie und Vertrauen zum Arzt eine große Rolle spielen. Misslungene Kommunikation kann hier zu Behandlungsabbrüchen oder Unzufriedenheit führen.
Was bedeutet „klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie“ nach Rogers?
Dieser Ansatz betont die drei Grundhaltungen des Therapeuten (oder Arztes): Empathie (Einfühlungsvermögen), Wertschätzung (Akzeptanz) und Kongruenz (Echtheit).
Welche Fallbeispiele werden in der Studie analysiert?
Die Arbeit analysiert drei fiktive Fälle (Johanna, Maximilian und Mika), um den Unterschied zwischen misslungener Kommunikation und gelungener sokratischer Gesprächsführung aufzuzeigen.
Welche Handlungsempfehlungen gibt die Arbeit für Ärzte?
Ärzte sollten aktiv zuhören, die Perspektive der Jugendlichen ernst nehmen und durch sokratische Fragen die Compliance und das Verständnis der jungen Patienten fördern.
- Quote paper
- Lisa Lambardt (Author), 2020, Sokratische Gesprächsführung in der Arzt-Patienten-Kommunikation. Fiktive Praxisfälle von Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1239953