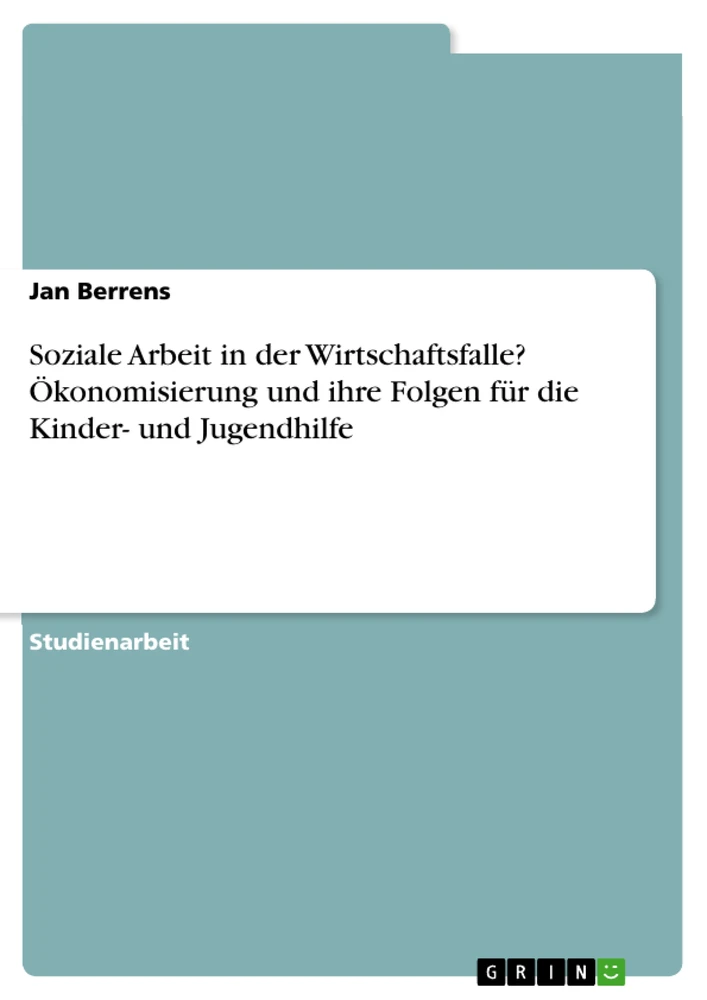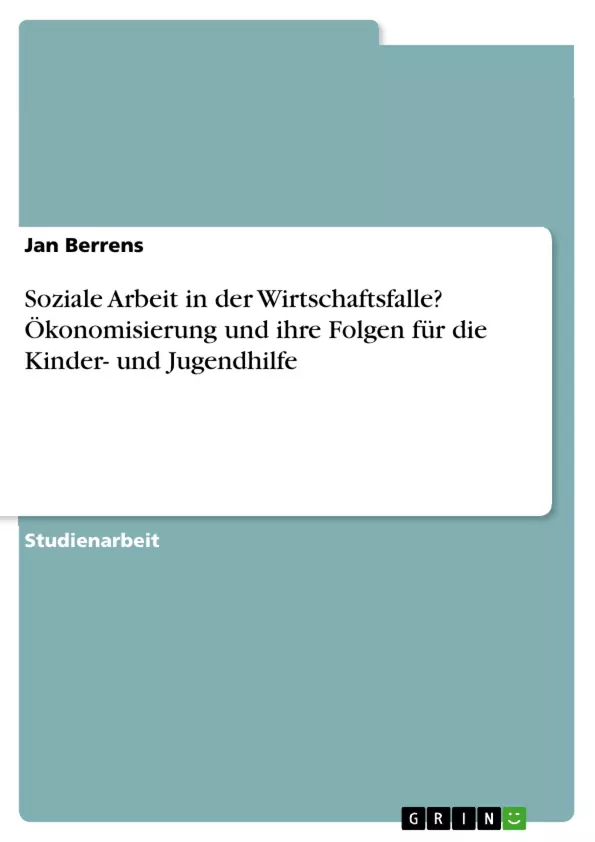Inwieweit hat eine zunehmende Ökonomisierung Einfluss auf die Ausgestaltungen von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe und versetzt der übergeordnete Blick auf die Effizienz des Handelns die Akteure in eine eingeschränkte Position? In der nachfolgenden Arbeit soll diese Frage beantworten und die Hypothese verfolgt werden, dass Soziale Arbeit aktiv an der Ökonomisierung der Gesellschaft mitwirkt und der ökonomische Gedanke in der Klientenarbeit nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklungspotentiale hat.
Um sich einer Beantwortung der Fragestellung zu nähern und der Hypothese auf den Grund zu gehen, werden in der Folge neben der Begriffsbestimmung der Ökonomisierung die Ursachen und Folgen eben dieser thematisiert. Weitere Aspekte sind die Fokussierung auf das neue Steuerungsmodell sowie ein Blick auf die Auswirkungen in der Praxis. Ein Fazit soll die gewonnen Erkenntnisse mit der Beantwortung der Ausgangsfrage und einem möglichen Ausblick abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ursachen und Folgen der Ökonomisierung
- 3. Das neue Steuerungsmodell (NSM)
- 4. Ökonomisierung in der Praxis der Hilfen zur Erziehung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Kinder- und Jugendhilfe. Sie analysiert die Ursachen und Folgen dieser Entwicklung und betrachtet das neue Steuerungsmodell (NSM) sowie die konkreten Auswirkungen in der Praxis. Ziel ist es, herauszufinden, ob Soziale Arbeit aktiv an der Ökonomisierung der Gesellschaft mitwirkt und inwiefern der ökonomische Gedanke in der Klientenarbeit nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklungspotentiale hat.
- Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit
- Ursachen und Folgen der Ökonomisierung
- Das neue Steuerungsmodell (NSM)
- Ökonomisierung in der Praxis der Hilfen zur Erziehung
- Einfluss auf die Entwicklungspotentiale von Klienten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie zeigt auf, wie die Fokussierung auf finanzielle Faktoren die Soziale Arbeit beeinflusst und die Bedeutung von Kosteneinsparungen und Effizienz betont.
2. Ursachen und Folgen der Ökonomisierung
Dieses Kapitel erläutert die Begrifflichkeit der Ökonomisierung und setzt sie in den Kontext der Sozialen Arbeit. Es beschreibt die Unterschiede zwischen Effizienz und Effektivität und analysiert die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Praxis der Sozialen Arbeit. Insbesondere werden die Entstehung des neuen Steuerungsmodells und die Auswirkungen der Neuregelungen in §§78a SGB VIII betrachtet.
3. Das neue Steuerungsmodell (NSM)
Dieses Kapitel fokussiert auf das neue Steuerungsmodell (NSM) und untersucht seine Rolle im Kontext der Ökonomisierung. Es analysiert die Veränderungen im Bereich der Sozialen Arbeit, die durch die Einführung des NSM entstanden sind, und beleuchtet die Auswirkungen auf die Steuerung und Finanzierung sozialer Leistungen.
4. Ökonomisierung in der Praxis der Hilfen zur Erziehung
Dieses Kapitel widmet sich der konkreten Umsetzung der Ökonomisierung in der Praxis der Hilfen zur Erziehung. Es beleuchtet die Auswirkungen auf die sozialpädagogische Arbeit und die Herausforderungen, die sich für die Fachkräfte ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Ökonomisierung, Effizienz, Effektivität, neues Steuerungsmodell (NSM), Hilfen zur Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe, Kostenmanagement, Qualitätssicherung, Wirkungsmessung und Ressourcenmanagement. Sie beleuchtet den Einfluss der Ökonomisierung auf die Praxis der Sozialen Arbeit und die Auswirkungen auf die Entwicklungspotentiale von Klienten.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Ökonomisierung“ in der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt den zunehmenden Einfluss von wirtschaftlichen Prinzipien wie Effizienz, Wettbewerb und Kostenkontrolle auf soziale Dienstleistungen.
Was ist das „Neue Steuerungsmodell“ (NSM)?
Das NSM überträgt betriebswirtschaftliche Steuerungselemente auf die öffentliche Verwaltung und soziale Dienste, um Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu steigern.
Wie beeinflusst die Ökonomisierung die Hilfen zur Erziehung?
Durch Kostendruck und Wirkungsmessung besteht die Gefahr, dass pädagogische Ziele hinter finanziellen Einsparungen zurückstehen müssen.
Wirkt Soziale Arbeit aktiv an der Ökonomisierung mit?
Die Arbeit verfolgt die Hypothese, dass Akteure der Sozialen Arbeit durch die Übernahme ökonomischer Logiken ungewollt zur Ökonomisierung der Gesellschaft beitragen.
Was ist der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität?
Effizienz fragt nach dem optimalen Mitteleinsatz (die Dinge richtig tun), während Effektivität fragt, ob die Ziele überhaupt erreicht werden (die richtigen Dinge tun).
- Quote paper
- Jan Berrens (Author), 2022, Soziale Arbeit in der Wirtschaftsfalle? Ökonomisierung und ihre Folgen für die Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1239960