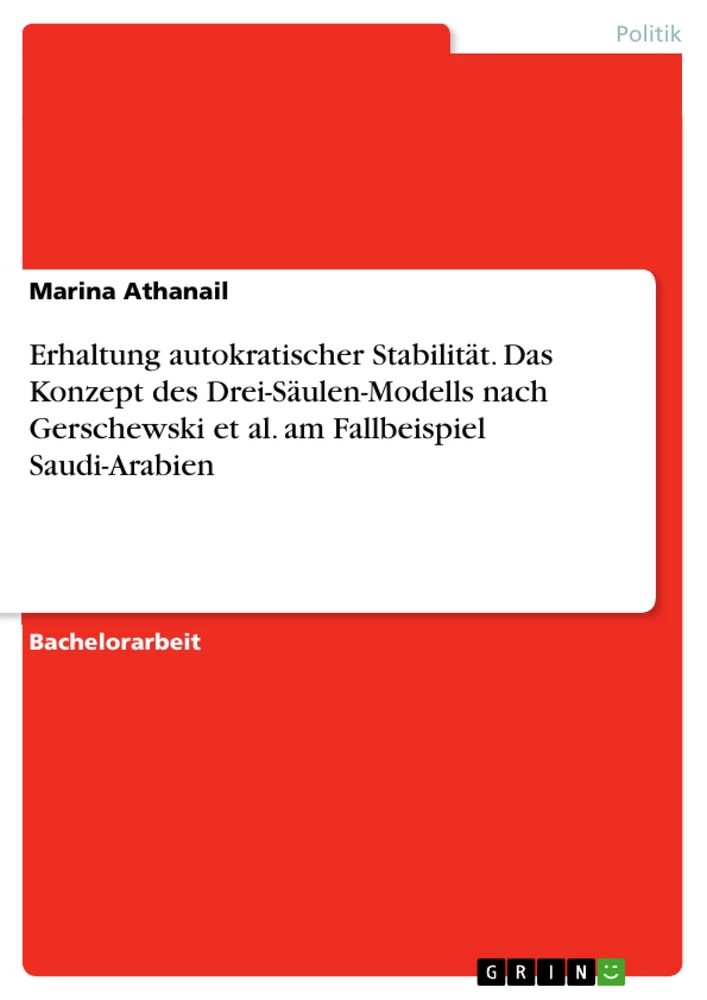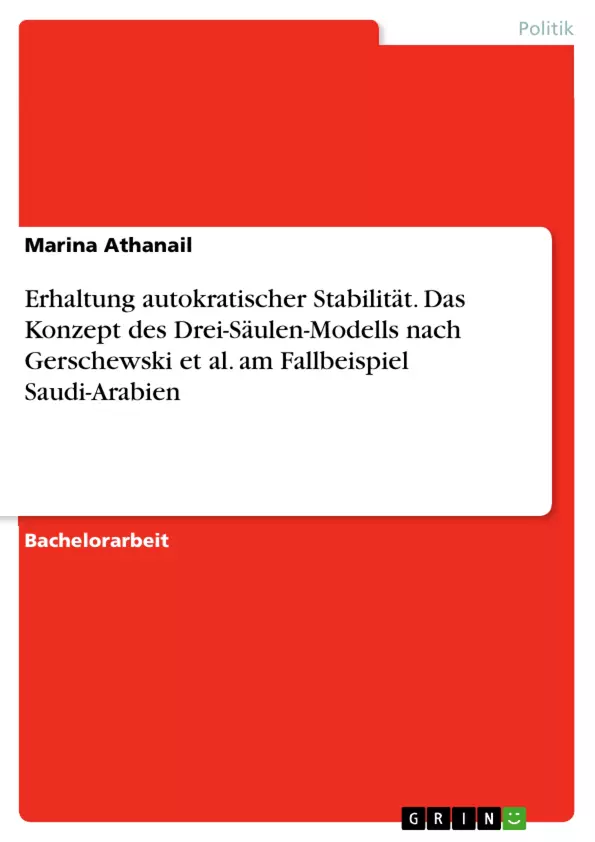Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin zu untersuchen, wodurch das autoritäre Regime Saudi-Arabien in der heutigen Zeit seine Stabilität wahren kann. Dabei basiert die Untersuchung auf dem Drei-Säulen-Modell autokratischer Stabilität von Gerschewski et al.
Im ersten Abschnitt wird dieses Modell erklärt und seine Entwicklung aufgezeigt. Dabei werden nicht nur die drei Säulen im Einzelnen erläutert, sondern auch ihre Beziehung zueinander aufgezeigt und ihre Messbarkeit beschrieben. Nachdem ein fundierter theoretischer Rahmen geschaffen wurde, besteht der nächste Schritt darin, das Fallbeispiel vorzustellen. In diesem Schritt wird das politische System Saudi-Arabiens und dessen historische Entwicklung erörtert. Im weiteren Verlauf soll dann das Modell von Gerschewski et al. auf Saudi-Arabien angewendet werden. Dafür wird jede Säule anhand empirischer Indizes auf Saudi-Arabien übertragen und analysiert. Aus den Ergebnissen kann dann das Zusammenwirken der drei Säulen abgeleitet werden. Im Abschluss des empirischen Teils wird festgestellt, ob, und wenn ja, inwiefern Saudi-Arabien seine Stabilität erhält. Die Ergebnisse werden schließlich in einem Fazit mit Blick auf die Zukunft resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Drei-Säulen-Modell
- 2.1. Entstehungskontext des Modells
- 2.2. Das Konzept des Drei-Säulen-Modells
- 2.2.1. Die Legitimationssäule
- 2.2.2. Die Repressionssäule
- 2.2.3. Die Kooptationssäule
- 2.3. Der Stabilisierungsprozess
- 2.4. Der Destabilisierungsprozess
- 3. Das Fallbeispiel Saudi-Arabien
- 3.1. Historischer Hintergrund Saudi-Arabiens
- 3.2. Das politische System Saudi-Arabiens
- 4. Anwendung des Drei-Säulen-Modells auf Saudi-Arabien
- 4.1. Legitimation in Saudi-Arabien
- 4.2. Repression in Saudi-Arabien
- 4.3. Kooptation in Saudi-Arabien
- 4.4. Die Stabilisierungsprozesse der drei Säulen in Saudi-Arabien
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stabilität des autoritären Regimes Saudi-Arabiens anhand des Drei-Säulen-Modells autokratischer Stabilität von Gerschewski et al. Ziel ist es, die Faktoren zu identifizieren, die zur Aufrechterhaltung der Macht des saudischen Königshauses beitragen.
- Das Drei-Säulen-Modell autokratischer Stabilität
- Die Legitimationsstrategien des saudischen Regimes
- Die Rolle von Repression im Erhalt der Stabilität
- Mechanismen der Kooptation in Saudi-Arabien
- Die Interaktion der drei Säulen im Kontext Saudi-Arabiens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Autokratieforschung und der Bedeutung der Untersuchung autokratischer Stabilität ein. Sie betont den Rückgang der globalen Freiheit und den damit verbundenen Anstieg autokratischer Regime. Der Fokus liegt auf dem Drei-Säulen-Modell als neuem Ansatz zur Erklärung autokratischer Stabilität und die Auswahl Saudi-Arabiens als Fallbeispiel aufgrund seiner bemerkenswerten Beständigkeit trotz regionaler Instabilität wird begründet. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik der Untersuchung.
2. Das Drei-Säulen-Modell: Dieses Kapitel erläutert das Drei-Säulen-Modell autokratischer Stabilität. Es beschreibt den Entstehungskontext des Modells, die einzelnen Säulen (Legitimation, Repression, Kooptation) mit ihren Mikro- und Makrodimensionen, den Stabilisierungsprozess und den Destabilisierungsprozess. Das Modell wird als Heuristik vorgestellt, die es ermöglicht, die Stabilität autokratischer Regime empirisch zu untersuchen.
3. Das Fallbeispiel Saudi-Arabien: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den historischen Hintergrund und das politische System Saudi-Arabiens. Es beleuchtet die Herausforderungen, vor denen das Land aufgrund seiner strengen religiösen Auslegung und der modernen Außenpolitik steht, und die Bedrohungen durch islamistischen Terrorismus und den Arabischen Frühling. Der Abschnitt legt den Grundstein für die anschließende Anwendung des Drei-Säulen-Modells.
4. Anwendung des Drei-Säulen-Modells auf Saudi-Arabien: In diesem Kapitel wird das Drei-Säulen-Modell auf Saudi-Arabien angewendet. Es analysiert die einzelnen Säulen – Legitimation, Repression und Kooptation – anhand empirischer Indikatoren und untersucht, wie diese Säulen zum Erhalt der Stabilität des saudischen Regimes beitragen. Die Interaktion der drei Säulen wird beleuchtet und deren Zusammenwirken im Kontext der saudischen Politik untersucht.
Schlüsselwörter
Autokratische Stabilität, Drei-Säulen-Modell, Saudi-Arabien, Legitimation, Repression, Kooptation, Arabischer Frühling, Islamistischer Terrorismus, Politisches System, Empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse der Stabilität des saudischen Regimes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Stabilität des autoritären Regimes Saudi-Arabiens. Der Fokus liegt auf der Anwendung des Drei-Säulen-Modells autokratischer Stabilität, um die Faktoren zu identifizieren, die zur Aufrechterhaltung der Macht des saudischen Königshauses beitragen.
Welches Modell wird verwendet?
Die Analyse basiert auf dem Drei-Säulen-Modell autokratischer Stabilität von Gerschewski et al. Dieses Modell betrachtet Legitimation, Repression und Kooptation als drei zentrale Säulen der Stabilität autokratischer Regime.
Welche Säulen werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit analysiert jede der drei Säulen – Legitimation, Repression und Kooptation – im Kontext Saudi-Arabiens. Es werden empirische Indikatoren verwendet, um zu untersuchen, wie diese Säulen zum Erhalt der Stabilität des saudischen Regimes beitragen und wie sie miteinander interagieren.
Wie wird Saudi-Arabien als Fallbeispiel betrachtet?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den historischen Hintergrund und das politische System Saudi-Arabiens, einschließlich der Herausforderungen durch strenge religiöse Auslegung, moderne Außenpolitik, islamistischen Terrorismus und den Arabischen Frühling. Dieser Hintergrund dient als Basis für die Anwendung des Drei-Säulen-Modells.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, das Drei-Säulen-Modell (inklusive Entstehung, Konzept und Stabilisierungs-/Destabilisierungsprozesse), das Fallbeispiel Saudi-Arabien (historischer Hintergrund und politisches System), die Anwendung des Drei-Säulen-Modells auf Saudi-Arabien und abschließend Fazit und Ausblick.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Faktoren zu identifizieren, die zur Aufrechterhaltung der Macht des saudischen Königshauses beitragen. Sie untersucht, wie die drei Säulen des Modells – Legitimation, Repression und Kooptation – in Saudi-Arabien funktionieren und zur Stabilität des Regimes beitragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Autokratische Stabilität, Drei-Säulen-Modell, Saudi-Arabien, Legitimation, Repression, Kooptation, Arabischer Frühling, Islamistischer Terrorismus, Politisches System, Empirische Analyse.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Analyse, um die Anwendung des Drei-Säulen-Modells auf Saudi-Arabien zu untersuchen. Die genauen Methoden werden im Text detailliert beschrieben.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für die akademische Nutzung bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Citation du texte
- Marina Athanail (Auteur), 2018, Erhaltung autokratischer Stabilität. Das Konzept des Drei-Säulen-Modells nach Gerschewski et al. am Fallbeispiel Saudi-Arabien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1239998