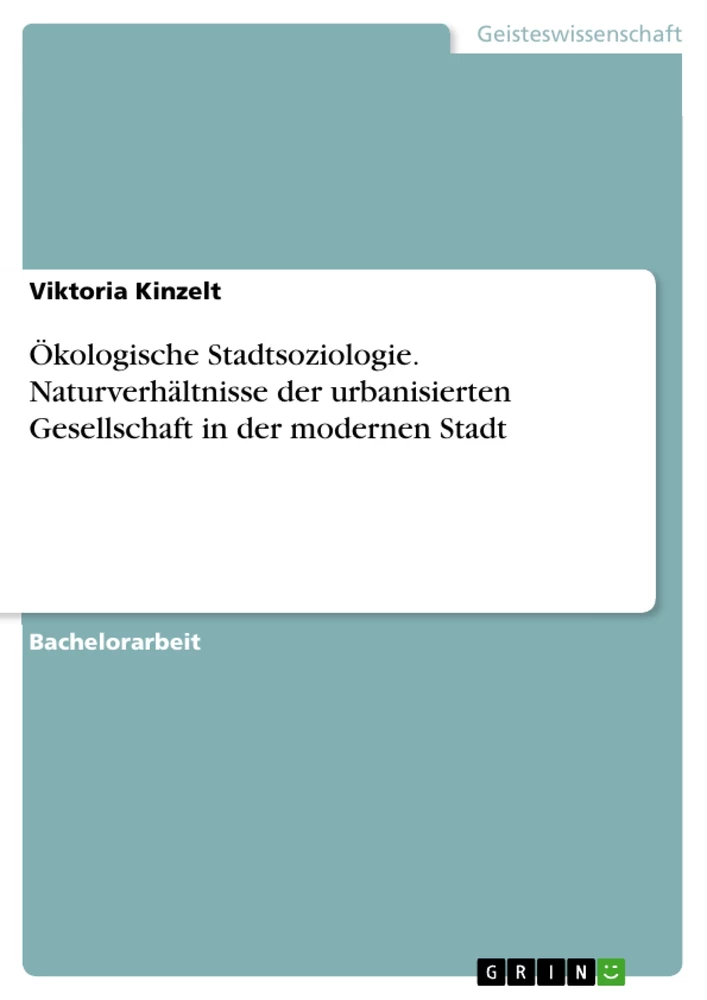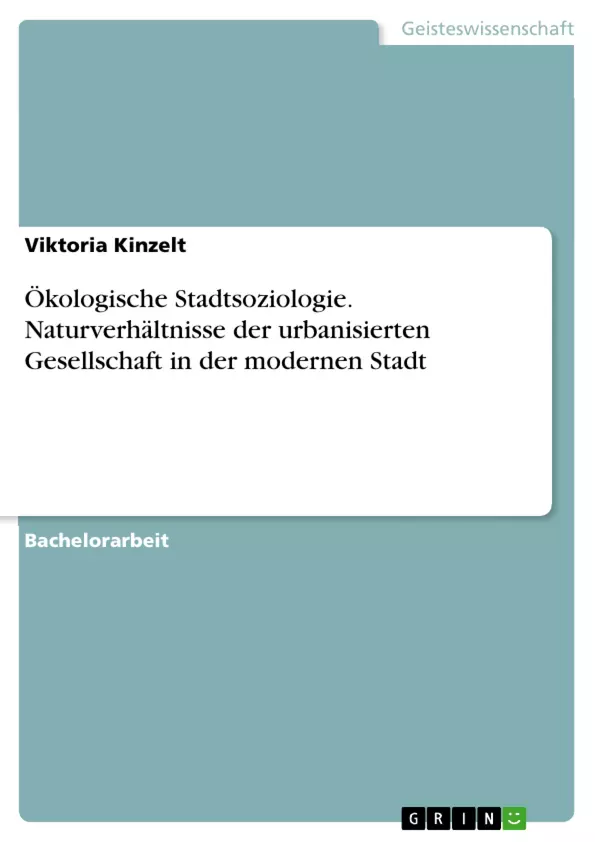Die Arbeit wird sich mit der Frage beschäftigen, welche Naturverhältnisse und -wahrnehmungen sich für die urbanisierte Gesellschaft in der modernen Stadt bestimmen lassen und welche Bedeutung diese für eine nachhaltige Stadtentwicklung im ökologischen Kontext haben.
Geht man von den Betrachtungen der Urgeschichte der Soziologie aus, so hätte der Wunsch bestanden, eine stringente Trennung zwischen der Natur und dem Sozialen vorzunehmen. Die Natur wird, mit dem vielzitierten Grundsatz des „sozialen Tatbestand“ von Durkheim, der besagt, „Soziales kann nur durch Soziales, nicht durch Natur erklärt werden“ (Reusswig, 2017), zu einer methodischen Bedingung der soziologischen Wissenschaft verbannt.
Eine Wiedergutmachung an die Natur hat die Soziologie mit der Akteur-Netzwerk-Theorie von Latour (1998) geleistet. Dabei wurden Artefakte und Naturobjekte als Aktanten angesehen. Für die Erklärung sozialer Tatbestände wurde somit der Umwelt und Naturobjekten wieder eine konstitutive Rolle eingeräumt. Wie genau das „Zurückbringen des Naturbegriffs“ dabei geschehen kann, ist vorerst unklar. Die Wissenschaft arbeitet sich in ihren verschiedenen Disziplinen daran ab. Das daraus hervorgegangene Konzept der Nachhaltigkeit ist ein naheliegendes. Für die einen handelt es sich um eine Blase, die zu reiner Augenwischerei führt. Für andere ist es eine brauchbare Idee zur Regulierung der Zukunft.
Das Problem der Natur bleibt für die Soziologie vor diesem Hintergrund vorerst weiterhin bestehen, denn die gesellschaftlichen Naturverhältnisse erschöpfen sich nicht ausschließlich in dem, was die Naturwissenschaften darüber zu sagen hat, so wichtig es auch sein mag. Hinter den verschiedenen Bereichen der Umweltkrise zeigt sich, dass durch die Übernutzung der Gemeingüter die Kapitalerträge erhöht werden, obwohl der Spielraum der Ressourcen gleichzeitig schwindet [...]
Sucht man nach den Naturverhältnissen in der stadtsoziologischen Literatur, so wird man hier schnell feststellen, dass nur in den seltensten Fällen ein Kapitel darüber geschrieben wurde. Wenn dies doch geschieht, sind diese Kapitel häufig kurz und knapp und informieren lediglich über die Missstände dieser Thematik im Kontext der Stadtanalyse (Ipsen, 2000). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung und Relevanz des Forschungsvorhabens
- Fragestellung, Aufbau und Zielsetzung
- Kontext Stadt
- Stadt als Hybrid - Die Chicagoer-Schule
- Stadtentwicklung - Die Instrumentalisierung der Natur
- Umweltprobleme - Die Projekte der modernen Stadt
- Ökologisch
- Ökonomisch
- Soziopolitisch
- Die Dialektik der Teilprojekte
- Stadt ist Natur? - Die Metabolismustheorie
- Natur der Gesellschaft
- Gesellschaft ist Natur? - Die Stoffwechseltheorie
- Naturverhältnisse im Wandel
- Naturwahrnehmung der urbanisierten Gesellschaft
- Fragmentierung des Umweltbewusstseins
- Natur- und Umweltbewusstseinsstudien
- Nachhaltige Stadtentwicklung
- Warum Nachhaltigkeit in der Stadt?
- Magisches Viereck
- Ökologie
- Ökonomie
- Soziales
- Kultur
- Politische Stadtökologie
- Wahrnehmungsöffnung
- Stadt-Landschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis von Natur und urbanisierter Gesellschaft in der modernen Stadt. Im Fokus steht die Frage, wie Naturverhältnisse und -wahrnehmungen in der Stadtlandschaft geprägt sind und welche Bedeutung diese für eine nachhaltige Stadtentwicklung haben. Die Arbeit analysiert die Instrumentalisierung der Natur im Zuge der Verstädterung und die Herausforderungen, die sich aus den Umweltproblemen der Stadt ergeben.
- Entwicklung und Bedeutung von Naturverhältnissen in der urbanisierten Gesellschaft
- Kritische Betrachtung der Instrumentalisierung der Natur in der Stadtentwicklung
- Analyse der Umweltprobleme der Stadt und deren sozioökonomische und politische Dimensionen
- Erforschung von Ansätzen zur nachhaltigen Stadtentwicklung im ökologischen Kontext
- Wahrnehmungsöffnung und die Rolle von Naturwahrnehmung für eine nachhaltige Stadtentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik "Naturverhältnisse in der Stadt" dar und skizziert die Problematik der bisherigen Stadtsoziologie, die die Natur oft als einen externen Faktor betrachtet.
- Kontext Stadt: Dieses Kapitel beleuchtet die Stadt als einen hybriden Raum, der sowohl von sozialen als auch von natürlichen Bedingungen geprägt ist. Die Chicagoer-Schule und die Entwicklung der Stadtsoziologie werden vorgestellt, sowie die Instrumentalisierung der Natur im Zuge der Stadtentwicklung.
- Natur der Gesellschaft: Hier wird der Wandel der Naturverhältnisse in der Gesellschaft analysiert. Die Stoffwechseltheorie von Bernd Hamm wird vorgestellt und die Wahrnehmung der Natur durch die urbanisierte Gesellschaft beleuchtet.
- Nachhaltige Stadtentwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit und den Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Es beleuchtet das magische Viereck (Ökologie, Ökonomie, Soziales, Kultur) und die Rolle der politischen Stadtökologie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Umweltsoziologie, der Stadtentwicklung und der Nachhaltigkeit. Wichtige Schlagwörter sind: Naturverhältnisse, Stadtentwicklung, Umweltprobleme, nachhaltige Stadtplanung, Metabolismustheorie, Wahrnehmungsöffnung, Stadt-Landschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ökologische Stadtsoziologie?
Sie untersucht das Verhältnis zwischen der urbanisierten Gesellschaft und ihrer natürlichen Umwelt, insbesondere wie Natur in der modernen Stadt wahrgenommen, instrumentalisiert und in die Planung integriert wird.
Was besagt die Metabolismustheorie im städtischen Kontext?
Diese Theorie betrachtet die Stadt als einen Organismus mit einem Stoffwechsel: Sie nimmt Ressourcen auf, wandelt sie um und gibt Abfallprodukte ab. Dies ist zentral für das Verständnis städtischer Nachhaltigkeit.
Warum wurde Natur in der frühen Soziologie vernachlässigt?
Nach Durkheim sollte Soziales nur durch Soziales erklärt werden. Erst moderne Ansätze wie die Akteur-Netzwerk-Theorie geben Naturobjekten wieder eine konstitutive Rolle für soziale Tatbestände.
Was ist das „magische Viereck“ der nachhaltigen Stadtentwicklung?
Es beschreibt das Gleichgewicht zwischen vier Dimensionen: Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur, die alle für eine zukunftsfähige Stadtplanung berücksichtigt werden müssen.
Wie beeinflusst die Stadtlandschaft unser Umweltbewusstsein?
Die Fragmentierung der Natur im urbanen Raum führt zu einer spezifischen Naturwahrnehmung, die oft zwischen Idealisierung und der Nutzung als reine Kulisse schwankt.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Viktoria Kinzelt (Author), 2021, Ökologische Stadtsoziologie. Naturverhältnisse der urbanisierten Gesellschaft in der modernen Stadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1240142