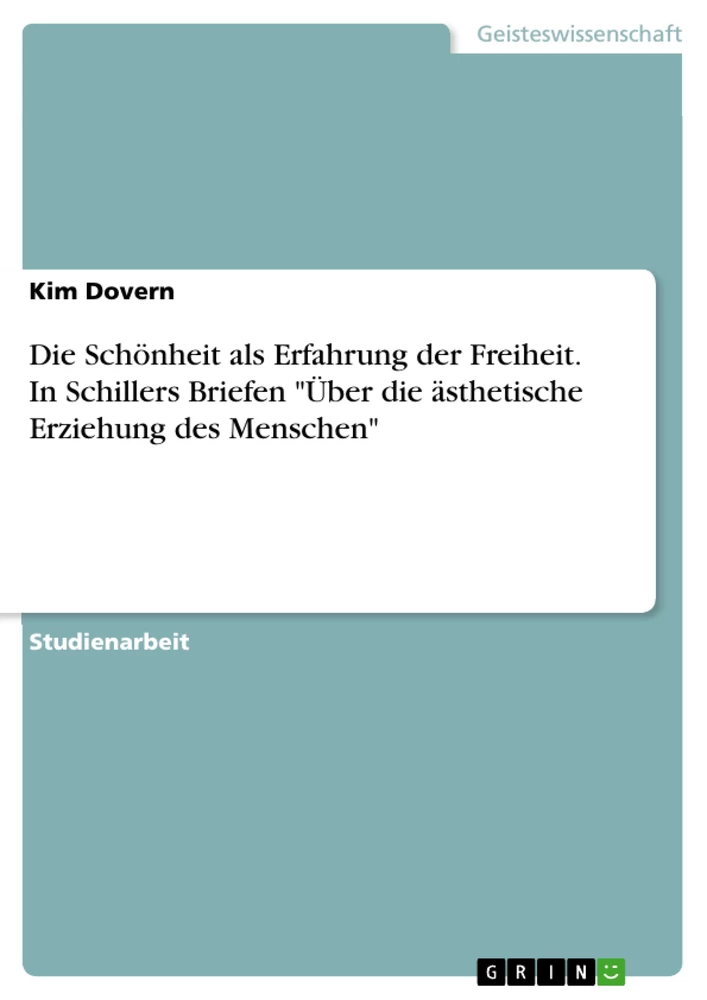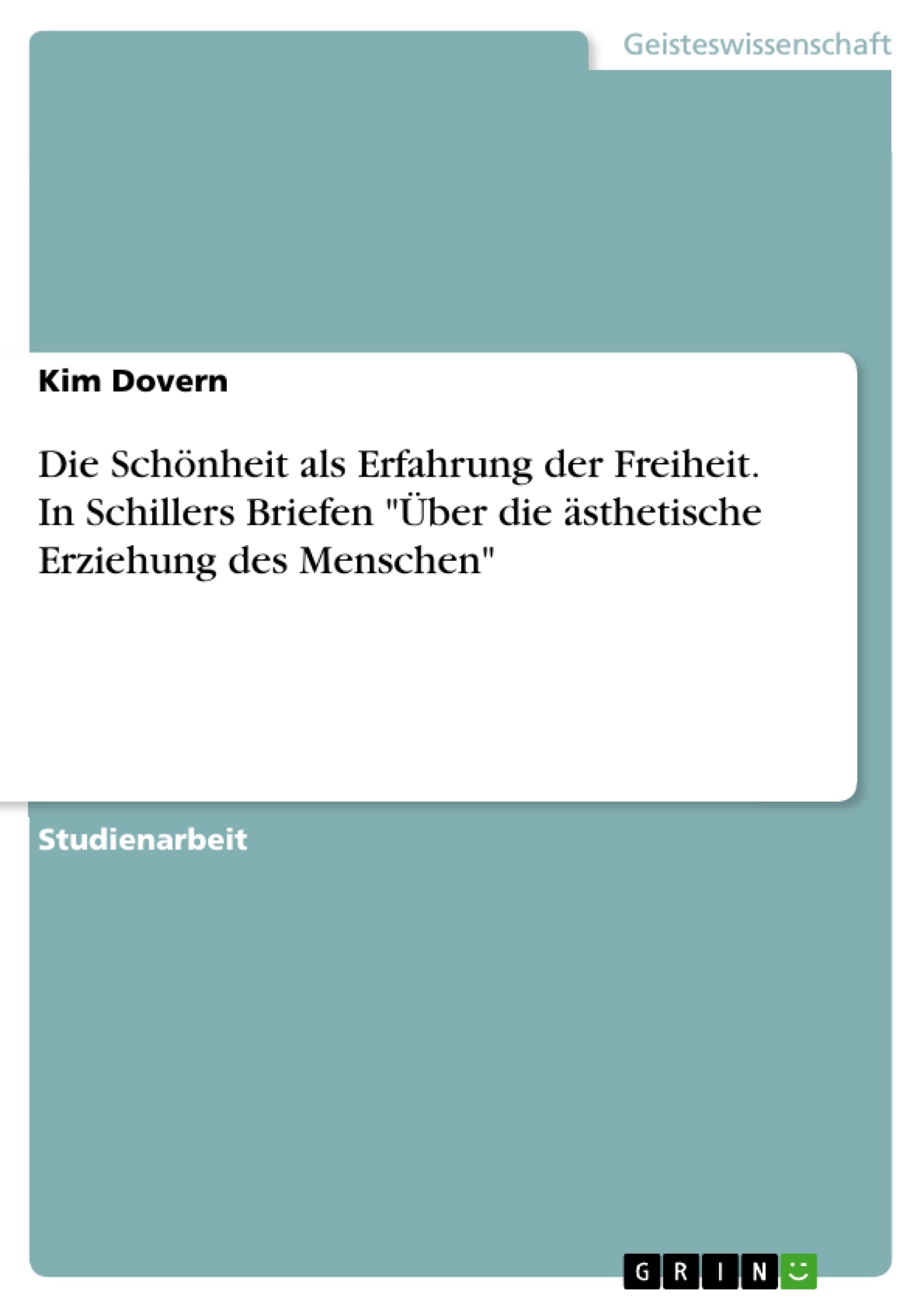Das Thema der vorliegenden Hausarbeit ist die Ausarbeitung von Schillers Theorie der ästhetischen Erziehung
mithilfe seiner Briefe "Über die ästhetische Erziehung des Menschen“. Hauptfragen, die beleuchtet werden, sind: In welcher Beziehung stehen Schönheit und Freiheit zueinander und wie ist der Zusammenhang vom Schönen und der Kunst? Schillers Theorie über die ästhetische Erziehung des Menschen ist bis heute relevant, da die zunehmend negative Veränderung der Gesellschaft, die er so beklagt, bis heute stattfindet.
Das Hauptproblem sind die Entindividualisierung und der rasante Fortschritt seit Beginn der Industrialisierung. Der
Einzelne geht immer mehr in der Masse der Allgemeinheit unter, da der Fortschritt der Menschheit höher gewertet wird als die Verwirklichung des Einzelnen.
Zu Anfang wird das Thema in einen geschichtlichen Rahmen gesetzt, da die Briefe vermutlich einen politischen Entstehungskontext haben. Dadurch bekommt man einen Einblick in Schillers Zeitalter und die Hauptthemen, die dieses kennzeichneten, wie die Französische Revolution. Im Fokus steht dabei Schillers Zivilisationskritik in Zusammenhang mit dem Terror zu Zeiten der Revolution sowie deren Ziele und mangelhafte Umsetzung, welche er beklagt und woraus
er Verbesserungsvorschläge für seine eigene Theorie ableitet.
Dann wird Schillers Ideal einer Gesellschaft vorgestellt, um die starke Veränderung der Gesellschaft der Antike bis hin zu Schillers Zeitalter herauszustellen. Im Anschluss gehen wir von der Zivilisationskritik in Bezug auf die Revolution über zu Schillers Theorie, die diese Zivilisationskritik aufgreift mit den Begriffen "fehlende" und "verdorbene Zivilisation" sowie "Wilder" und "Barbar". Dann folgt eine genaue Betrachtung von Schillers Kunstideal und seinem Schönheitsbegriff. Im Folgenden wird die sogenannte "Doppelnatur des Menschen", bestehend aus Spiel- und Stofftrieb erklärt und erweitert um die Begriffe des "Spieltriebs", der die entgegengesetzten Naturen des Menschen versöhnen soll, und des "ästhetischen Zustands", der Zielzustand den es zu erreichen gilt, um durch die Schönheit zur Freiheit zu gelangen. Darauf folgend erläutert diese Arbeit den Freiheitsbegriff nach Schiller. Zum Ende der Hausarbeit wird Schillers Theorie auf die Staatsebene ausgeweitet: Ist der "ästhetische Staat" Ideal, Utopie oder eine reale Erfahrung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schillers Zeitalter: Seine Zivilisationskritik
- Antike als Idealform der Gesellschaft
- Schiller inmitten fehlender oder verdorbener Zivilisation
- Vom Wilden und Barbaren hin zum gebildeten Menschen
- Lösungsansatz: Ausbildung des Empfindungsvermögens
- Schillers Kunstideal und Schönheitsbegriff
- Die Doppelnatur des Menschen: Stofftrieb und Formtrieb
- Der Spieltrieb und der ästhetische Zustand
- Schillers Freiheitsbegriff
- Der ästhetische Staat: Ideal, Utopie oder reale Erfahrung?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Friedrich Schillers Theorie der ästhetischen Erziehung, wie sie in seinen Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ dargelegt wird. Das zentrale Anliegen ist die Erforschung des Zusammenhangs zwischen Schönheit und Freiheit und die Rolle der Kunst in diesem Kontext. Schillers Kritik an der Französischen Revolution und sein Ideal einer harmonischen Gesellschaft bilden den Hintergrund der Analyse.
- Schillers Zivilisationskritik und die Französische Revolution
- Das Ideal der antiken Gesellschaft und seine Relevanz für Schiller
- Schillers Konzept der „Doppelnatur des Menschen“ (Stofftrieb und Formtrieb)
- Die Bedeutung des Spieltriebs und des ästhetischen Zustands für die Erlangung der Freiheit
- Der ästhetische Staat als Ideal, Utopie oder reale Möglichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: Durch die Erfahrung der Schönheit erlangen wir die Freiheit. Sie skizziert die Hauptfragen, die im weiteren Verlauf behandelt werden, und betont die bis heute bestehende Relevanz von Schillers Theorie angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen wie Entindividualisierung und rasanter Fortschritt.
Schillers Zeitalter: Seine Zivilisationskritik: Dieses Kapitel analysiert den politischen Kontext der Entstehung von Schillers Briefen, insbesondere den Einfluss des Terrors während der Französischen Revolution. Schillers Kritik richtet sich nicht gegen die Ideale der Revolution, sondern gegen deren Umsetzung und die daraus resultierenden negativen Folgen. Er analysiert das Scheitern der Revolution als Ergebnis einer unreifen Gesellschaft, die nicht ausreichend auf die Freiheit vorbereitet war und die existenzielle Grundlage ihrer Bürger vernachlässigt hat. Schillers Analyse des „gebrochenen Bewusstseins“ des modernen Menschen, zerrissen zwischen Verstand und Gefühl, wird hier eingeführt.
Antike als Idealform der Gesellschaft: Dieses Kapitel untersucht Schillers Rückgriff auf die griechische Antike als Idealmodell einer Gesellschaft im Gegensatz zur negativen Entwicklung seiner Gegenwart. Die Simplizität des antiken Lebens und der menschlichen Kultur wird als Kontrast zur Komplexität und den Problemen der Gesellschaft der Französischen Revolution hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Ästhetische Erziehung, Schönheit, Freiheit, Zivilisationskritik, Französische Revolution, Antike, Doppelnatur des Menschen, Stofftrieb, Formtrieb, Spieltrieb, ästhetischer Zustand, gebrochenes Bewusstsein, Idealstaat.
Häufig gestellte Fragen zu Friedrich Schillers Ästhetischer Erziehung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Theorie der ästhetischen Erziehung, insbesondere seine Briefe „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Schönheit und Freiheit sowie der Rolle der Kunst in diesem Kontext. Schillers Kritik an der Französischen Revolution und sein Ideal einer harmonischen Gesellschaft bilden den Hintergrund der Analyse.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Schillers Zivilisationskritik im Kontext der Französischen Revolution, sein Ideal der antiken Gesellschaft, sein Konzept der „Doppelnatur des Menschen“ (Stofftrieb und Formtrieb), die Bedeutung des Spieltriebs und des ästhetischen Zustands für die Freiheit, und schließlich den ästhetischen Staat als Ideal, Utopie oder reale Möglichkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Schillers Zeitalter und Zivilisationskritik, die Antike als Ideal, Schillers Kunstideal und Schönheitsbegriff, die Doppelnatur des Menschen, den Spieltrieb und den ästhetischen Zustand, Schillers Freiheitsbegriff, den ästhetischen Staat und ein Schlusswort. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Welche zentrale These vertritt die Arbeit?
Die zentrale These ist, dass wir durch die Erfahrung der Schönheit Freiheit erlangen. Die Arbeit untersucht, wie Schiller diese These in seinen Schriften begründet und welche Relevanz sie für heutige gesellschaftliche Herausforderungen hat.
Welche Rolle spielt die Französische Revolution in Schillers Theorie?
Schillers Kritik an der Französischen Revolution konzentriert sich nicht auf ihre Ideale, sondern auf deren Umsetzung und die daraus resultierenden negativen Folgen. Er sieht das Scheitern der Revolution als Ergebnis einer unreifen Gesellschaft, die nicht ausreichend auf Freiheit vorbereitet war. Die Revolution dient als Hintergrund für seine Theorie der ästhetischen Erziehung.
Welche Bedeutung hat die Antike für Schillers Denken?
Schiller sieht in der griechischen Antike ein Idealmodell einer harmonischen Gesellschaft im Gegensatz zu den Problemen seiner Zeit. Die Simplizität des antiken Lebens und der Kultur wird als Kontrast zur Komplexität und den Problemen der Gesellschaft während der Französischen Revolution hervorgehoben.
Was ist Schillers Konzept der „Doppelnatur des Menschen“?
Schillers „Doppelnatur des Menschen“ besteht aus Stofftrieb und Formtrieb. Die Arbeit untersucht, wie diese beiden Triebkräfte im Menschen interagieren und wie durch die ästhetische Erziehung ein harmonisches Verhältnis zwischen ihnen erreicht werden kann.
Welche Rolle spielen Spieltrieb und ästhetischer Zustand in Schillers Theorie?
Der Spieltrieb und der ästhetische Zustand sind zentrale Elemente in Schillers Theorie. Sie ermöglichen es dem Menschen, sich von den Zwängen des Stofftriebs zu befreien und seine Freiheit zu verwirklichen.
Was versteht Schiller unter dem „ästhetischen Staat“?
Der „ästhetische Staat“ ist ein zentrales Konzept in Schillers Theorie, das als Ideal, Utopie oder reale Möglichkeit diskutiert wird. Die Arbeit untersucht, ob und wie ein solcher Staat erreicht werden kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ästhetische Erziehung, Schönheit, Freiheit, Zivilisationskritik, Französische Revolution, Antike, Doppelnatur des Menschen, Stofftrieb, Formtrieb, Spieltrieb, ästhetischer Zustand, gebrochenes Bewusstsein, Idealstaat.
- Quote paper
- Kim Dovern (Author), 2019, Die Schönheit als Erfahrung der Freiheit. In Schillers Briefen "Über die ästhetische Erziehung des Menschen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1240191