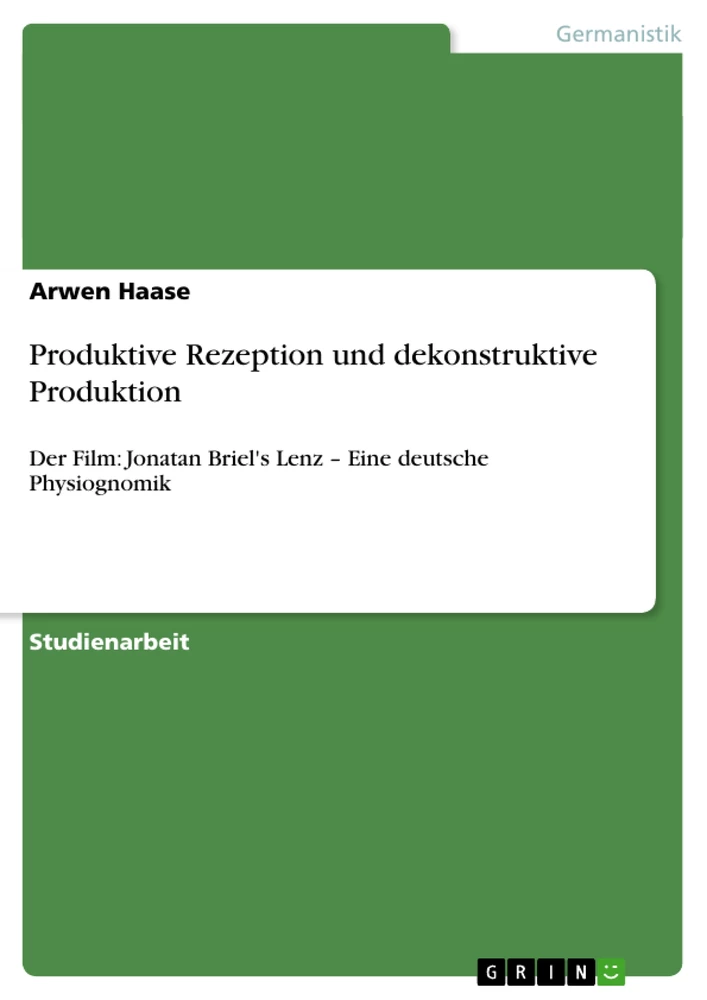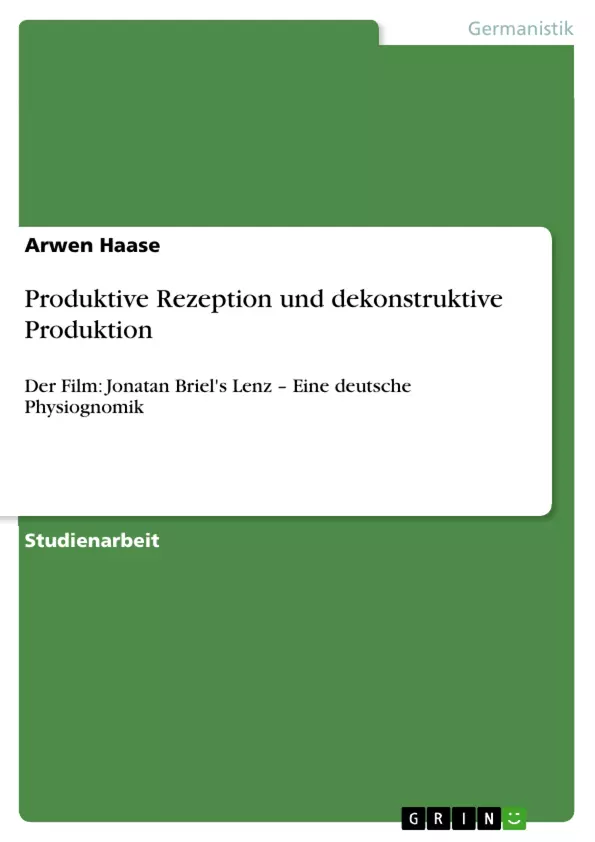Ob auf historisch getreue oder freie, abstrakte und im Kontext ihrer Zeit „moderne“ Art und Weise wurde der Stoff um die historische Figur des Sturm- und Drangdichters Jacob Michael Reinhold Lenz schon mehrfach zu Filmen wie LENZ – ICH ABER WERDE DUNKEL SEIN von Egon Günther (1992) oder LENZ von Thomas Imbach (2006) verwoben. Im Gegensatz zu LENZ von George Moorse (1971), der mit zahlreichen Filmpreisen ausgezeichnet wurde, ist JONATAN BRIEL’S LENZ – EINE DEUTSCHE PHYSIOGNOMIK aus demselben Jahr dem Schicksal der Vergessenheit ausgeliefert. Zieht man Bilanz der Rezensionen aus dem Jahr 1971, als der Film im Nachtprogramm des ZDFs zu sehen war, kommt man zu dem Schluss, dass die KritikerInnen mit Briels Film mangels Vorwissen oder Kenntnisse über das Thema und seine Hintergründe wenig anfangen konnten. Briels Lenz-Film, denn als Verfilmung kann man ihn wohl kaum bezeichnen, muss als Versuch und nicht als abgeschlossenes Werk begriffen werden. Es ist kein Film über Lenz, sondern im Geiste von Lenz. Er kann nicht unter dem Genre Literaturverfilmung subsumiert werden, denn er ist weder eine Adaption von Georg Büchners Lenz-Novelle noch Peter Schneiders Neubearbeitung Lenz. Vielmehr ist der Film eine biographische, literarische und transtextuelle Annäherung des Regisseurs Briel an Gestalt und Persönlichkeit von J. M. R. Lenz mit Referenz auf die deutsche Geschichte und Gesellschaft. Das Kommunikat verfolgt politische, soziale und ästhetische Interessen und verweigert sich durch Einsatz zahlreicher Verfremdungseffekte der Einfühlung. Im Hinblick darauf lässt sich eine Parallele zwischen dem sozialen Drama von Lenz und dem Essayfilm Briels ziehen. Die verinnerlichten Normkonflikte der 68-er Generation werden mit denen des Sturm- und Drangdichters Lenz parallelisiert.
Durch eine Gegenüberstellung des Films mit biographischen Zeitzeugnissen und den literarischen Grundlagetexten, dem Bericht Oberlins und Georg Büchners Lenz kann veranschaulicht werden, dass sich Briel in direkter und indirekter Weise verschiedenster Quellen bedient, einzelne Motive, Elemente und Figuren herausgreift, die er in den Filmtext integriert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Verschmelzung von Dokumentation und Fiktion im Genre Essayfilm
- 2. Die produktive Rezeption von Jonatan Briel
- 2.1 Dem Geiste des Künstlers nachgespürt: Vom sozialen Drama zum Essayfilm
- 2.2 Eine deutsche Physiognomik durch formatfüllende Gesichtsportraits
- 2.3 Der Film JONATAN BRIEL'S LENZ in Relation zu historischen Begebenheiten und biographischen Aspekten von J. M. R. Lenz sowie den literarischen Grundlagetexten
- 2.3.1 Die Umsetzung biographischer Aspekte der historischen Figur Jacob Michael Reinhold Lenz in den Film
- 2.3.2 Der Aufenthalt im Hause des Pfarrers Oberlin im Steintal
- 2.4 Georg Büchners Lenz-Novelle und Jonatan Briels Lenz-Film – ein Vergleich
- 3. Die Visualisierung Lenzens Schizophrenie durch die Filmsprache in Jonatan Briel's Lenz
- 3.1 Kamera, Schnitt und Montage als Zerspaltungstechnik
- 3.2 Derealisationsphänomene auf der Ebene der Mise en scène
- 3.3 Raum und Zeit
- 4. Resümee der Ausarbeitung und Reflexion über den Film
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die produktive Rezeption von Georg Büchners Lenz-Novelle im Film "JONATAN BRIEL'S LENZ – EINE DEUTSCHE PHYSIOGNOMIK". Ziel ist die Rekonstruktion der Intentionen des Regisseurs Jonatan Briel und die Analyse der filmischen Umsetzung der Lenz-Figur. Dabei wird der Film sowohl im Kontext der literarischen Vorlage als auch der historischen und biographischen Begebenheiten um J.M.R. Lenz betrachtet.
- Die Verschmelzung von Dokumentation und Fiktion im Essayfilm
- Die produktive Rezeption der Lenz-Novelle durch Jonatan Briel
- Die Visualisierung von Lenzens Schizophrenie durch filmische Mittel
- Der Vergleich zwischen Büchners Novelle und Briels Film
- Die Beziehung zwischen sozialem Drama und Essayfilm
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt die Verschmelzung von Dokumentation und Fiktion im Essayfilmgenre und legt den methodischen Ansatz der Arbeit dar. Kapitel 2 analysiert die produktive Rezeption von Jonatan Briel, indem es Parallelen zwischen dem sozialen Drama und dem Essayfilm zieht, die Bedeutung der Gesichtsportraits untersucht und die Orientierung Briels an biographischen Aspekten von J.M.R. Lenz und den literarischen Vorlagen (u.a. Oberlins Bericht) beleuchtet. Ein Vergleich zwischen Büchners Novelle und Briels Film wird ebenfalls angestellt. Kapitel 3 konzentriert sich auf die filmische Darstellung von Lenzens Schizophrenie durch Kameraführung, Schnitt, Montage und Mise en scène.
Schlüsselwörter
Produktive Rezeption, Jonatan Briel, J.M.R. Lenz, Georg Büchner, Lenz-Novelle, Essayfilm, Schizophrenie, Filmsprache, Dokumentation, Fiktion, soziale Realität, Physiognomik, biographische Aspekte, literarische Grundlagetexte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Jonatan Briels Film "Lenz"?
Der Film ist keine klassische Literaturverfilmung, sondern ein Essayfilm, der sich biographisch und transtextuell der Figur J.M.R. Lenz annähert und Dokumentation mit Fiktion verschmilzt.
Wie wird die Schizophrenie von Lenz filmisch dargestellt?
Briel nutzt spezielle Filmsprachen wie Zerspaltungstechniken in der Montage, Kameraführung und Derealisationsphänomene in der Mise en scène.
Welche literarischen Quellen dienten als Grundlage für den Film?
Neben Georg Büchners "Lenz"-Novelle dienten auch der historische Bericht des Pfarrers Oberlin sowie biographische Zeugnisse des Dichters als Quellen.
Welchen Bezug nimmt der Film zur 68er-Generation?
Die Arbeit zeigt auf, dass Briel die Normkonflikte der 68er-Generation mit denen des Sturm-und-Drang-Dichters Lenz parallelisiert.
Warum gilt Briels Film als "produktive Rezeption"?
Weil er den Stoff nicht nur adaptiert, sondern im Geiste von Lenz eigenständig weiterentwickelt und politische sowie ästhetische Interessen verfolgt.
Was bedeutet der Untertitel "Eine deutsche Physiognomik"?
Dies bezieht sich auf den Einsatz formatfüllender Gesichtsportraits im Film, um den inneren Zustand und die Identität der Figur visuell zu ergründen.
- Quote paper
- B.A. Arwen Haase (Author), 2006, Produktive Rezeption und dekonstruktive Produktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124025