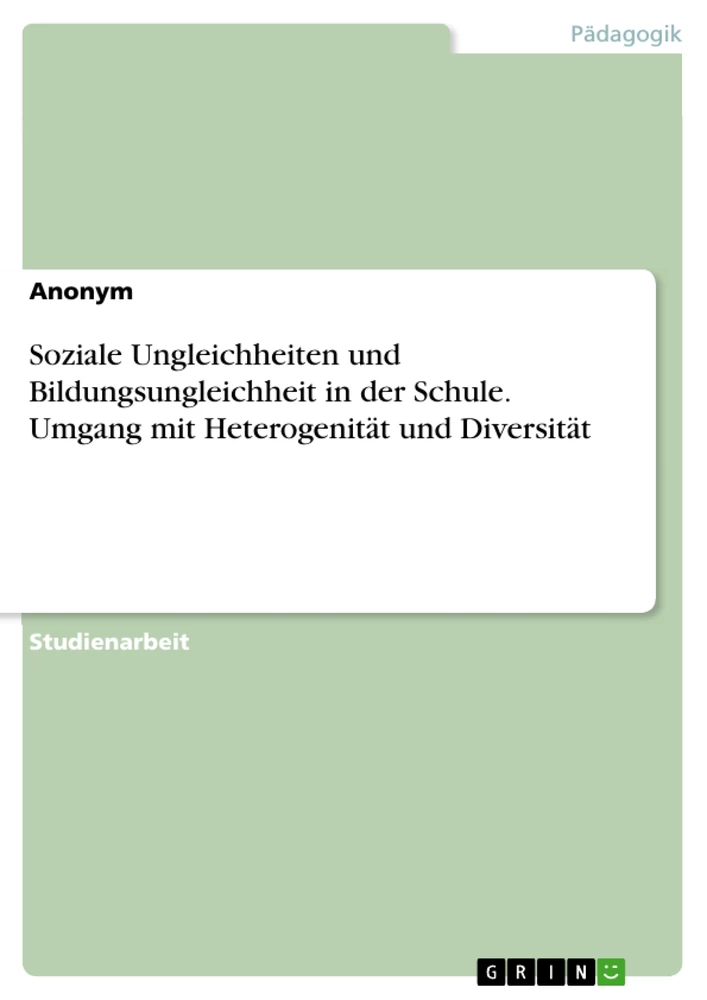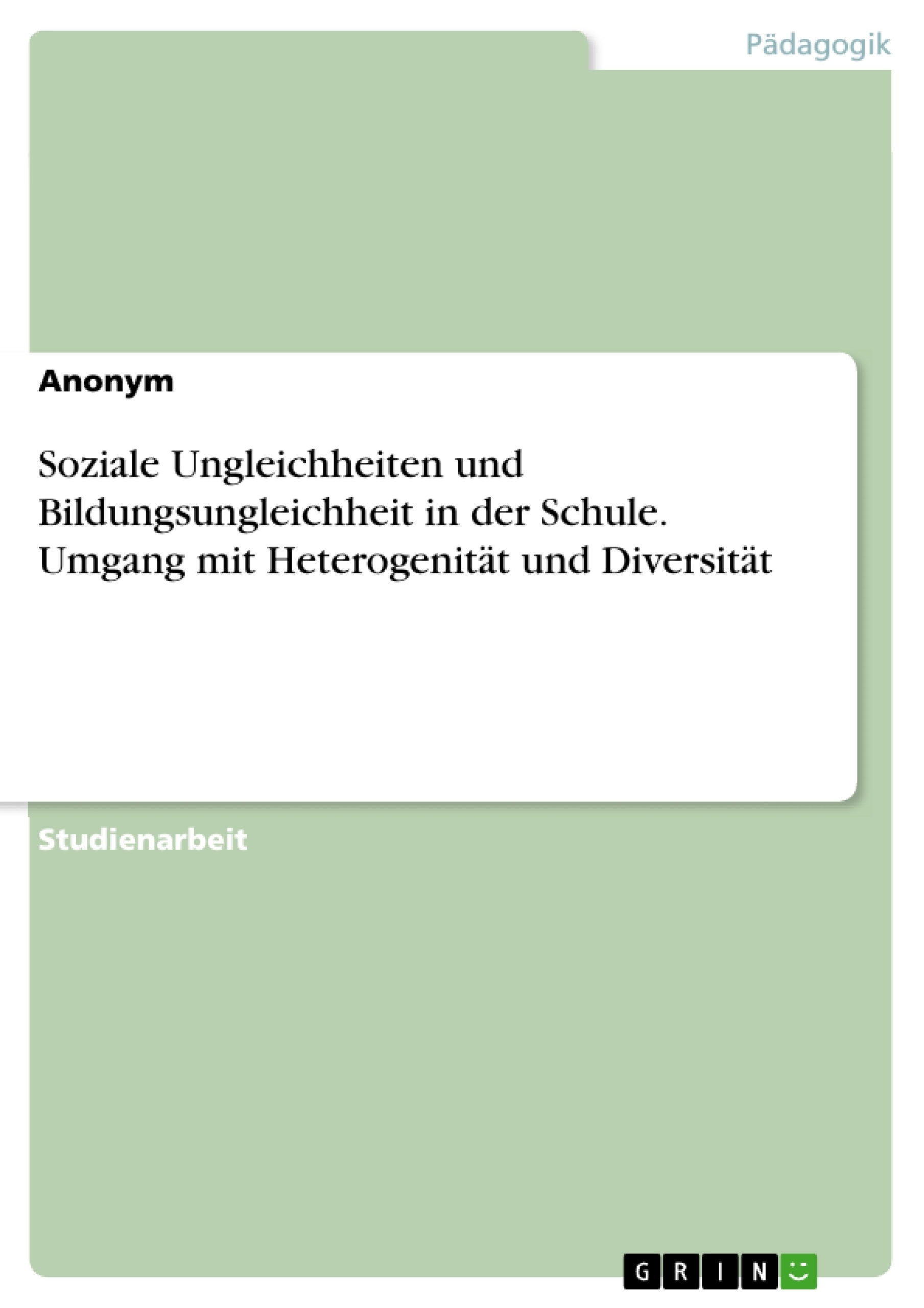In der vorliegenden Arbeit werden mögliche Gründe der Chancenungleichheit ergründet und die Schule im Hinblick auf ihre (Re-)Produktion von sozialen Ungleichheiten sowie Bildungsungleichheit untersucht. Bedeutender Faktor sind dabei die Selektionsprozesse, die homogene Lerngruppen anstreben. Zunächst wird auf die Bedeutung von Bildung in unserer Gesellschaft eingegangen und somit auf die Bedeutung der Institution Schule.
Des Weiteren werden die organisatorisch-strukturellen Bedingungen von Schulen thematisiert und die Mechanismen herausarbeitet, welche eine Diskriminierung von Migranten verursachen können. Wichtig hierbei ist der Umgang mit Heterogenität und Diversität im Kontext von Schule. Gesellschaftlich diskutiert wird die Problematik von ungleichen Bildungschancen spätestens seit den schlechten Pisa-Ergebnissen im Jahr 2000 und späteren Jahren.
Ihre Relevanz nimmt aufgrund steigender Zuwanderung und zunehmender Diversität im Klassenzimmer zu. Um einer Verschärfung der Bildungsdiskriminierung und damit einhergende gesellschaftliche Auswirkungen zu verhindern, sind politische, strukturelle und schulinterne Veränderungen nötig. In der folgenden Arbeit wird auf den schulpolitischen Handlungsbedarf eingegangen, der eine positive Entwicklung fördern kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Migrationshintergrund
- 3. Verteilung von Migranten auf Schulform
- 4. Zur Bedeutung von Bildung
- 4.1 Zur Funktion von Schule
- 4.2 Schule als Reproduktionsort von sozialen Ungleichheiten
- 5. Mechanismen institutioneller Diskriminierung
- 5.1 Das Leistungsprinzip
- 5.2 Soziale Herkunft
- 5.3 Bilingualität als Nachteil
- 6. LAU- Studie
- 6.1 Folgen der Bildungsbenachteiligung
- 6.2 Handlungsbedarfe des deutschen Bildungssystem
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik institutioneller Diskriminierung in der Primarschule. Sie analysiert, wie Migration und soziale Herkunft den Bildungserfolg von Kindern beeinflussen und welche Mechanismen zur Reproduktion von sozialen Ungleichheiten beitragen. Insbesondere werden die Folgen dieser Diskriminierung auf die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund beleuchtet.
- Institutionelle Diskriminierung in der Primarschule
- Einfluss von Migration und sozialer Herkunft auf den Bildungserfolg
- Reproduktion von sozialen Ungleichheiten durch Selektionsprozesse
- Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund
- Handlungsbedarf des deutschen Bildungssystems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der institutionellen Diskriminierung in der Primarschule ein. Sie stellt die Problematik von ungleichen Bildungschancen für Kinder mit Migrationshintergrund dar und erläutert die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund steigender Zuwanderung und zunehmender Diversität im Klassenzimmer.
Kapitel 2 definiert den Begriff „Migrationshintergrund“ und beleuchtet die demografische Entwicklung in Deutschland mit Bezug auf die Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund.
Kapitel 3 untersucht die Verteilung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund auf verschiedene Schulformen. Dabei werden die Über- und Unterrepräsentation von Migranten in den verschiedenen Schularten analysiert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Bedeutung von Bildung in der Gesellschaft und beleuchtet die Funktion von Schule als Institution zur Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Werten. Darüber hinaus werden die Mechanismen der Reproduktion von sozialen Ungleichheiten durch Schule thematisiert.
Kapitel 5 analysiert die Mechanismen institutioneller Diskriminierung in der Schule. Es werden die Rolle des Leistungsprinzips, die Bedeutung der sozialen Herkunft und die Herausforderungen der Bilingualität im Bildungsprozess beleuchtet.
Kapitel 6 stellt die Ergebnisse der LAU-Studie dar und beleuchtet die Folgen der Bildungsbenachteiligung für Kinder mit Migrationshintergrund. Zudem werden die Handlungsbedarfe des deutschen Bildungssystems zur Verbesserung der Situation erörtert.
Schlüsselwörter
Institutionelle Diskriminierung, Bildungsungleichheit, Migration, Soziale Herkunft, Bildungserfolg, Schulform, Selektionsprozesse, Reproduktion von Ungleichheiten, Heterogenität, Diversität, Handlungsbedarf, Bildungssystem, LAU-Studie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter institutioneller Diskriminierung in Schulen?
Es bezeichnet Mechanismen innerhalb des Schulsystems, die Kinder aufgrund ihrer Herkunft oder Sprache benachteiligen, oft unbewusst durch Selektionsprozesse.
Wie beeinflusst der Migrationshintergrund den Bildungserfolg?
Kinder mit Migrationshintergrund sind in höheren Schulformen oft unterrepräsentiert, was auf strukturelle Barrieren und sprachliche Nachteile zurückgeführt wird.
Ist Bilingualität ein Nachteil im deutschen Schulsystem?
Die Arbeit zeigt auf, dass Mehrsprachigkeit in der Schule oft nicht als Ressource, sondern als Defizit wahrgenommen wird, was die Bildungschancen mindern kann.
Welche Rolle spielen die PISA-Ergebnisse?
Seit PISA 2000 ist die Debatte um die Koppelung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland zentrales Thema der Bildungspolitik.
Was ist die LAU-Studie?
Die LAU-Studie untersucht die Aspekte der Lernausgangslage und die Folgen von Bildungsbenachteiligung für die weitere schulische Entwicklung.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Soziale Ungleichheiten und Bildungsungleichheit in der Schule. Umgang mit Heterogenität und Diversität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1240303