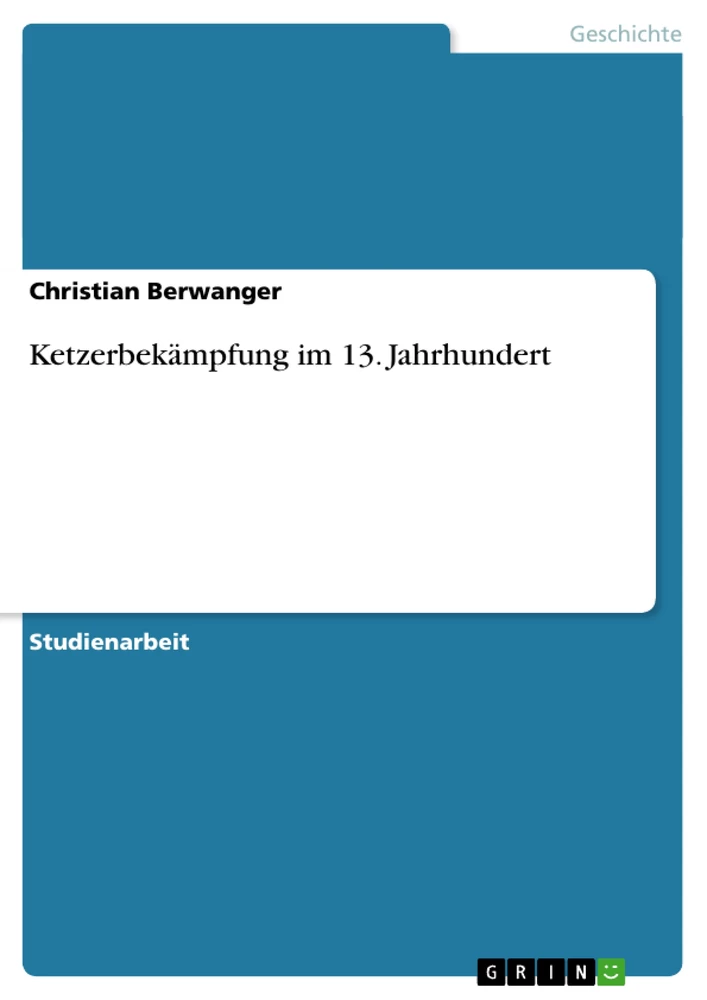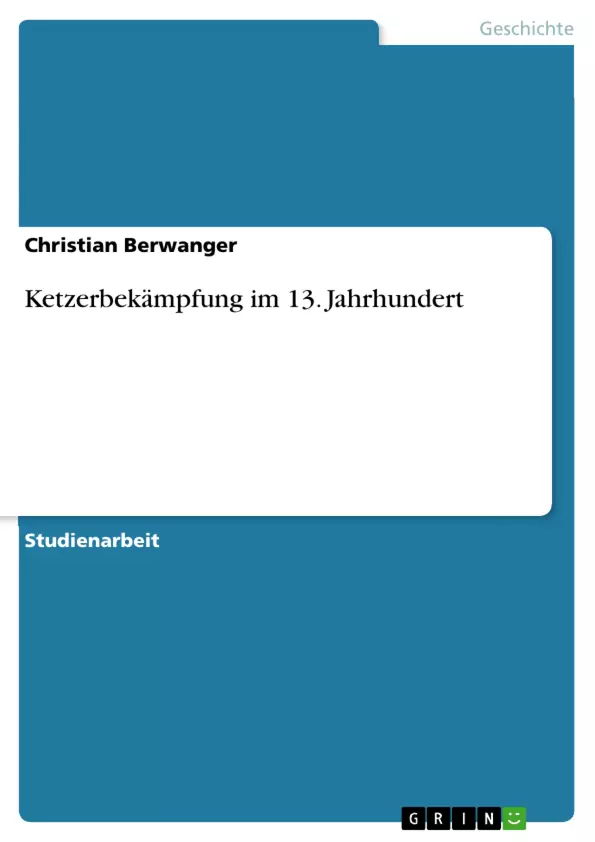Die mittelalterliche Welt des 13. Jahrhunderts war geprägt von den Auseinandersetzungen der Vertreter der Spiritualia und der Temporalia mit den großen religiösen Bewegungen häretischer Gruppierungen, vornehmlich der Katharer und Waldenser. In dieser Arbeit sollen die Maßnahmen zur Ketzerbekämpfung im 13. Jahrhundert kritisch beleuchtet und analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung und religiöse Vorstellungen mittelalterlicher häretischer Bewegungen
- 2.1. Die Katharer
- 2.2. Die Waldenser
- 3. Kirchenrecht und Ketzerei
- 3.1. Das Decretum Gratiani
- 3.2. Die Laterankonzilien von 1139 und 1179
- 3.3. Ad abolendam
- 3.4. Vergentis in senium
- 3.5. Das vierte Laterankonzil von 1215
- 4. Weltliche Ketzergesetze
- 4.1. Ketzerverfolgung in den Ländern der Krone Aragon
- 4.2. Die Ketzeredikte Friedrichs II.
- 5. Das Zeitalter der Inquisition
- 5.1. Die Anfänge der Inquisition in Deutschland
- 5.2. Die Anfänge der Inquisition in Frankreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch die Maßnahmen zur Ketzerbekämpfung im 13. Jahrhundert. Sie beleuchtet die häretischen Bewegungen der Katharer und Waldenser, analysiert die Entwicklung des Kirchenrechts gegen Ketzerei und untersucht die Rolle der weltlichen Gerichtsbarkeit bei der Ketzerverfolgung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und Institutionalisierung der Inquisition zu verstehen.
- Häretische Bewegungen des 13. Jahrhunderts (Katharer und Waldenser)
- Entwicklung des Kirchenrechts zur Bekämpfung von Ketzerei
- Rolle weltlicher Gesetze in der Ketzerverfolgung
- Entstehung und Anfänge der Inquisition
- Formierung des Häresiebegriffs im 13. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema Ketzerbekämpfung im 13. Jahrhundert und die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
Kapitel 2 (Entstehung und religiöse Vorstellungen mittelalterlicher häretischer Bewegungen): Vorstellung der Katharer und Waldenser, ihrer Lehren und ihrer Ausbreitung in Europa. Betonung der Unterschiede innerhalb der Bewegungen und die Kritik am Verhalten der Geistlichkeit als Auslöser.
Kapitel 3 (Kirchenrecht und Ketzerei): Analyse der Entwicklung des Kirchenrechts im Umgang mit Ketzerei, beginnend mit dem Decretum Gratiani und endend mit dem Vierten Laterankonzil. Schwerpunkt liegt auf der Formierung des Häresiebegriffs und der Verschärfung der Sanktionen.
Kapitel 4 (Weltliche Ketzergesetze): Untersuchung weltlicher Gesetze zur Ketzerverfolgung, anhand von Beispielen aus dem Königreich Aragon und den Ketzeredikten Friedrichs II.
Kapitel 5 (Das Zeitalter der Inquisition): Darstellung der Anfänge der Inquisition in Südfrankreich und Deutschland, bis zur päpstlichen Bulle ad extirpanda.
Schlüsselwörter
Ketzerbekämpfung, 13. Jahrhundert, Katharer, Waldenser, Kirchenrecht, Häresie, Inquisition, Laterankonzil, Friedrich II., Aragon, Decretum Gratiani, Ad abolendam, Vergentis in senium.
- Arbeit zitieren
- Christian Berwanger (Autor:in), 2008, Ketzerbekämpfung im 13. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124030