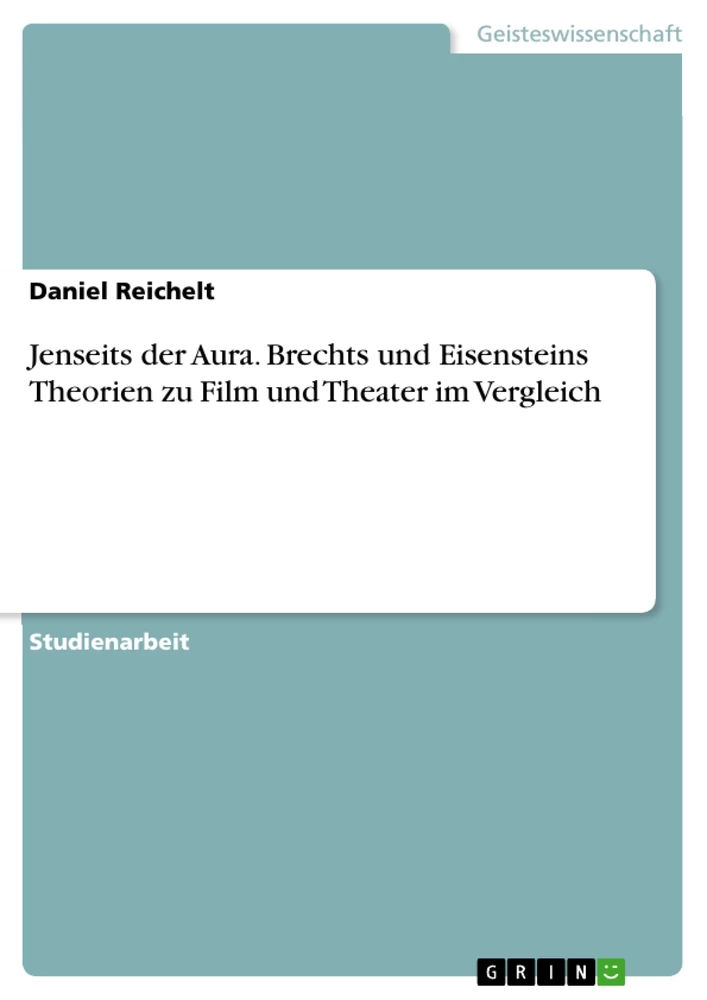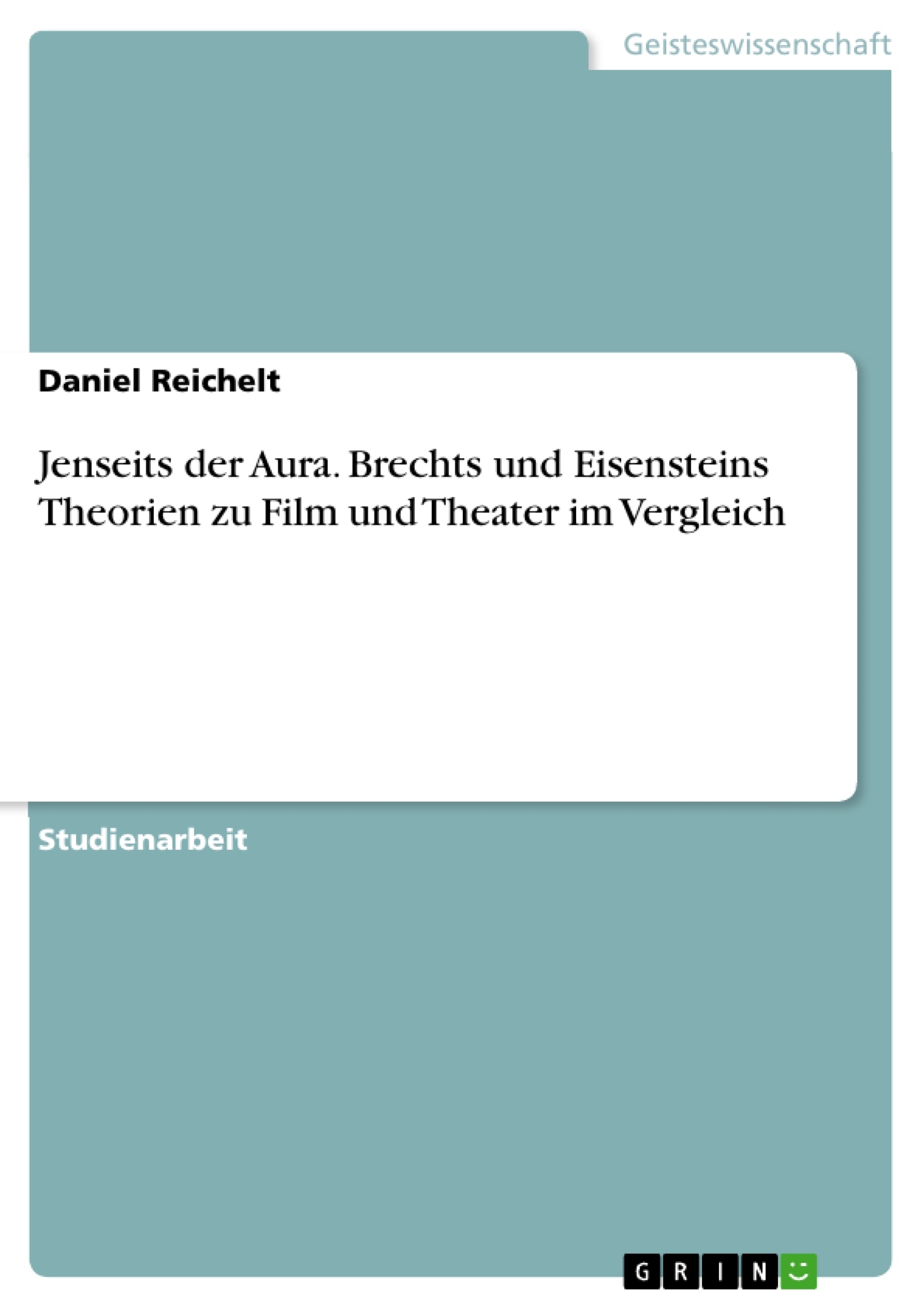In the beginning of the Ninteen-twenties both Eisenstein and Brecht proclaim the neccessity of a new form of theatre. These demands appear as the result of a process setting in with the inventions of photography and film and, refering to Benjamin, finally led to the death of the bourgeois theatre. The institutions Brecht and Eisenstein conceptualize in their theoretical writings seem to have a similar outward appearance, since both, Brecht’s »theatre of the scientific age« and Eisenstein’s Prolet-kult-works as well as his silent movies, are characterized by a technical usage of theatrical elements and construction of images. Nevertheless these are superficial affinities, being unable to conceal the deep differences in the fundamentals of Brecht’s and Eisenstein’s works. While Brecht attributes his theatre to a social and political function there are no convincing clues in Eisenstein’s writings and life revealing any purpose he creates his films for beyond personal gratification. So even if similar tendencies in Eisenstein’s and Brecht’s works cannot be denied, it is also a matter of fact, that any congruences between their aesthetic instruments rather trace back to their common claim of creating something completely new than to similar theoretical developments of the choosen aestehtic forms.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- I. Einleitung
- II. Die Verschüttung der Orchestra .....
- III. Formkonzepte
- III. 1. Eisensteins Attraktionsmontage.
- III. 2. Brechts »Theater des wissenschaftlichen Zeitalters<<
- IV. Exkurs: Eisenstein und die Revolution
- V. Die Fundamente der Kunst bei Brecht und Eisenstein
- VI. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den theoretischen Ansätzen von Bertolt Brecht und Sergej Eisenstein im Bereich des Theaters und Films. Ziel ist es, die formalen Konzeptionen der beiden Künstler zu vergleichen und ihre unterschiedlichen Zielsetzungen aufzuzeigen. Dabei wird besonders der intermedialen ästhetischen Neuorientierung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Rechnung getragen.
- Vergleich der formalen Konzeptionen von Brecht und Eisenstein
- Untersuchung der unterschiedlichen Zielstellungen der beiden Künstler
- Analyse der intermedialen ästhetischen Neuorientierung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
- Bedeutung des politischen und sozialen Kontextes für die Werke von Brecht und Eisenstein
- Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Brechts epischem Theater und Eisensteins Montageprinzipien
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Schwierigkeiten, die mit einem Vergleich der theoretischen Ansätze von Brecht und Eisenstein verbunden sind. Sie stellt dar, dass sich die beiden Künstler kaum kannten, in verschiedenen Kontexten arbeiteten und ihre Ideen in unterschiedlichen Disziplinen entwickelten.
- II. Die Verschüttung der Orchestra .....: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit die Erfindung der Fotografie und des Films das bürgerliche Theater obsolet gemacht hat.
- III. Formkonzepte: Dieser Abschnitt beleuchtet die formalen Konzeptionen von Eisenstein und Brecht. Es werden die Attraktionsmontage Eisensteins und Brechts »Theater des wissenschaftlichen Zeitalters« genauer betrachtet und verglichen.
- IV. Exkurs: Eisenstein und die Revolution: Dieses Kapitel widmet sich der Rolle der Revolution im Werk Eisensteins.
- V. Die Fundamente der Kunst bei Brecht und Eisenstein: Hier werden die grundlegenden künstlerischen Prinzipien von Brecht und Eisenstein untersucht und in Beziehung gesetzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die theoretischen Ansätze von Bertolt Brecht und Sergej Eisenstein im Bereich des Theaters und Films. Es werden die Themen intermediale ästhetische Neuorientierung, Formkonzepte, Attraktionsmontage, episches Theater, Theater des wissenschaftlichen Zeitalters, Revolution und Kunst behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was forderten Brecht und Eisenstein für das Theater zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Beide proklamierten die Notwendigkeit einer neuen Theaterform als Reaktion auf die Erfindung von Fotografie und Film, die das bürgerliche Theater in Frage stellten.
Was versteht man unter Eisensteins „Attraktionsmontage“?
Es ist ein technisches Formkonzept, bei dem Bilder und Szenen so montiert werden, dass sie beim Zuschauer eine bestimmte psychologische Wirkung oder Erschütterung erzeugen.
Was charakterisiert Brechts „Theater des wissenschaftlichen Zeitalters“?
Brechts Theater (episches Theater) zielt auf eine soziale und politische Funktion ab, wobei der Zuschauer durch Verfremdungseffekte zum kritischen Nachdenken angeregt werden soll.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Brecht und Eisenstein?
Beide nutzen eine technische Konstruktion von Bildern und theatralen Elementen, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihren Zielsetzungen und Fundamenten.
Welche Rolle spielt die Revolution im Werk Eisensteins?
Eisenstein arbeitete im Kontext der russischen Revolution, wobei in seinen Schriften oft die persönliche künstlerische Befriedigung neben der politischen Darstellung steht.
- Quote paper
- Daniel Reichelt (Author), 2001, Jenseits der Aura. Brechts und Eisensteins Theorien zu Film und Theater im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12404