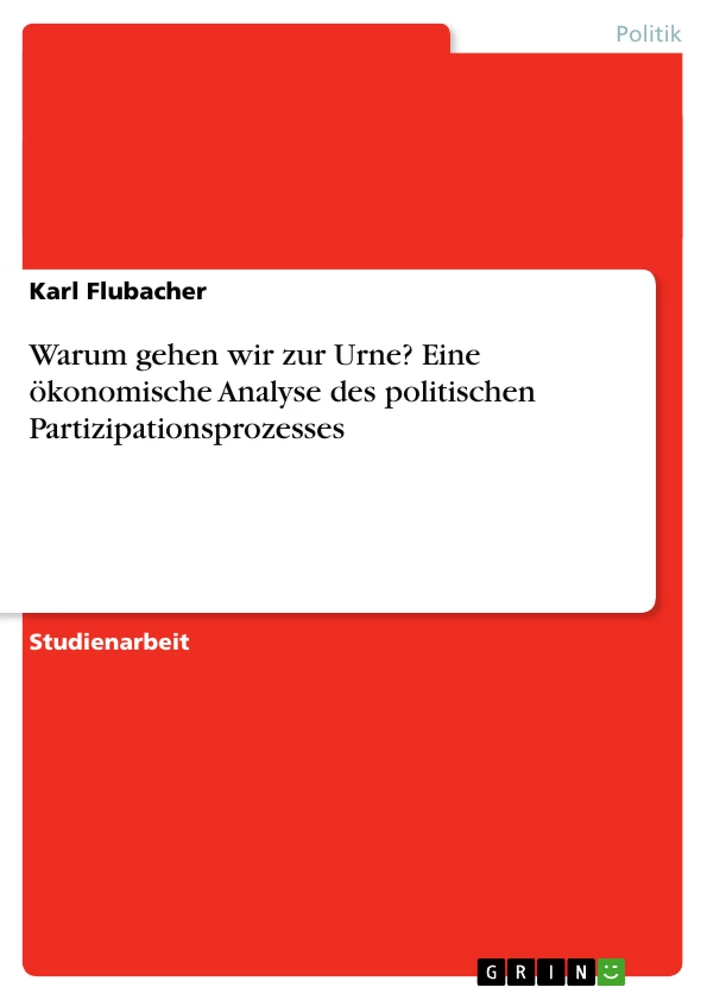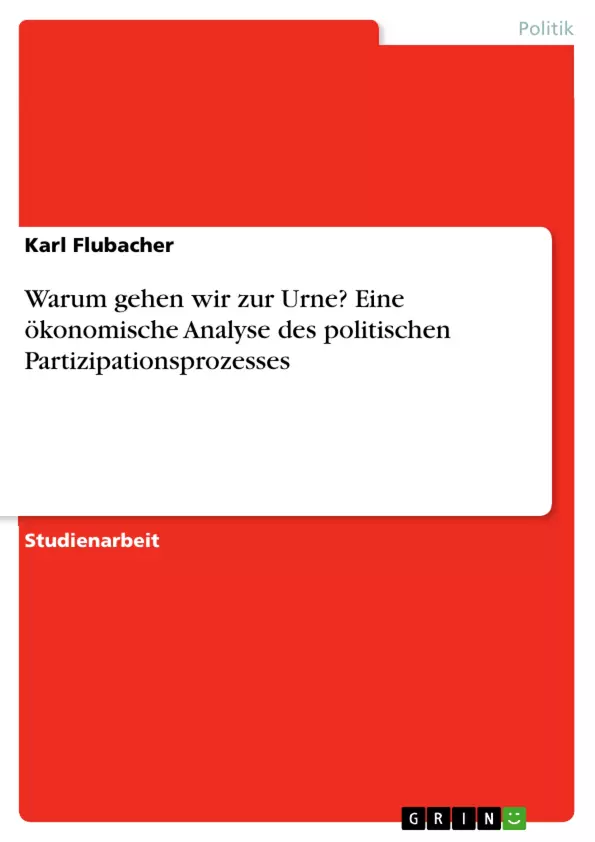In unserer Arbeit mit dem Titel „Parteien, Ideologie und Wahlverhalten – Wieso gehen wir zur Urne?“ setzen wir einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Fragestellung, weshalb Menschen an die Urne gehen – oder eben nicht. Mit einer ganz einfachen Kosten–Nutzen–Analyse, wie wir sie alle aus der traditionellen Mikroökonomie kennen, kommt eigentlich jede Person (homo oeconomicus) zum Schluss, dass es sich für sie nicht lohnt, an einer Abstimmung oder Wahl zu partizipieren. Die Kosten überwiegen den Nutzen bei weitem. Warum aber gibt es viele Menschen, die jedesmal die Zeit auf sich nehmen, ihren Stimmzettel abzugeben?
Wir werden versuchen, dieser Frage aus einer ökonomischen Sicht nachzugehen, wirtschaftliche Argumente anzubringen, um sie anschliessend möglichst befriedigend beantworten zu können.
Die Neue Politische Ökonomie (engl. public choice) liefert uns die grundlegenden Denkanstösse, Konzeptionen und Modelle, auf welchen wir unsere Argumentation aufbauen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Prolog
- Definition
- Einführung
- Public Choice
- Die Hypothese des rationalen Wählers
- Soziologische Faktoren
- Der Wähler
- Der Nichtwähler
- Voter's Paradox
- Einführung
- Ist Rationalität das Problem?
- Eine Handlung kann gut für das Individuum und schlecht für die Gruppe sein
- Grundlage der Moral
- Median Voter Theorem
- Kritik am Modell
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Menschen wählen gehen oder nicht, unter Verwendung ökonomischer Analysen. Mittels der Theorie der „Public Choice“ und der Kosten-Nutzen-Analyse werden die Motive des politischen Partizipationsprozesses beleuchtet. Das Ziel ist es, die scheinbare Irrationalität des Wahlverhaltens aus ökonomischer Perspektive zu erklären.
- Kosten-Nutzen-Analyse des Wahlverhaltens
- Das „Public Choice“-Modell und seine Anwendungen
- Die Hypothese des rationalen Wählers
- Das „Voter's Paradox“ und das „Median Voter Theorem“
- Kritik an ökonomischen Modellen der politischen Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und führt in die Thematik des politischen Partizipationsprozesses ein. Dabei wird die „Public Choice“-Theorie als Grundlage der Argumentation vorgestellt.
- Public Choice: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Erkenntnisse der „Public Choice“-Theorien, insbesondere im Bezug auf die politische Partizipation von Individuen und die Strategien von Parteien. Es werden die drei Hauptpunkte des Modells vorgestellt: die Hypothese des rationalen Wählers, die Gewinnstrategie von Parteien und das „Voter's Paradox“.
- Die Hypothese des rationalen Wählers: Dieses Kapitel untersucht die Hypothese des rationalen Wählers im Detail. Durch eine Kosten-Nutzen-Analyse wird gezeigt, dass aus rein ökonomischer Perspektive die Teilnahme an Wahlen für den Einzelnen oft irrational erscheint.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die ökonomische Analyse des politischen Partizipationsprozesses. Schlüsselbegriffe sind „Public Choice“, Kosten-Nutzen-Analyse, rationaler Wähler, „Voter’s Paradox“, „Median Voter Theorem“ sowie die Kritik an ökonomischen Modellen der politischen Partizipation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Fragestellung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht aus ökonomischer Sicht, warum Menschen wählen gehen, obwohl die individuellen Kosten oft den direkten Nutzen übersteigen.
Was besagt die Hypothese des rationalen Wählers?
Diese Hypothese aus der Public Choice Theorie geht davon aus, dass ein Wähler (homo oeconomicus) nur dann teilnimmt, wenn der erwartete Nutzen die Kosten (Zeit, Aufwand) überwiegt.
Was versteht man unter dem "Voter's Paradox"?
Es beschreibt den Widerspruch, dass Millionen Menschen wählen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die einzelne Stimme das Gesamtergebnis beeinflusst, verschwindend gering ist.
Was ist das "Median Voter Theorem"?
Dieses Modell besagt, dass Parteien in einem Zweiparteiensystem dazu neigen, ihre Positionen in die Mitte des politischen Spektrums zu verlagern, um den "mittleren" Wähler zu gewinnen.
Welche Kritik gibt es an der ökonomischen Analyse des Wahlverhaltens?
Kritiker bemängeln, dass rein ökonomische Modelle soziologische Faktoren, moralische Verpflichtungen und das Gemeinschaftsgefühl oft unzureichend berücksichtigen.
- Quote paper
- Karl Flubacher (Author), 2000, Warum gehen wir zur Urne? Eine ökonomische Analyse des politischen Partizipationsprozesses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12406