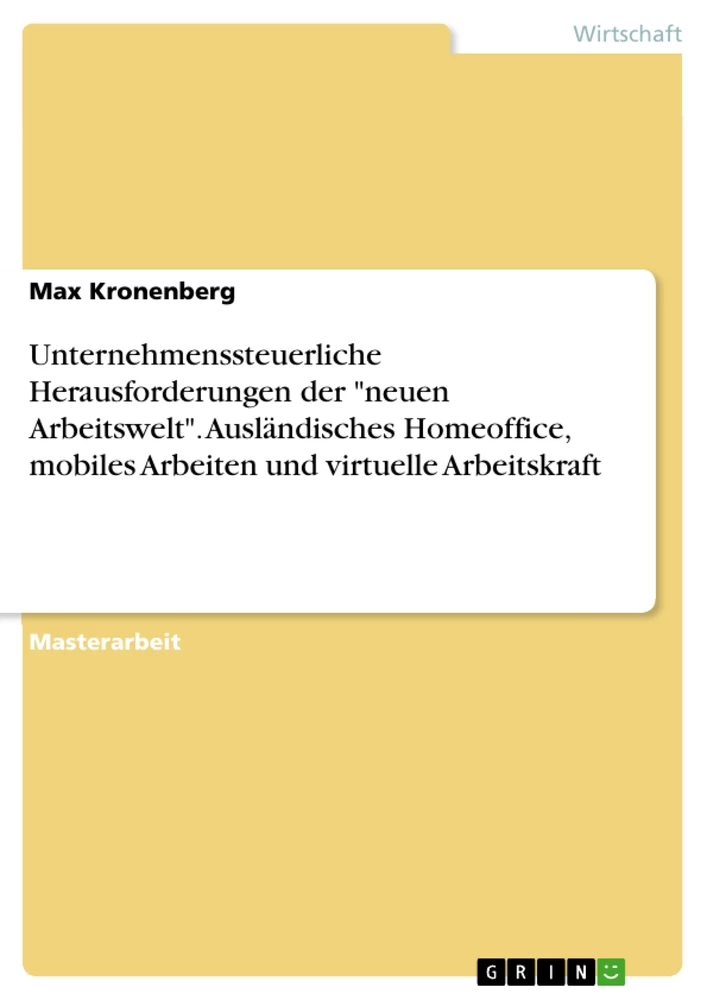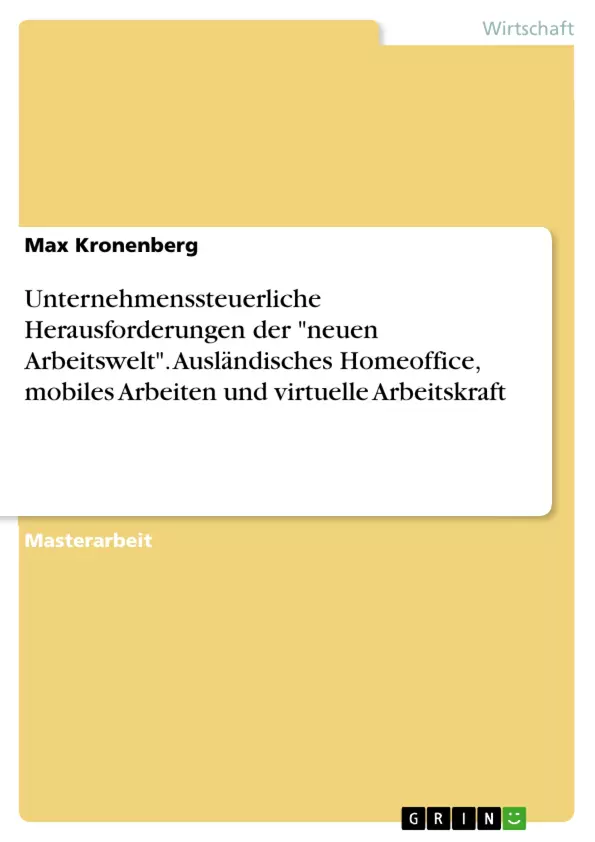Die vorliegende Masterarbeit soll ausgewählte, unternehmenssteuerliche Herausforderungen der „neuen Arbeitswelt“ darstellen, praktische Probleme für Steuerabteilungen und Steuerberater multinationaler Konzerne aufzeigen und Reformüberlegungen ableiten. Insbesondere soll dargestellt werden, dass die gegenwärtige Definition der Betriebsstätte dergestalt überarbeitet werden muss, dass sie für die Praxis eine rechtssichere Anwendung ermöglicht. Hierzu werden im folgenden Kapitel die thematischen sowie theoretischen Grundlagen gelegt. Anschließend erfolgt eine praxisorientierte Analyse anhand ausgewählter Fallbeispiele, die die praktischen Herausforderungen darstellen soll. Darauf aufbauend werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und konzeptionelle Reformüberlegungen angedacht.
Die Arbeits- und Geschäftswelt unterliegt einem stetigen Wandel und ist heute wohl globaler und digitaler als je zuvor. Während die Besteuerungsprinzipien der Globalisierung der Arbeits- und Geschäftswelt noch vergleichsweise gerecht wurden, scheint die Digitalisierung der Arbeits- und Geschäftswelt, eine Reform der Besteuerungsprinzipien zu erfordern. Im Zuge der Globalisierung haben sich Konzerne herausgebildet, die in einer Vielzahl der Länder durch eine Gesellschaft oder eine Betriebsstätte physisch präsent sind. Die bestehenden Besteuerungsprinzipien verknüpfen die physische Präsenz mit einer steuerbaren Wertschöpfung. Die Besteuerungsprinzipien bilden hierbei ein industrielles Weltbild ab – gedanklich wird auf Fabrikations-, oder Geschäftsstellen und dergleichen abgestellt.
Die zunehmende Digitalisierung der Geschäftswelt löst die Verknüpfung von physischer Präsenz eines Konzerns und dessen Wertschöpfung. Ein Konzern kann heute in einem Land wirtschaftlich präsent sein, ohne dass er in diesem Land eine Gesellschaft oder Betriebsstätte begründet. Zugleich führt die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt, die zuletzt durch die Corona-Pandemie einen bedeutenden Schub erhalten hat, zu einem physischen Auseinanderfallen der Räumlichkeiten des Konzerns sowie seiner Belegschaft. In vielen Bereichen ist heute nicht mehr erforderlich, dass ein Mitarbeiter in das Büro der Gesellschaft kommt, für die er tätig wird. Mit Hilfe seines Computers kann der Mitarbeiter faktisch zu jeder Zeit, von jedem Ort und für jede Gesellschaft des Konzerns arbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Grundlagen
- I. Charakteristika der „neuen Arbeitswelt“
- II. Steuerliche Theorie
- 1. Betriebsstätte
- 2. Lohnsteuer
- 3. Ort der (tatsächlichen) Geschäftsleitung
- 4. Exkurs: BEPS 2.0
- C. Praxisorientierte Analyse ausgewählter Fallbeispiele
- I. Ausländisches Homeoffice
- 1. Betriebsstätte
- 2. Lohnsteuer
- II. Mobiles Arbeiten
- 1. Betriebsstätte
- 2. Lohnsteuer
- III. Virtuelle Arbeitskraft
- 1. Betriebsstätte
- 2. Lohnsteuer
- IV. Regionale Führungsrollen
- 1. Betriebsstätte
- 2. Lohnsteuer
- 3. Ort der (tatsächlichen) Geschäftsleitung
- I. Ausländisches Homeoffice
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit den unternehmenssteuerlichen Herausforderungen der „neuen Arbeitswelt“, die sich durch die Digitalisierung und Globalisierung der Arbeits- und Geschäftswelt ergeben. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Besteuerung von multinationalen Konzernen und zeigt auf, dass die bestehenden Besteuerungsprinzipien an die neuen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Insbesondere wird die Notwendigkeit einer Reform der Definition der Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht hervorgehoben.
- Die Entwicklung und Charakteristika der „neuen Arbeitswelt“
- Die Bedeutung der Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht
- Die Lohnsteuerliche Behandlung von Arbeitnehmern in der „neuen Arbeitswelt“
- Die Herausforderungen der Besteuerung mobiler Arbeit, virtueller Arbeitskräfte und regionaler Führungsrollen
- Konzeptionelle Reformüberlegungen zur Anpassung der Besteuerungsprinzipien an die „neue Arbeitswelt“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Relevanz des Themas im Kontext der Digitalisierung und Globalisierung der Arbeits- und Geschäftswelt beleuchtet. Im Kapitel B. Grundlagen werden die Charakteristika der „neuen Arbeitswelt“ und die relevanten steuerlichen Theorieansätze dargestellt. Anschließend wird die Definition der Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht beleuchtet und die Anwendung der Lohnsteuer auf Arbeitnehmer in der „neuen Arbeitswelt“ diskutiert. Im Kapitel C. Praxisorientierte Analyse ausgewählter Fallbeispiele werden verschiedene Fallbeispiele anhand von Sachverhaltsdarstellungen untersucht, um die praktischen Herausforderungen der Besteuerung in der „neuen Arbeitswelt“ aufzuzeigen. Die Analyse umfasst dabei die Fallbeispiele Ausländisches Homeoffice, Mobiles Arbeiten, Virtuelle Arbeitskraft und Regionale Führungsrollen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der unternehmenssteuerlichen Herausforderungen in der „neuen Arbeitswelt“, die sich durch die Digitalisierung und Globalisierung der Arbeits- und Geschäftswelt ergeben. Die Arbeit analysiert dabei die relevanten Steuerbegriffe und -themen, die sich mit der Anwendung des internationalen Steuerrechts auf die Arbeitswelt der Zukunft befassen. Die Arbeit thematisiert Themen wie die Definition der Betriebsstätte, die Lohnsteuerliche Behandlung von Arbeitnehmern in der „neuen Arbeitswelt“, mobile Arbeit, virtuelle Arbeitskräfte, regionale Führungsrollen, BEPS und die konzeptionelle Reform der bestehenden Besteuerungsprinzipien.
Häufig gestellte Fragen
Warum stellt das ausländische Homeoffice eine steuerliche Herausforderung dar?
Durch die Arbeit im Homeoffice im Ausland kann ungewollt eine steuerliche Betriebsstätte begründet werden, was komplexe steuerliche Verpflichtungen für das Unternehmen im jeweiligen Land nach sich zieht.
Was versteht man im internationalen Steuerrecht unter einer „Betriebsstätte“?
Traditionell ist eine Betriebsstätte eine feste Geschäftseinrichtung. In der digitalen Arbeitswelt wird diese Definition jedoch problematisch, da Wertschöpfung zunehmend ortsunabhängig erfolgt.
Welche lohnsteuerlichen Probleme ergeben sich durch mobiles Arbeiten?
Es muss geklärt werden, in welchem Staat der Arbeitnehmer steuerpflichtig ist, insbesondere wenn er für eine Gesellschaft arbeitet, aber physisch in einem anderen Land tätig ist.
Was ist das Ziel von BEPS 2.0 im Kontext der neuen Arbeitswelt?
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 2.0 zielt darauf ab, die Besteuerungsrechte international fairer zu verteilen und sicherzustellen, dass Gewinne dort besteuert werden, wo die wirtschaftliche Aktivität stattfindet.
Wie beeinflusst die Digitalisierung die Definition des „Ortes der Geschäftsleitung“?
Da Führungskräfte virtuelle Arbeitsmittel nutzen und Entscheidungen von überall treffen können, verschwimmt der physische Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung, was die steuerliche Ansässigkeit von Konzernen verkompliziert.
- Quote paper
- Max Kronenberg (Author), 2021, Unternehmenssteuerliche Herausforderungen der "neuen Arbeitswelt". Ausländisches Homeoffice, mobiles Arbeiten und virtuelle Arbeitskraft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1241032