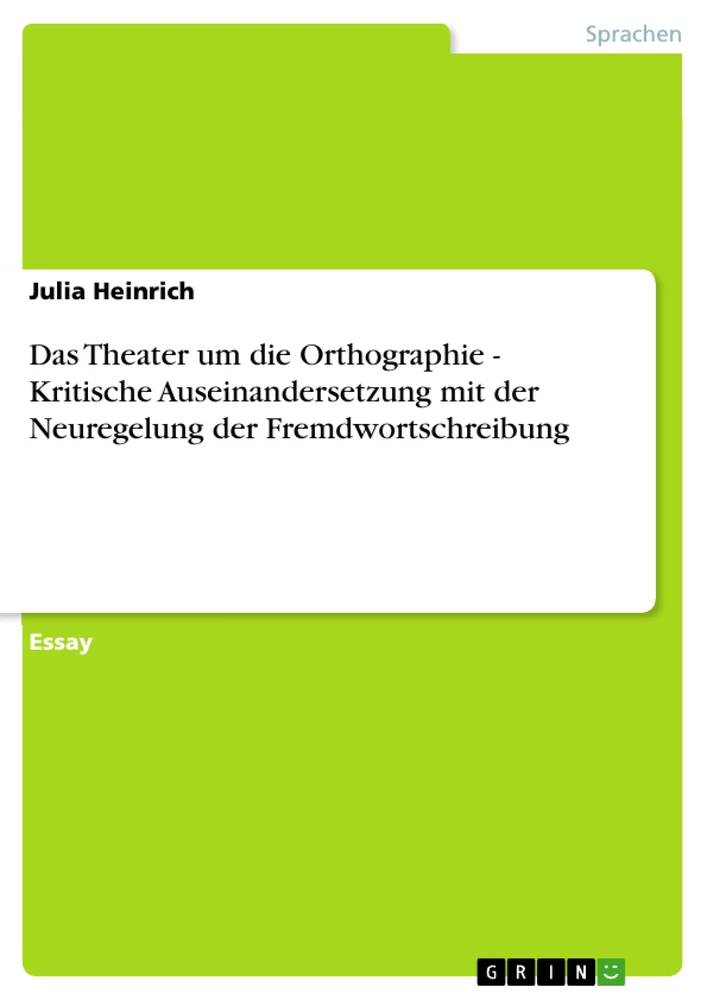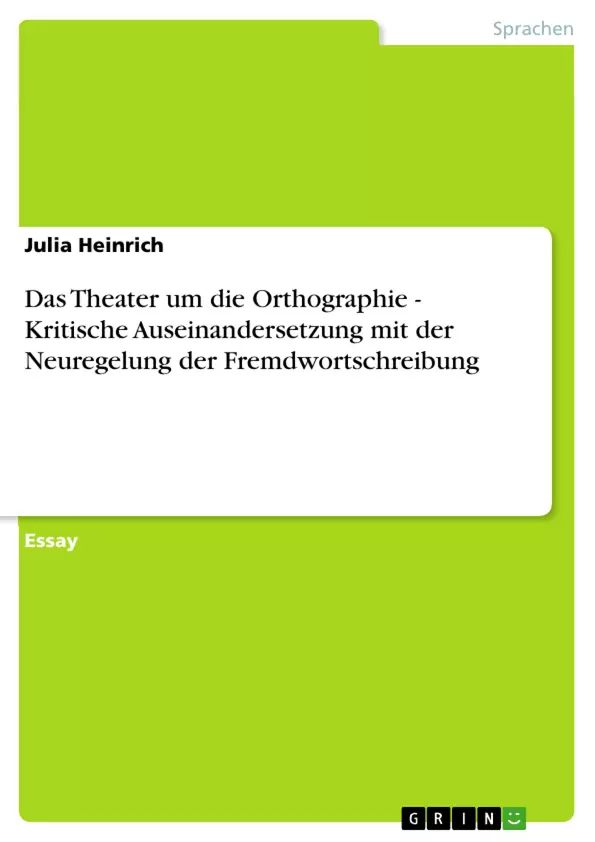Wäre doch nur alles so einfach wie in Schweden. Dort kam vor gut zweihundert Jahren ein Herr Carl Gustav Leopold auf die findige Idee, alle französischen Fremdwörter radikal zu integrieren – ganz nach dem Motto „Schreib, wie du sprichst!“. Leopold war Sekretär der Schwedischen Akademie, und der war diese Reform zunächst gar nicht recht. Dennoch setzten die Änderungen Leopolds sich durch, und so kommt es, dass unsere nordischen Nachbarn seit 1801 im restorang eine buljong bestellen, kein abonnement, sondern höchstens ein abonnemang ihres Tageblatts beziehen und darin den följetong lesen.
Man mag über diese Schreibweise denken, was man will, einer jedoch fand sie gewiss briljant: Friedrich Wilhelm Fricke, Vertreter der radikal-phonetischen Schule und später Vorsitzender des „algemeinen fereins für fereinfahte rehtschreibung“. Der forderte ab 1876 auch für die deutsche Sprache die Einführung einer Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Phonemen und Graphemen, insbesondere auch für Fremdwörter, und zwar nicht nur die französischen. Wäre die Kampagne Frickes und seiner Mitstreiter erfolgreich gewesen, würden wir heute *Kampanje schreiben und über Wörter wie *Teater und *Karakter längst nicht mehr die Nase rümpfen. Niemand würde mehr von den sprachgewandteren Freunden belächelt, wenn er beim Italiener „Knotschi“ bestellt; die richtige Aussprache stünde ja auf der Speise-karte. Alles in allem doch ein recht sozialer Reformvorschlag.
Umgesetzt wurde er jedoch nie, denn die radikalen Phonetiker scheiterten mit ihren Vorschlägen, und 1995 wären sie es erst recht. Als in jenem Jahr der „Internationale Arbeitskreis für Orthographie“ noch einmal ein vergleichsweise vorsichtiges Avancement wagte und vorschlug, das <h> aus allen Fremdwörtern griechischen Ursprungs mit <th>, <ph> und <rh> zu streichen, da ging ein Aufschrei der Empörung durch Deutschland. Niemand war bereit, von gewohnten Wortbildern abzurü-cken und nun *Tron, *Rytmus oder *Alfabet zu schreiben. Was für ein Affront gegen die deutsche Sprache!
Inhaltsverzeichnis
- Das Theater um die Orthographie
- Kritische Auseinandersetzung mit der Neuregelung der Fremdwortschreibung
- Die radikal-phonetische Schule
- Die gescheiterte Reform von 1995
- Fremdwörter als Sündenbock
- Fremdwörter: Integration und Sprachgefühl
- Was ist ein Fremdwort?
- Die Schreibung von Fremdwörtern
- Integrierte und nicht integrierte Fremdwörter
- Fachwörter und Gemeinwortschatz
- Die Probleme der Reformer
- Die Reform der Fremdwortschreibung
- Fremdwörter aus klassischen Sprachen
- Fremdwörter aus lebenden Sprachen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht kritisch die Neuregelung der Fremdwortschreibung im Deutschen. Sie beleuchtet die Geschichte der Reformbemühungen, analysiert die Schwierigkeiten bei der Integration von Fremdwörtern und diskutiert die daraus resultierenden Inkonsequenzen.
- Die Geschichte der Reformversuche zur Fremdwortschreibung
- Definition und Charakteristika von Fremdwörtern
- Die Schwierigkeiten bei der Integration von Fremdwörtern in die deutsche Sprache
- Die Kriterien für die Angleichung der Schreibung von Fremdwörtern
- Kritik an der Inkonsequenz der Rechtschreibreform
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Betrachtung der radikal-phonetischen Schule und deren gescheiterten Reformversuchen. Er beschreibt die Schwierigkeiten, eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Phonemen und Graphemen, insbesondere bei Fremdwörtern, herzustellen. Anschließend wird die Reform von 1995 und ihre Ablehnung thematisiert. Es folgt eine Auseinandersetzung mit der Frage, was ein Fremdwort ist und welche Kriterien für seine Schreibung relevant sind. Die Definition von Fremdwörtern nach Heller wird erläutert und die fließenden Grenzen zwischen fremden und eingebürgerten Wörtern diskutiert. Der Text geht auf die Probleme ein, vor denen die Reformer bei der Erstellung einheitlicher Regeln für die Fremdwortschreibung standen und beschreibt die teilweise Integration von Fremdwörtern in die deutsche Schreibweise. Die Reform bemühte sich um behutsame Änderungen und knüpfte an bereits bestehende Entwicklungen an. Abschließend werden die Herausforderungen bei der Umsetzung von konsequenter Vereinfachung und der Berücksichtigung der Internationalität der Fremdwörter dargestellt. Die Beispiele der Ersetzung von <ph> durch <f> und <th> durch <t> werden diskutiert, und die Inkonsequenzen der Reform werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Rechtschreibreform, Fremdwortschreibung, Integration, radikal-phonetische Schule, Konsequenz, Inkonsequenz, Fremdwörter, Graphie, Phonetik, Reformversuche, Wortintegration, Schreibgewohnheiten, Fachwörter, Gemeinwortschatz.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Idee der radikal-phonetischen Schule?
Vertreter wie Friedrich Wilhelm Fricke forderten eine „Eins-zu-Eins-Beziehung“ zwischen Lauten und Buchstaben (Phonemen und Graphemen), nach dem Motto: „Schreib, wie du sprichst!“.
Warum scheiterte die Reform der Fremdwortschreibung 1995?
Vorschläge wie die Streichung des <h> in Wörtern griechischen Ursprungs (z.B. *Rytmus statt Rhythmus) stießen auf massiven Widerstand, da die gewohnten Wortbilder nicht aufgegeben werden wollten.
Was ist der Unterschied zwischen integrierten und nicht integrierten Fremdwörtern?
Integrierte Fremdwörter haben sich in Schreibung und Aussprache dem Deutschen angepasst, während nicht integrierte Wörter ihre ursprüngliche fremde Graphie behalten.
Welche Inkonsequenzen gibt es bei der Rechtschreibreform?
Kritisiert wird, dass die Reform oft nur halbherzig vorging, was zu einem Mix aus alten und neuen Schreibweisen führte und das Sprachgefühl eher verwirrte als klärte.
Wie gehen andere Sprachen, wie z.B. Schwedisch, mit Fremdwörtern um?
Im Schwedischen wurden französische Fremdwörter radikal integriert (z.B. „buljong“ statt „bouillon“), was im Deutschen historisch nie in diesem Maße umgesetzt wurde.
- Quote paper
- Julia Heinrich (Author), 2005, Das Theater um die Orthographie - Kritische Auseinandersetzung mit der Neuregelung der Fremdwortschreibung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124151