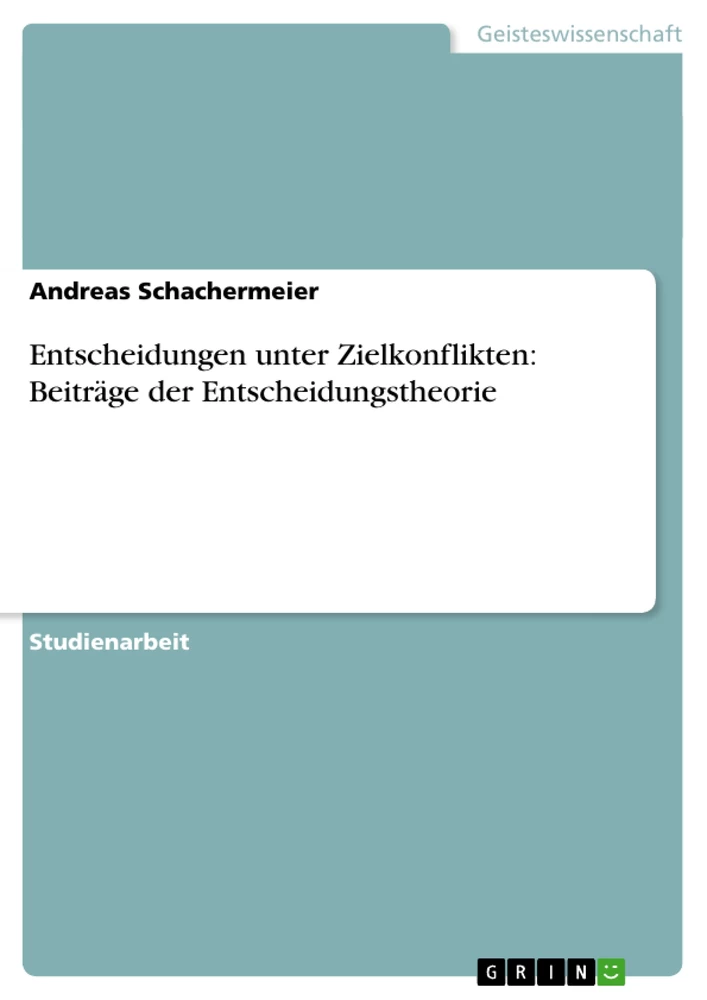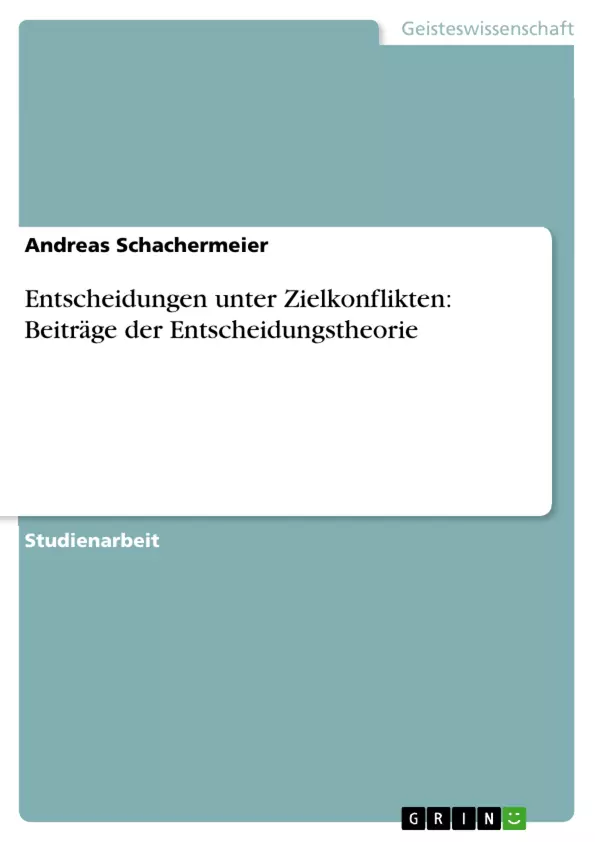Der Mensch ist mit seinem sogenannten gesunden Menschenverstand in komplexen Entscheidungen oft überfordert, was an der Vielfalt der verschiedenen Ziele oder auch an der Unsicherheit der Zukunft liegen mag. Das Problem kann durch zu viele Handlungsalternativen bzw. durch die große Zahl der Einflussfaktoren noch schwieriger erscheinen. Die Erfolgsaussichten von Entscheidungen lassen sich durch rationales Vorgehen deutlich verbessern, indem man sich gewisse Anforderungen an den Entscheidungsprozess stellt und andererseits Grundsätze der Widerspruchsfreiheit festlegt. Vereinfachen kann man Probleme durch Zerlegung in mehrere Teilprobleme.
Objektiv richtige Entscheidungen gibt es nicht, viel mehr basieren Entscheidungen auf subjektiven Erwartungen, Zielen und Präferenzen des Entscheiders. Für den Menschen ist es schwierig seine subjektiven Erwartungen, Ziele und Präferenzen eindeutig zu formulieren. Hier kommt nun die Entscheidungstheorie ins Spiel, welche dem Menschen bei Entscheidungen unterstützt. Die Entscheidungstheorie benutzt formale Verfahren, die die Unschärfe der verschiedenen Informationen in Betracht ziehen, indem sie einerseits notfalls mit unvollständigen Informationen auszukommen versucht und andererseits die Konsistenz der Aussagen überprüft. In Dieser Arbeit beschränke ich mich hauptsächlich auf die präskriptive Entscheidungstheorie, da sie besonders für wirtschaftliche Entscheidungen von Bedeutung ist und eines ihrer Kernprobleme daraus besteht, wie das Zielsystem eines Entscheiders erforscht werden kann.
Schlagwörter: Entscheidung – deskriptive Entscheidungstheorie – präskriptive Entscheidungstheorie - Zielkonflikte - Entscheidungsregeln
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Entscheidungstheorie
- 2.1 Definition Entscheidung
- 2.2 Entscheidungstheorien
- 2.2.1 Deskriptive Entscheidungstheorie
- 2.2.2 Präskriptive Entscheidungstheorie
- 2.2.3 Das Grundmodell der präskriptiven Entscheidungstheorie
- 3. Was macht Entscheidungen so schwierig?
- 3.1 Ziele
- 3.2 Zielkonflikte
- 3.2.1 Effiziente Alternativen
- 3.2.2 Zieldominanz
- 3.2.3 Lexikographische Ordnung
- 3.2.4 Zielgewichtung
- 3.3 Zielkonflikte aus psychologischer Sicht
- 3.3.1 Non-kompensatorische Regeln
- 3.3.1.1 Schwellenregeln
- 3.3.1.2 Eliminationsregeln
- 3.3.2 Kompensatorische Regeln
- 3.3.3 Kombination von Entscheidungsregeln
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei Entscheidungen unter Zielkonflikten und beleuchtet die Beiträge der Entscheidungstheorie zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Sie konzentriert sich dabei auf die präskriptive Entscheidungstheorie, da diese für wirtschaftliche Entscheidungen besonders relevant ist.
- Definition und Unterscheidung deskriptiver und präskriptiver Entscheidungstheorien
- Analyse von Zielkonflikten und deren Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse
- Beschreibung verschiedener Entscheidungsregeln (kompensatorisch und non-kompensatorisch)
- Anwendung der Entscheidungstheorie zur Verbesserung der Entscheidungsfindung
- Erforschung von Methoden zur systematischen Analyse von Zielsystemen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Entscheidungsfindung unter komplexen Bedingungen ein. Sie verdeutlicht die Schwierigkeiten, die aus der Vielzahl von Zielen, Unsicherheiten und Handlungsalternativen resultieren. Die Arbeit betont die Bedeutung eines rationalen Vorgehens zur Verbesserung der Erfolgsaussichten von Entscheidungen und führt die Entscheidungstheorie als unterstützendes Werkzeug ein. Der Fokus liegt auf der präskriptiven Entscheidungstheorie, insbesondere auf der Erforschung von Zielsystemen des Entscheiders.
2. Grundlagen der Entscheidungstheorie: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Entscheidungstheorie dar. Es beginnt mit einer Definition von „Entscheidung“ und beleuchtet verschiedene Merkmale von Entscheidungen, wie die Wahlmöglichkeit und die Verpflichtung zur Umsetzung der Entscheidung. Anschließend werden deskriptive und präskriptive Entscheidungstheorien unterschieden. Die deskriptive Theorie beschreibt, wie Menschen tatsächlich Entscheidungen treffen, während die präskriptive Theorie vorschreibt, wie rationale Entscheidungen getroffen werden sollten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der präskriptiven Entscheidungstheorie aufgrund ihrer Relevanz für wirtschaftliche Entscheidungen.
3. Was macht Entscheidungen so schwierig?: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Herausforderungen bei der Entscheidungsfindung, insbesondere mit Zielkonflikten. Es beschreibt verschiedene Ansätze zur Behandlung von Zielkonflikten, darunter effiziente Alternativen, Zieldominanz, lexikographische Ordnung und Zielgewichtung. Zusätzlich werden Zielkonflikte aus psychologischer Perspektive beleuchtet, mit einer detaillierten Erörterung von kompensatorischen und non-kompensatorischen Entscheidungsregeln, einschließlich Schwellen- und Eliminationsregeln sowie deren Kombinationen. Der Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die komplexen Faktoren, die Entscheidungen schwierig machen, und präsentiert verschiedene Strategien für den Umgang damit.
Schlüsselwörter
Entscheidung, deskriptive Entscheidungstheorie, präskriptive Entscheidungstheorie, Zielkonflikte, Entscheidungsregeln, Zielgewichtung, kompensatorische Regeln, non-kompensatorische Regeln
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entscheidungstheorie unter Zielkonflikten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen bei Entscheidungen unter Zielkonflikten und untersucht, wie die Entscheidungstheorie dabei helfen kann. Der Fokus liegt dabei auf der präskriptiven Entscheidungstheorie, die besonders für wirtschaftliche Entscheidungen relevant ist.
Welche Arten von Entscheidungstheorien werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen deskriptiver und präskriptiver Entscheidungstheorie. Die deskriptive Entscheidungstheorie beschreibt, wie Menschen tatsächlich Entscheidungen treffen, während die präskriptive Entscheidungstheorie vorschreibt, wie rationale Entscheidungen getroffen werden *sollten*. Der Schwerpunkt liegt auf der präskriptiven Theorie.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von "Entscheidung", analysiert Zielkonflikte und deren Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse, beschreibt verschiedene Entscheidungsregeln (kompensatorisch und non-kompensatorisch, einschließlich Schwellen- und Eliminationsregeln), und untersucht Methoden zur systematischen Analyse von Zielsystemen. Es wird auch auf die Anwendung der Entscheidungstheorie zur Verbesserung der Entscheidungsfindung eingegangen.
Was sind Zielkonflikte und wie werden sie behandelt?
Zielkonflikte entstehen, wenn mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt werden, die sich gegenseitig behindern können. Die Arbeit beschreibt verschiedene Ansätze zur Behandlung von Zielkonflikten, wie effiziente Alternativen, Zieldominanz, lexikographische Ordnung und Zielgewichtung. Aus psychologischer Sicht werden kompensatorische und non-kompensatorische Entscheidungsregeln (mit Schwellen- und Eliminationsregeln) und deren Kombinationen untersucht.
Welche Entscheidungsregeln werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt sowohl kompensatorische als auch non-kompensatorische Entscheidungsregeln. Kompensatorische Regeln erlauben es, Schwächen in einem Zielbereich durch Stärken in anderen Bereichen auszugleichen. Non-kompensatorische Regeln hingegen lassen dies nicht zu und verwenden z.B. Schwellen- oder Eliminationsregeln.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und betont die Bedeutung eines rationalen Vorgehens. Kapitel 2 (Grundlagen der Entscheidungstheorie) legt die Grundlagen der deskriptiven und präskriptiven Entscheidungstheorie dar. Kapitel 3 ("Was macht Entscheidungen so schwierig?") befasst sich detailliert mit Zielkonflikten und verschiedenen Entscheidungsregeln. Kapitel 4 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Entscheidung, deskriptive Entscheidungstheorie, präskriptive Entscheidungstheorie, Zielkonflikte, Entscheidungsregeln, Zielgewichtung, kompensatorische Regeln, non-kompensatorische Regeln.
- Quote paper
- Andreas Schachermeier (Author), 2009, Entscheidungen unter Zielkonflikten: Beiträge der Entscheidungstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124188