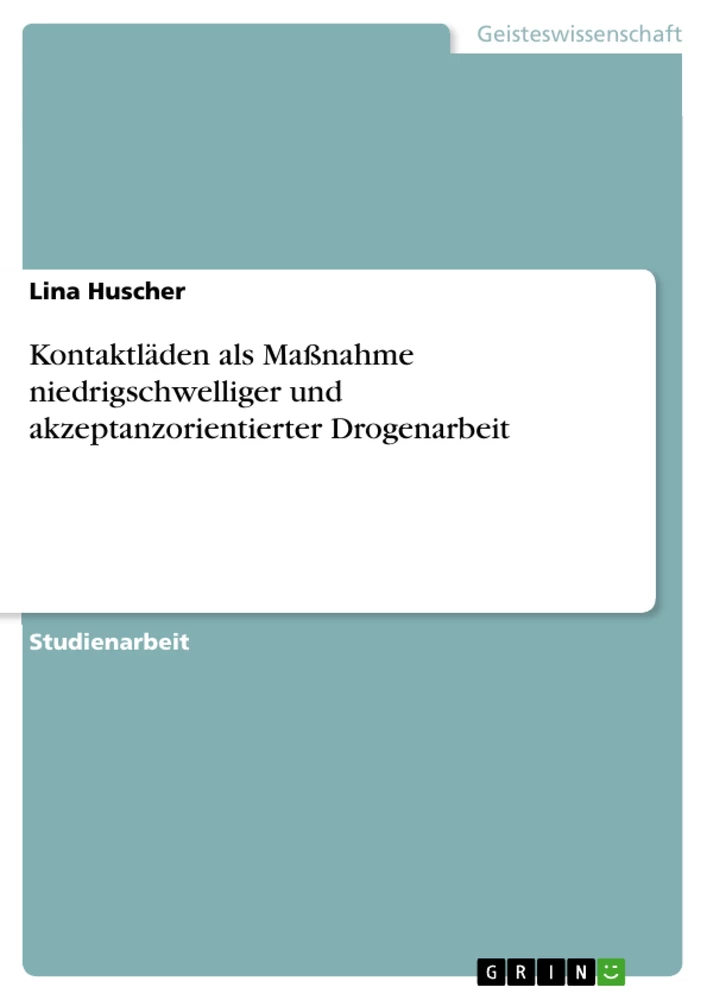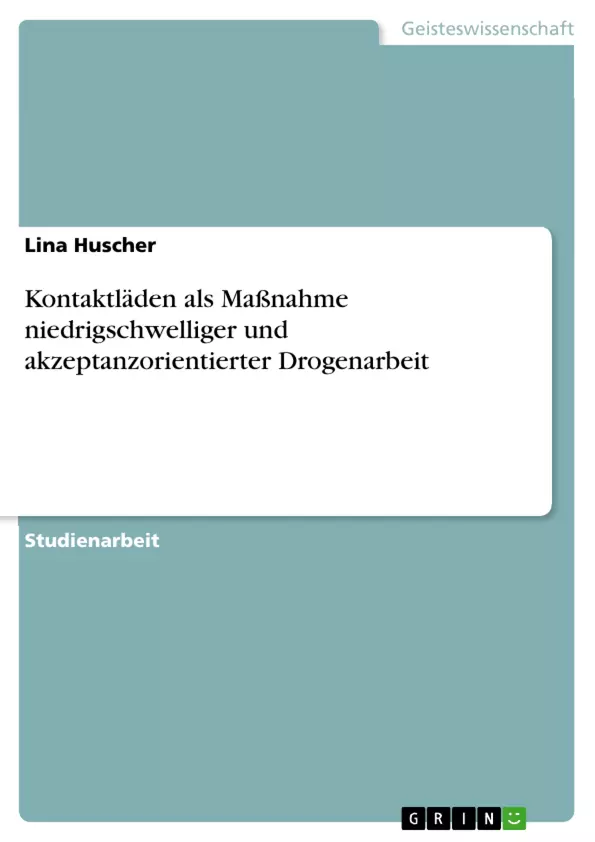Welche Möglichkeiten bieten Kontaktläden als Maßnahme niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit?
Die Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit sind vielfältig und umfangreich. Ein Bereich, der bis heute noch stark tabuisiert wird und dennoch von großer Relevanz ist, ist die Drogenarbeit. Der Konsum von Drogen nimmt seit Jahrhunderten eine bedeutende Rolle in der menschlichen Kultur ein und ist somit kein neuzeitliches Phänomen. Dennoch ist der Konsum bis heute aufgrund seines ambivalenten Charakters stark umstritten. Da Drogen nicht nur in ihrer natürlichen Form, sondern auch als Ergebnis industrieller Herstellung verwendet werden, „entwickelten sie sich sowohl zu einem unverzichtbaren Heilmittel als auch zu einem im Extremfall gesundheitsgefährdenden Konsumgut“ (Leune, 2018). Die Abhängigkeit, die als Folge des extremen Konsums vor allem bei illegalen Drogen auftritt, erregt immer wieder die Aufmerksamkeit der Gesellschaft. Aufgrund dessen und den steigenden Zahlen von Drogenkonsument*innen in den 1960er Jahren reformierte sich die zuvor sehr unspezifische Drogenhilfe, sodass zunächst abstinenzorientierte Ansätze entwickelt wurden. Da den betroffenen Personen innerhalb dieser Hilfen dennoch des Öfteren Unverständnis und Ablehnung entgegengebracht wurde, setzt hier der Ansatz der Niedrigschwelligkeit und Akzeptanzorientierung an, der vor allem durch Kontaktläden repräsentiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Drogenabhängigkeit
- 2.1 Definition Abhängigkeit
- 2.2 Faktoren, die eine Abhängigkeit begünstigen
- 2.2.1 Persönlichkeit und familiäres Umfeld
- 2.2.2 Soziales Umfeld und Peergroup
- 2.3 Folgen des Konsums
- 3. Niedrigschwellige und Akzeptanzorientierte Drogenarbeit
- 3.1 Geschichte der Drogenarbeit in Deutschland
- 3.2 Niedrigschwellige und Akzeptanzorientierte Drogenarbeit
- 3.3 Prinzipien der akzeptanzorientierten Drogenarbeit
- 4. Kontaktläden als Maßnahme akzeptanzorientierter Drogenarbeit
- 4.1 Was sind Kontaktläden?
- 4.2 Die Arbeit in Kontaktläden aus der Perspektive der Mitarbeiter*innen
- 4.3 Kontaktläden aus der Perspektive der Drogengebraucher*innen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Möglichkeiten von Kontaktläden im Rahmen niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit. Sie analysiert den Abhängigkeitsbegriff, die Faktoren, die Abhängigkeit begünstigen, und die historische Entwicklung der Drogenarbeit in Deutschland. Ein zentraler Fokus liegt auf der Erläuterung und Bewertung von Kontaktläden aus verschiedenen Perspektiven.
- Definition und Ursachen von Drogenabhängigkeit
- Historische Entwicklung der Drogenarbeit in Deutschland
- Prinzipien niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit
- Funktionsweise und Herausforderungen von Kontaktläden
- Perspektiven von Mitarbeitern und Drogengebrauchern auf Kontaktläden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Drogenarbeit ein und betont deren Relevanz trotz bestehender Tabuisierung. Sie skizziert den ambivalenten Charakter des Drogenkonsums, verweist auf die historische Entwicklung abstinenzorientierter Ansätze in der Drogenhilfe und leitet zur zentralen Fragestellung der Arbeit über: Welche Möglichkeiten bieten Kontaktläden als Maßnahme niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit? Die Arbeit strukturiert sich in eine Definition des Abhängigkeitsbegriffs, eine Erläuterung der Entstehung niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Ansätze, die Beschreibung von Kontaktläden und eine abschließende Betrachtung im Fazit.
2. Drogenabhängigkeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Abhängigkeit nach Möller als zwanghaftes Bedürfnis nach einem Suchtmittel, das sowohl durch Konsum als auch Beschaffung befriedigt wird. Es differenziert zwischen physischer Abhängigkeit (Toleranzentwicklung) und psychischer Abhängigkeit (starkes Verlangen und Akzeptanz negativer Folgen). Es werden einflussreiche Faktoren wie Persönlichkeit, familiäres Umfeld (frühe Beziehungsabbrüche, Traumatisierungen, mangelnde Akzeptanz) und soziales Umfeld (finanzielle Schwierigkeiten, Gruppenzwang in Peergroups) als Ursachen für den Übergang von unproblematischem Konsum zu Abhängigkeit herausgestellt.
3. Niedrigschwellige und Akzeptanzorientierte Drogenarbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Drogenarbeit in Deutschland, beginnend mit abstinenzorientierten Ansätzen, die oft auf Unverständnis und Ablehnung stießen. Es führt anschließend zum Konzept der niedrigschwelligen und akzeptanzorientierten Drogenarbeit als Reaktion auf diese Defizite ein. Die Prinzipien der akzeptanzorientierten Drogenarbeit werden erläutert, um das Verständnis für die im folgenden Kapitel behandelten Kontaktläden zu legen. Der Fokus liegt hier auf dem Paradigmenwechsel hin zu einem Ansatz, der die Bedürfnisse und Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt.
4. Kontaktläden als Maßnahme akzeptanzorientierter Drogenarbeit: Dieses Kapitel beschreibt zunächst den Begriff und die Funktionsweise von Kontaktläden als niederschwellige und akzeptierende Anlaufstellen für Drogengebraucher. Im Anschluss werden die Arbeit in Kontaktläden aus der Perspektive der Mitarbeiter*innen und der Drogengebraucher*innen beleuchtet, um ein umfassendes Bild der Herausforderungen und des Erfolgs dieser Maßnahme zu zeichnen. Es werden die Aufgaben, Ziele und Schwierigkeiten dieser Arbeit betrachtet, und verschiedene Perspektiven auf die Wirkung der Kontaktarbeit analysiert.
Schlüsselwörter
Drogenabhängigkeit, Kontaktläden, Niedrigschwellige Drogenarbeit, Akzeptanzorientierte Drogenarbeit, Abhängigkeit, Suchtmittel, Soziales Umfeld, Peergroup, Familiäres Umfeld, Drogenhilfe, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Kontaktläden als Maßnahme niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht Kontaktläden im Rahmen niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit. Sie analysiert den Abhängigkeitsbegriff, die Faktoren, die Abhängigkeit begünstigen, und die historische Entwicklung der Drogenarbeit in Deutschland. Ein zentraler Fokus liegt auf der Erläuterung und Bewertung von Kontaktläden aus verschiedenen Perspektiven (Mitarbeiter*innen und Drogengebraucher*innen).
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: Definition und Ursachen von Drogenabhängigkeit, historische Entwicklung der Drogenarbeit in Deutschland, Prinzipien niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit, Funktionsweise und Herausforderungen von Kontaktläden sowie Perspektiven von Mitarbeitern und Drogengebrauchern auf Kontaktläden.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Drogenabhängigkeit (inkl. Definition, begünstigende Faktoren und Folgen), Niedrigschwellige und Akzeptanzorientierte Drogenarbeit (inkl. Geschichte und Prinzipien), Kontaktläden als Maßnahme akzeptanzorientierter Drogenarbeit (inkl. Mitarbeiter- und Nutzerperspektiven) und Fazit.
Wie wird der Begriff der Drogenabhängigkeit definiert?
Die Hausarbeit definiert Drogenabhängigkeit nach Möller als zwanghaftes Bedürfnis nach einem Suchtmittel, das sowohl durch Konsum als auch Beschaffung befriedigt wird. Es wird zwischen physischer (Toleranzentwicklung) und psychischer Abhängigkeit (starkes Verlangen und Akzeptanz negativer Folgen) unterschieden.
Welche Faktoren begünstigen eine Drogenabhängigkeit?
Als einflussreiche Faktoren werden Persönlichkeit, familiäres Umfeld (frühe Beziehungsabbrüche, Traumatisierungen, mangelnde Akzeptanz) und soziales Umfeld (finanzielle Schwierigkeiten, Gruppenzwang in Peergroups) genannt.
Was versteht man unter niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit?
Niedrigschwellige und akzeptanzorientierte Drogenarbeit stellt einen Paradigmenwechsel dar, der im Gegensatz zu abstinenzorientierten Ansätzen die Bedürfnisse und Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Sie bietet unkomplizierte Hilfe und akzeptiert den Drogenkonsum als Realität.
Was sind Kontaktläden und wie funktionieren sie?
Kontaktläden sind niederschwellige und akzeptierende Anlaufstellen für Drogengebraucher. Sie bieten verschiedene Dienstleistungen an, um den Konsum zu reduzieren oder zu managen und soziale Reintegration zu unterstützen. Die Hausarbeit beleuchtet die Arbeit aus den Perspektiven der Mitarbeiter*innen und der Drogengebraucher*innen.
Welche Perspektiven werden in Bezug auf Kontaktläden betrachtet?
Die Hausarbeit betrachtet die Perspektiven sowohl der Mitarbeiter*innen in Kontaktläden als auch der Drogengebraucher*innen, um ein umfassendes Bild der Herausforderungen und des Erfolgs dieser Maßnahme zu erhalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Drogenabhängigkeit, Kontaktläden, Niedrigschwellige Drogenarbeit, Akzeptanzorientierte Drogenarbeit, Abhängigkeit, Suchtmittel, Soziales Umfeld, Peergroup, Familiäres Umfeld, Drogenhilfe, Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Lina Huscher (Autor:in), 2021, Kontaktläden als Maßnahme niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Drogenarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1242742