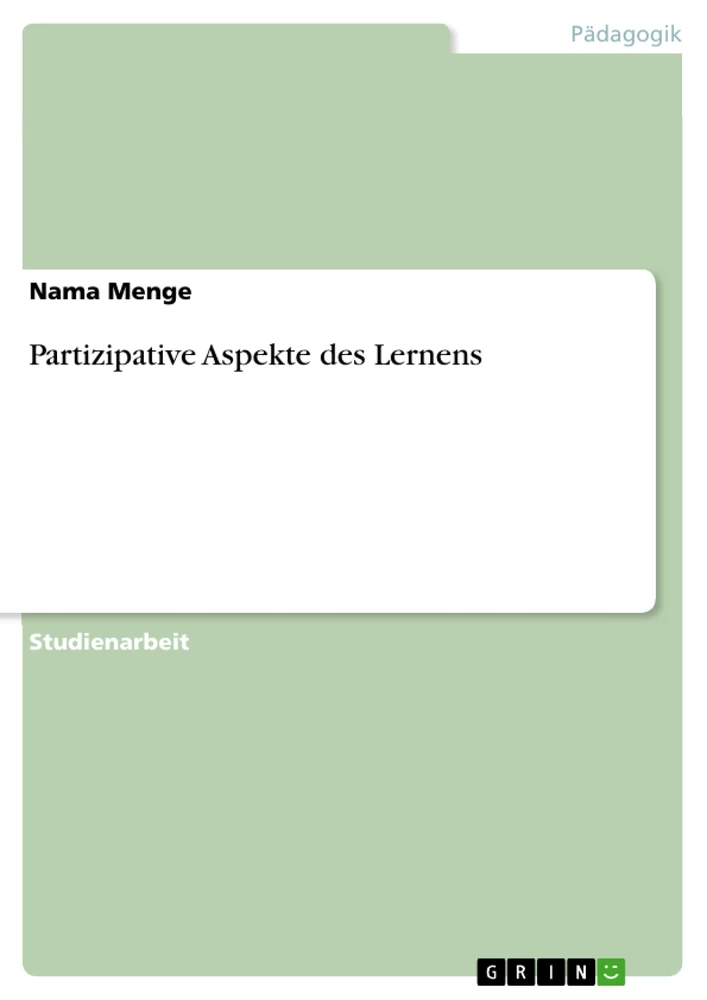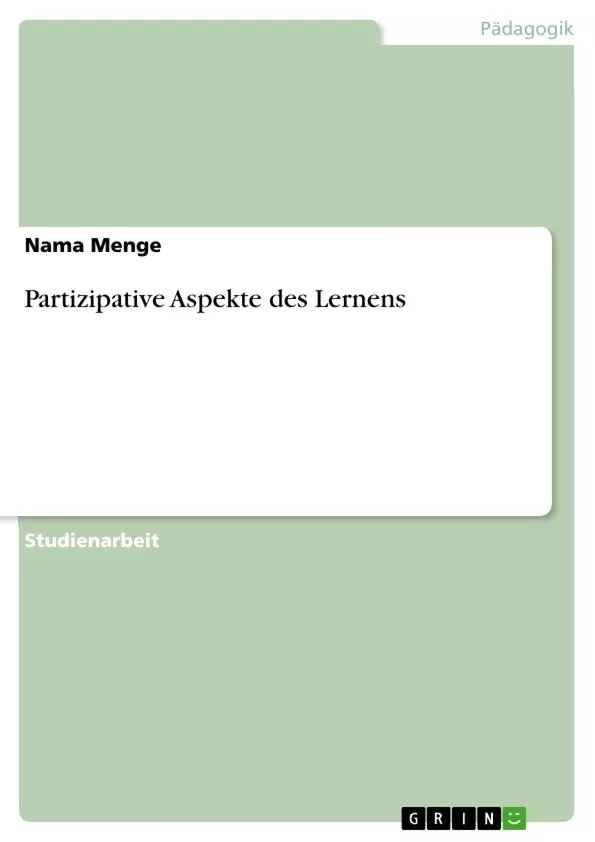Das vorliegende Portfolio „ Partizipative Aspekte des Lernens“ beschäftigt sich mit dem Thema Partizipation im Lernkontext und mit der Frage, ob die Vorteile der partizipativen Aspekte beim Lernen den mit sich bringenden Aufwand überwiegen. So wurde im Rahmen des Seminars ein Leitfadeninterview mit der Forschungsfrage "Begünstigt eine geringe Einflussnahme auf den Unterrichtsablauf mangelnde Motivation und geringeren kognitiven Leistungen der Lernenden?" durchgeführt. In dieser Arbeit werden die Hintergründe des Interviews dargestellt und das Interview wird wissenschaftlich analysiert. Des Weiteren wurde in einem Essay Untersucht, ob die positiven Auswirkungen der evidenzbasierten partizipativen Feedbackkultur den damit verbundenen Aufwand überwiegen. Abschließend wird das Seminar reflektiert. Dafür werden die Erkenntnisse, die aus dem Seminar für die partizipative Unterrichtsgestaltung gewonnen wurden, dargestellt und die Auswirkungen auf das Studium und die eigene Unterrichtspraxis als zukünftige Lehrkraft erläutert. Die Fragestellung des Portfolios wird jedoch aufgrund der Rahmenbedingungen nicht vollständig beantwortet. Es wird nur auf die Fragestellungen des Leitfadeninterviews und des Essay eingegangen.
Das Ziel des Portfolios ist es, die Ergebnisse der Arbeit im Rahmen des Seminars zu reflektieren, weiterzuführen und wissenschaftlich darzustellen.
Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung, sehen Schüler*innen für sich an Schulen keine ausreichenden Mitbestimmungsmöglichkeiten. Jedoch können nicht nur Schüler*innen, sondern auch Lehrer*innen, Eltern und das ganze System Schule von mehr Partizipationsmöglichkeiten für Lernende profitieren. Partizipationsmöglichkeiten im Unterricht fördern nicht nur das Lernen und das Lehren, sondern auch das Demokratieverständnis, den Sinn für die Gerechtigkeit und Selbstständigkeit.
Das Seminar „Partizipation im Unterricht“ beschäftigte sich mit der Rolle der Partizipation im schulischen Kontext, ihren Auswirkungen und Anwendungsmöglichkeiten der Theorie in der Praxis. So war das Seminar aktueller denn je, denn trotz der deutlichen Vorteile der partizipativen Kultur an den Schulen, wird diese vor allem seitens der Lehrer nur wenig praktiziert. Da das Seminar von angehenden Lehrkräften besucht worden war, ist man dem Ziel, die Lehrkräfte im Bereich Partizipation besser auszubilden, nähergekommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe des Interviews
- Mangelnde Partizipation und ihre Auswirkungen auf das Lernen - Wissenschaftliche Auswertung des Interviews
- Partizipative Feedbackkultur im Unterricht
- Reflexion des Seminars
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit „Partizipative Aspekte des Lernens“ befasst sich mit dem Thema Partizipation im Lernkontext. Ziel ist es, die Frage zu untersuchen, ob die Vorteile partizipativer Lernansätze den mit sich bringenden Aufwand überwiegen. Dazu wird im Rahmen des Seminars ein Leitfadeninterview mit der Forschungsfrage „Begünstigt eine geringe Einflussnahme auf den Unterrichtsablauf mangelnde Motivation und geringere kognitive Leistungen der Lernenden?“ durchgeführt und wissenschaftlich analysiert. Darüber hinaus wird in einem Essay die Frage untersucht, ob die positiven Auswirkungen einer evidenzbasierten, partizipativen Feedbackkultur den damit verbundenen Aufwand rechtfertigen. Abschließend erfolgt eine Reflexion des Seminars, in der die gewonnenen Erkenntnisse für die Gestaltung eines partizipativen Unterrichts beleuchtet werden.
- Partizipation im Lernkontext
- Auswirkungen von Partizipation auf Motivation und kognitive Leistungen
- Partizipative Feedbackkultur
- Gestaltung eines partizipativen Unterrichts
- Reflexion des Seminars und Auswirkungen auf die eigene Unterrichtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung erläutert die Relevanz von Partizipation im Bildungssystem und bezieht sich auf aktuelle Studien, die auf einen Mangel an Mitbestimmungsmöglichkeiten für Schüler*innen hinweisen. Sie stellt zudem die Ziele und Fragestellungen des Portfolios vor.
- Hintergründe des Interviews: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Leitfadeninterviews, das im Rahmen des Seminars durchgeführt wurde. Es werden die Ziele und die Forschungsfrage des Interviews erläutert, sowie die Kriterien, die bei der Erstellung des Fragebogens berücksichtigt wurden.
- Mangelnde Partizipation und ihre Auswirkungen auf das Lernen - Wissenschaftliche Auswertung des Interviews: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des Leitfadeninterviews. Es werden die Ergebnisse der Interviews ausgewertet und interpretiert, um Erkenntnisse über die Auswirkungen von Partizipation auf das Lernen zu gewinnen.
- Partizipative Feedbackkultur im Unterricht: In diesem Kapitel wird der Essay beleuchtet, der sich mit der Frage beschäftigt, ob die Vorteile einer partizipativen Feedbackkultur den damit verbundenen Aufwand überwiegen. Es werden die Argumente für und gegen eine partizipative Feedbackkultur im Unterricht diskutiert und es werden die Auswirkungen einer solchen Kultur auf das Lernen und die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden untersucht.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Partizipation im schulischen Kontext und setzt sich mit den Auswirkungen von Partizipation auf das Lernen, insbesondere auf Motivation und kognitive Leistungen auseinander. Im Fokus stehen dabei partizipative Lernansätze, Feedbackkultur, Unterrichtsgestaltung und die Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Vorteil hat Partizipation im Unterricht?
Partizipation fördert nicht nur die Motivation und kognitive Leistung, sondern auch das Demokratieverständnis, die Selbstständigkeit und den Gerechtigkeitssinn der Lernenden.
Führt geringe Mitbestimmung zu schlechteren Leistungen?
Die Forschungsfrage des untersuchten Interviews geht davon aus, dass eine geringe Einflussnahme auf den Unterricht mangelnde Motivation und geringere Leistungen begünstigt.
Was ist eine "partizipative Feedbackkultur"?
Es handelt sich um ein System, in dem Schüler und Lehrer gemeinsam den Lernprozess reflektieren und Schüler aktiv Rückmeldungen zur Unterrichtsgestaltung geben können.
Warum wird Partizipation in Schulen oft zu wenig praktiziert?
Oft scheuen Lehrkräfte den damit verbundenen organisatorischen Aufwand oder sehen keine ausreichenden Rahmenbedingungen im System Schule.
Welche Rolle spielt die Bertelsmann Stiftung in diesem Kontext?
Eine Studie der Stiftung zeigt auf, dass Schüler für sich selbst aktuell keine ausreichenden Mitbestimmungsmöglichkeiten an Schulen sehen.
- Citar trabajo
- Nama Menge (Autor), 2021, Partizipative Aspekte des Lernens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1243302