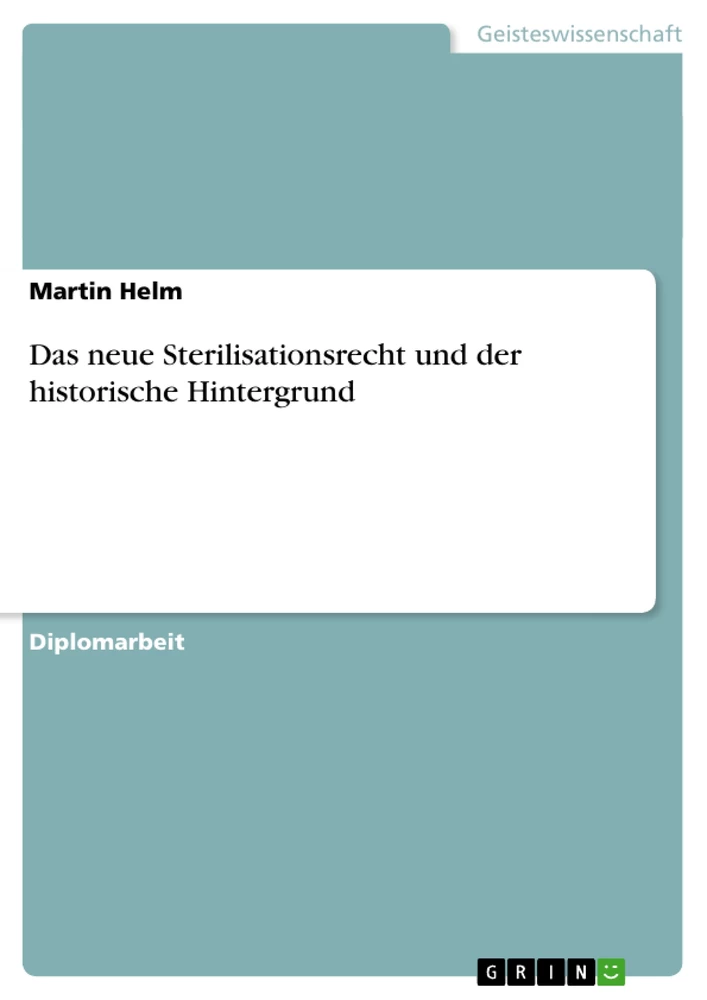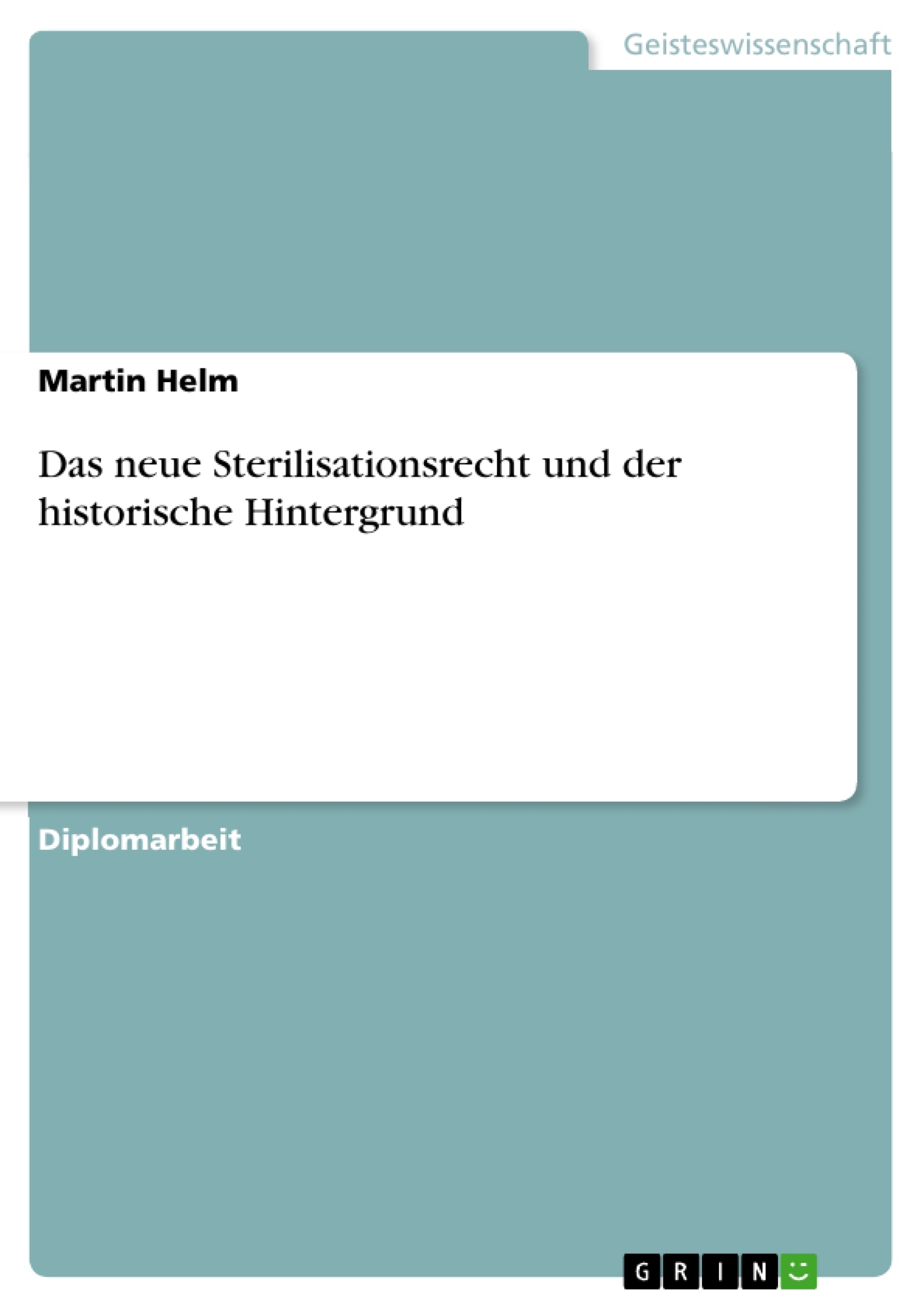Am 1. Januar 1992 ist das neue Betreuungsgesetz in Kraft getreten. Es ist das erste deutsche Gesetz nach dem Krieg, das eine Regelung der Sterilisation bei Einwilligungsunfähigkeit enthält.
Eine Regelung der Sterilisationsproblematik wurde nach dem Krieg immer wieder gefordert, weil die Rechtslage sehr unklar war. Im Jahre 1964 gab es einen kleinen "Lichtblick" durch das "Dohrn-Urteil" des Bundesgerichtshofes. Nach diesem Urteil war wenigstens die Legalitätsfrage der freiwilligen Sterilisation bei gesunden Menschen geklärt.
Lange Zeit traute man sich an eine gesetzliche Regelung nicht heran, weil dieses Thema eine hohe Brisanz aufweist. In Deutschland werden Sterilisationsdebatten immer vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus geführt.
Auf diese Erfahrungen wird im Folgenden eingegangen, indem die Entstehung und der Inhalt des Sterilisationsgesetzes im Dritten Reich ansatzweise erörtert wird. Bei der Beurteilung der Rechtslage nach 1945 ist es erforderlich, vorher die Hintergründe dieser Gesetzgebung zu kennen und die Ideen der Rassenhygiene/Eugenik zu beleuchten.
Weiter werden die Grundgedanken des neuen Betreuungsrechts als Reform des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts dargestellt. Ein Teilgebiet dieses Gesetzes, das vormundschaftsgerichtliche Verfahren für die Genehmigung der Einwilligung eines Betreuers in die Sterilisation eines Betreuten, wird ausführlich beschrieben.
Um einen Überblick über die Sterilisationsmethoden zu vermitteln, werden die gebräuchlichsten Methoden in Kapitel VII kurz vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Hintergründe der Sterilisationsgesetzgebung vor 1933
- 2.1 Der Sozialdarwinismus als Wegbereiter der Rassenhygiene/Eugenik
- 2.2 Die Entstehungsgeschichte der Sterilisationsgesetzgebung bis 1933
- III. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
- 3.1 Der § 226a StGB vom 26. Mai 1933
- 3.2 Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) vom 14. Juli 1933 (Erbgesundheitsgesetz)
- 3.3 Der § 226b StGB vom 18. März 1943
- IV. Die Rechtslage nach 1945
- 4.1 Die Übernahme der Sterilisationsgesetzgebung durch die Besatzungsmächte
- 4.2 Das Dohrn-Urteil des BGH aus dem Jahre 1964
- 4.3 Ein Sonderproblem: einwilligungsunfähige Behinderte
- 4.4 Reformüberlegungen
- V. Das neue Betreuungsrecht vom 12. September 1990
- 5.1 Allgemeines zum Betreuungsrecht
- 5.2 Die Intentionen des Gesetzgebers
- 5.3 Die Sterilisierungsfrage im Gesetzentwurf
- 5.4 Die ab 1. Januar 1992 geltende Rechtslage für die Sterilisation
- 5.4.1 Einwilligungsfähige Volljährige
- 5.4.2 Minderjährige
- 5.4.3 Auf Dauer einwilligungsunfähige Volljährige
- VI. Verfahrensschritte
- 6.1 Der Sterilisationsbegriff in § 1905 BGB
- 6.2 Äußerung des Sterilisationswunsches durch den Betroffenen oder Dritte
- 6.3 Die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung
- 6.3.1 Die Bestellung eines Verfahrenspflegers
- 6.3.2 Die Bestellung eines besonderen Betreuers
- 6.3.3 Anhörungen durch das Vormundschaftsgericht
- 6.3.4 Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 1905 BGB
- 6.3.4.1 Der Wille des Betreuten
- 6.3.4.2 Die dauerhafte Einwilligungsunfähigkeit
- 6.3.4.3 Besteht eine konkrete Schwangerschaftsgefahr?
- 6.3.4.4 Besteht eine Notlage für die Schwangere oder ist eine durch die Schwangerschaft verursachte Notlage zu erwarten?
- 6.3.4.5 Gibt es alternative Verhütungsmöglichkeiten?
- 6.3.5 Die erforderlichen Sachverständigengutachten
- 6.3.6 Das Schlußgespräch
- 6.3.7 Die Wirksamkeit der gerichtlichen Genehmigung und der Zeitpunkt des Eingriffs
- 6.3.8 Beschwerdemöglichkeiten
- VII. Die Durchführung der Sterilisation
- 7.1 Die Wahl der Operationsmethode und die Refertilisierungsmöglichkeiten
- 7.1.1 Die Laparoskopie
- 7.1.2 Die Laparotomie
- 7.1.3 Die Hysterektomie
- 7.1.4 Refertilisierungsmöglichkeiten
- 7.1.5 Die Vasektomie beim Mann und die Refertilisierungsmöglichkeiten
- 7.1 Die Wahl der Operationsmethode und die Refertilisierungsmöglichkeiten
- VIII. Schlußbetrachtungen
- 8.1 Welche Fälle kommen für eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung der Sterilisation noch in Betracht?
- 8.2 Gibt es trotz dieser gesetzlichen Regelung Mißbrauchsmöglichkeiten?
- 8.3 Das Sterilisationsverfahren und die Arbeit des Sozialarbeiters/Sozialpädagogen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem neuen Sterilisationsrecht in Deutschland und untersucht dessen historischen Hintergrund.
- Die Entwicklung der Sterilisationsgesetzgebung vor 1933
- Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) von 1933
- Die Rechtslage nach 1945
- Das neue Betreuungsrecht von 1990 und seine Auswirkungen auf die Sterilisationsfrage
- Die Verfahrensschritte bei der Sterilisation und die Rolle von Sachverständigen
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel behandelt die Hintergründe der Sterilisationsgesetzgebung vor 1933, wobei der Einfluss des Sozialdarwinismus und der Rassenhygiene/Eugenik beleuchtet wird. Kapitel drei analysiert das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) von 1933 und seine Anwendung im NS-Regime. Kapitel vier widmet sich der Rechtslage nach 1945, einschließlich der Übernahme der Sterilisationsgesetzgebung durch die Besatzungsmächte und dem Dohrn-Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahre 1964. Kapitel fünf befasst sich mit dem neuen Betreuungsrecht von 1990 und dessen Auswirkungen auf die Sterilisationsfrage. Im sechsten Kapitel werden die Verfahrensschritte bei der Sterilisation im Detail betrachtet, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen, der Anhörungen und der Sachverständigengutachten.
Schlüsselwörter
Sterilisationsrecht, Rassenhygiene, Eugenik, Erbgesundheitsgesetz, Betreuungsrecht, Einwilligungsunfähigkeit, Verfahrensschritte, Sachverständige, Sozialdarwinismus.
Häufig gestellte Fragen
Wann trat das neue Betreuungsgesetz in Kraft?
Das neue Betreuungsgesetz trat am 1. Januar 1992 in Kraft.
Welche historische Bedeutung hat das Thema Sterilisation in Deutschland?
Sterilisationsdebatten werden in Deutschland immer vor dem Hintergrund der Rassenhygiene und Eugenik des Nationalsozialismus geführt.
Was regelte das "Dohrn-Urteil" von 1964?
Es klärte die Legalität der freiwilligen Sterilisation bei gesunden Menschen.
Welche Voraussetzungen müssen für eine Sterilisation bei Einwilligungsunfähigen erfüllt sein?
Es bedarf einer vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung, der Prüfung einer konkreten Schwangerschaftsgefahr und der Abwägung von Alternativen gemäß § 1905 BGB.
Welche Operationsmethoden werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt Methoden wie Laparoskopie, Laparotomie, Hysterektomie und die Vasektomie beim Mann.
- Arbeit zitieren
- Martin Helm (Autor:in), 1994, Das neue Sterilisationsrecht und der historische Hintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12434