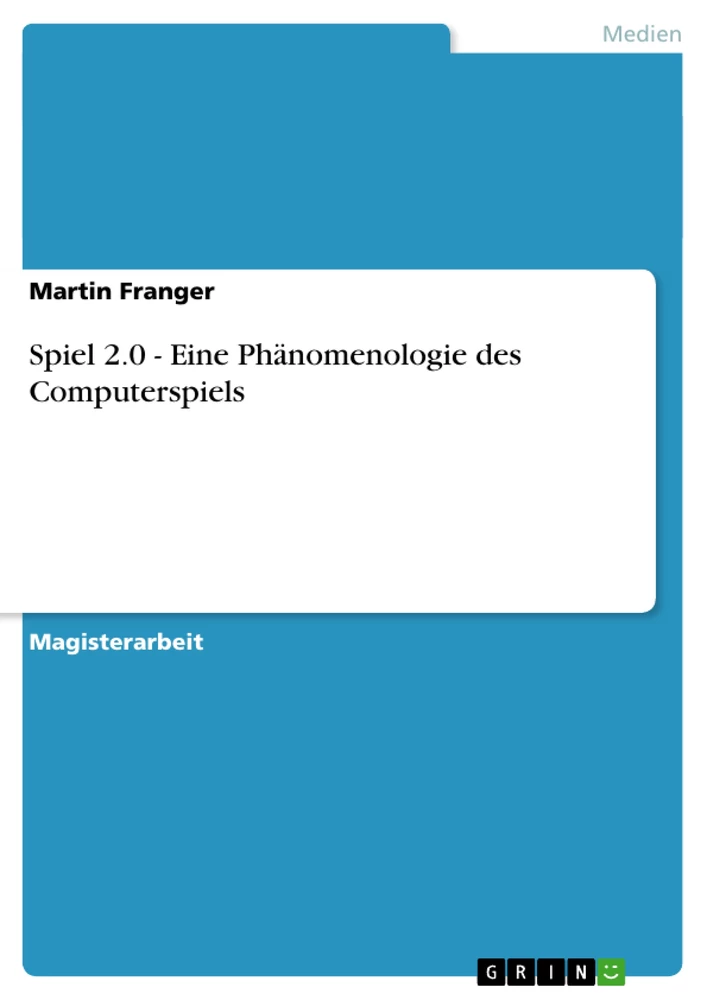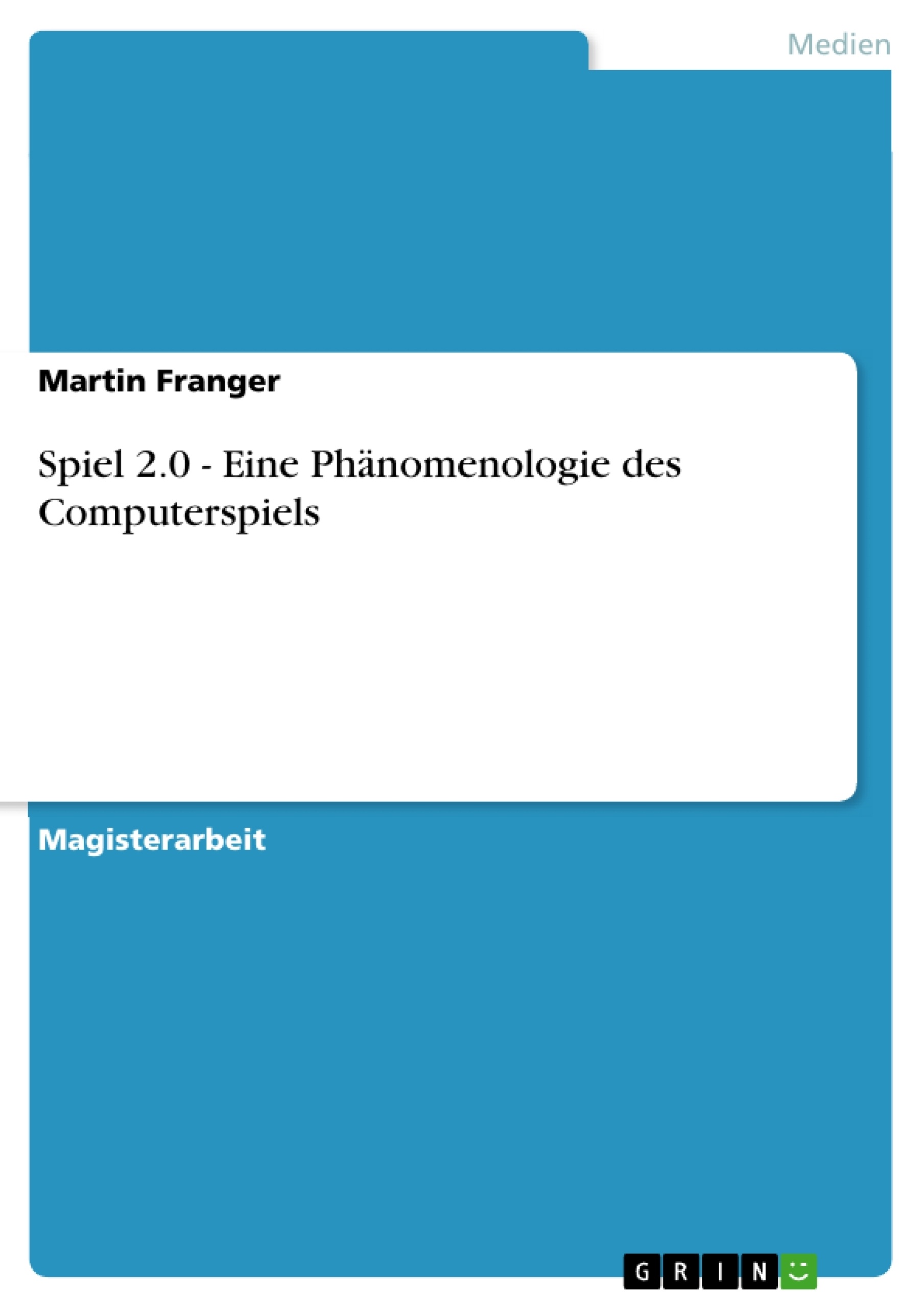Nolan Bushnell entwickelte das erste populäre Computerspiel 1972 in seiner Garage: „Pong“. Mit zwei Drehknöpfen steuerte der Spieler zwei Striche auf dem Monitor, die einen Punkt treffen mussten. Trotz dieser simpelsten Form einer Tischtennissimulation faszinierte „Pong“ unzählige Menschen und erwies sich als großer Verkaufserfolg. 35 Jahre später ist die Faszination von Computerspielen ungebrochen. Aus zwei Strichen auf dem Monitor sind dreidimensionale Spielkonstrukte von ungeahnter Komplexität geworden, die Millionen von Spieler zum Eintauchen in die virtuellen Welten motivieren.
Das Computerspiel ist heute zu einem festen Bestandteil der postmodernen Populärkultur, aber auch der Unterhaltungsindustrie geworden. Computer- und Videospiele setzen weltweit deutlich über 20 Mrd. $ um – allein in Deutschland 2005 knapp 1 Mrd. Euro. Das am stärksten wachsende Segment der Medienwirtschaft hat damit mittlerweile den Umsatz von Filmtheatern überholt. Der Wachstumstrend ist seit fünf Jahren ungebrochen: 2006 stieg der Umsatz um sieben Prozent auf ca. 1,2 Mrd. Euro. Für das Jahr 2010 wird gar eine Verdopplung des Marktvolumens für Computer- und Videospiele auf 2,6 Mrd. Euro prognostiziert. Entsprechend umfangreich ist auch die Ausstattung der Bundesbürger mit der zum Spielen benötigten Hardware: 2008 wird voraussichtlich jeder zweite Einwohner Deutschlands über einen Computer verfügen.
Dieser mediale Boom wirkt sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell aus. So ist das neun Jahre alte Echtzeit-Strategiespiel „Starcraft“ in Südkorea zum prestige-trächtigen Volkssport avanciert, der eine Medienpräsenz wie hierzulande etwa der Fuß-ball erreicht. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich im Falle des Online-Rollenspiels „World of Warcraft“, das weltweit nahezu 9 Millionen Spieler verzeichnet.
Insbesondere in der Lebenswelt von Heranwachsenden ersetzt das beliebte Unterhaltungsmedium zunehmend klassische Spielformen. Trotz seiner wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung, wird das vergleichsweise junge Medium allerdings sowohl von der Forschung als auch von Öffentlichkeit und Politik noch recht stiefmütterlich behandelt. So zeigt sich beispielsweise eindrucksvoll an der aktuellen Debatte um das Verbot der sogenannten „Killerspiele“, wie unzureichend die meisten Menschen im Grunde über die Tätigkeit des Computerspielens informiert sind. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Phänomenologie des Spiels
- 2.1. Ältere Spieltheorien
- 2.2. Das Wesen des Spiels
- 2.3. Die Struktur des Spiels
- 2.3.1. Spieldimensionen
- 2.3.2. Klassifizierung von Spielkonstrukten
- 2.4. Die Psychologie des Spiels
- 2.4.1. Spiel als Realitätskonstruktion
- 2.4.2. Intrinsische Motivation und autotelisches Erleben
- 2.4.3. Sensation-Seeking
- 2.4.4. Das Flow-Erlebnis
- 3. Typisierung und Charakterisierung des Computerspiels
- 3.1. Übertragung der ludischen Wesensmerkmale
- 3.2. Die Landschaft der Computerspiele
- 3.2.1. Klassische Genrebildung
- 3.2.2. Einteilung nach Jürgen Fritz
- 4. Die Reizkonfiguration des Computerspiels
- 5. Interaktion und Immersion in virtuellen Spielwelten
- 5.1. Interaktivität
- 5.1.1. Der Aufforderungscharakter des Computerspiels
- 5.2. Immersion
- 5.3. Interaktive Geschichten und parasoziale Interaktion
- 6. Die Psychologie des Computerspiels
- 6.1. Macht und Kontrolle im Computerspiel
- 6.2. Strukturelle Kopplung von Spielmotivation und Spielhandlung
- 6.3. Übertragung der spielpsychologischen Ansätze
- 6.4. Flow im Computerspiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit zielt auf eine fundamentale Wesensbeschreibung des Computerspiels ab, um dessen Faszination zu erklären. Es wird untersucht, welche Motive Spieler antreiben und wie die Faszination von Bildschirmspielen entsteht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob klassische Spielkonzepte zur Beschreibung des komplexen Spielerlebnisses von Computerspielen ausreichen.
- Phänomenologie des Spiels und deren Übertragbarkeit auf Computerspiele
- Charakterisierung und Typisierung des Computerspiels
- Reizkonfiguration und Immersion in virtuellen Spielwelten
- Psychologische Aspekte des Computerspiels (Motivation, Flow-Erlebnis)
- Untersuchung der Frage, ob Computerspiele "nur" Spiele sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beleuchtet die rasante Entwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg von Computerspielen, unterstreicht deren kulturelle Bedeutung und führt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit ein.
Kapitel 2 (Phänomenologie des Spiels): Dieses Kapitel untersucht klassische Spieltheorien, das Wesen und die Struktur des Spiels sowie dessen psychologische Aspekte wie intrinsische Motivation und Flow-Erlebnis.
Kapitel 3 (Typisierung und Charakterisierung des Computerspiels): Hier werden die ludischen Wesensmerkmale auf Computerspiele übertragen und die Landschaft der Computerspiele anhand klassischer Genrebildung und nach Jürgen Fritz eingeteilt.
Kapitel 4 (Die Reizkonfiguration des Computerspiels): Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Reize, die Computerspiele erzeugen.
Kapitel 5 (Interaktion und Immersion in virtuellen Spielwelten): Die Kapitel behandelt die Interaktivität, Immersion und interaktive Geschichten im Kontext von Computerspielen.
Kapitel 6 (Die Psychologie des Computerspiels): Hier werden Aspekte wie Macht und Kontrolle, die Kopplung von Spielmotivation und -handlung sowie der Flow im Computerspiel untersucht.
Schlüsselwörter
Computerspiel, Spieltheorie, Phänomenologie, Interaktivität, Immersion, Spielpsychologie, Motivation, Flow-Erlebnis, Genre, Virtuelle Realität, Online-Spiele.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der "Phänomenologie des Computerspiels"?
Die Arbeit untersucht das Wesen des Computerspiels, um dessen besondere Faszination und die psychologischen Motive der Spieler zu erklären.
Was versteht man unter dem "Flow-Erlebnis" beim Spielen?
Flow beschreibt einen Zustand des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit, bei dem die Zeitwahrnehmung schwindet und die Herausforderung genau den Fähigkeiten entspricht.
Wie unterscheiden sich Computerspiele von klassischen Spielformen?
Durch Aspekte wie Immersion in virtuelle Welten, komplexe Interaktivität und die Möglichkeit, interaktive Geschichten selbst zu beeinflussen.
Welche Rolle spielt "Sensation-Seeking" für die Spielmotivation?
Es beschreibt das Bedürfnis nach neuen, abwechslungsreichen und intensiven Eindrücken, die Computerspiele durch ihre Reizkonfiguration bieten.
Was wird in der Debatte um "Killerspiele" kritisiert?
Die Arbeit weist darauf hin, dass die öffentliche Debatte oft auf unzureichenden Informationen über die tatsächliche Tätigkeit des Computerspielens basiert.
- Arbeit zitieren
- M.A. Martin Franger (Autor:in), 2007, Spiel 2.0 - Eine Phänomenologie des Computerspiels, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124387