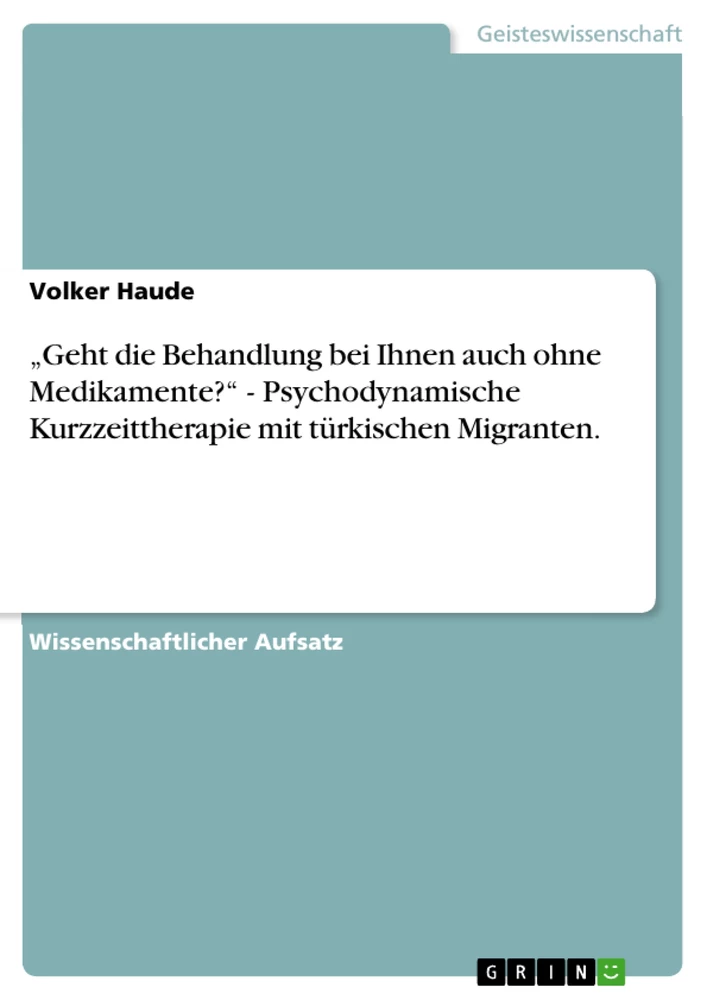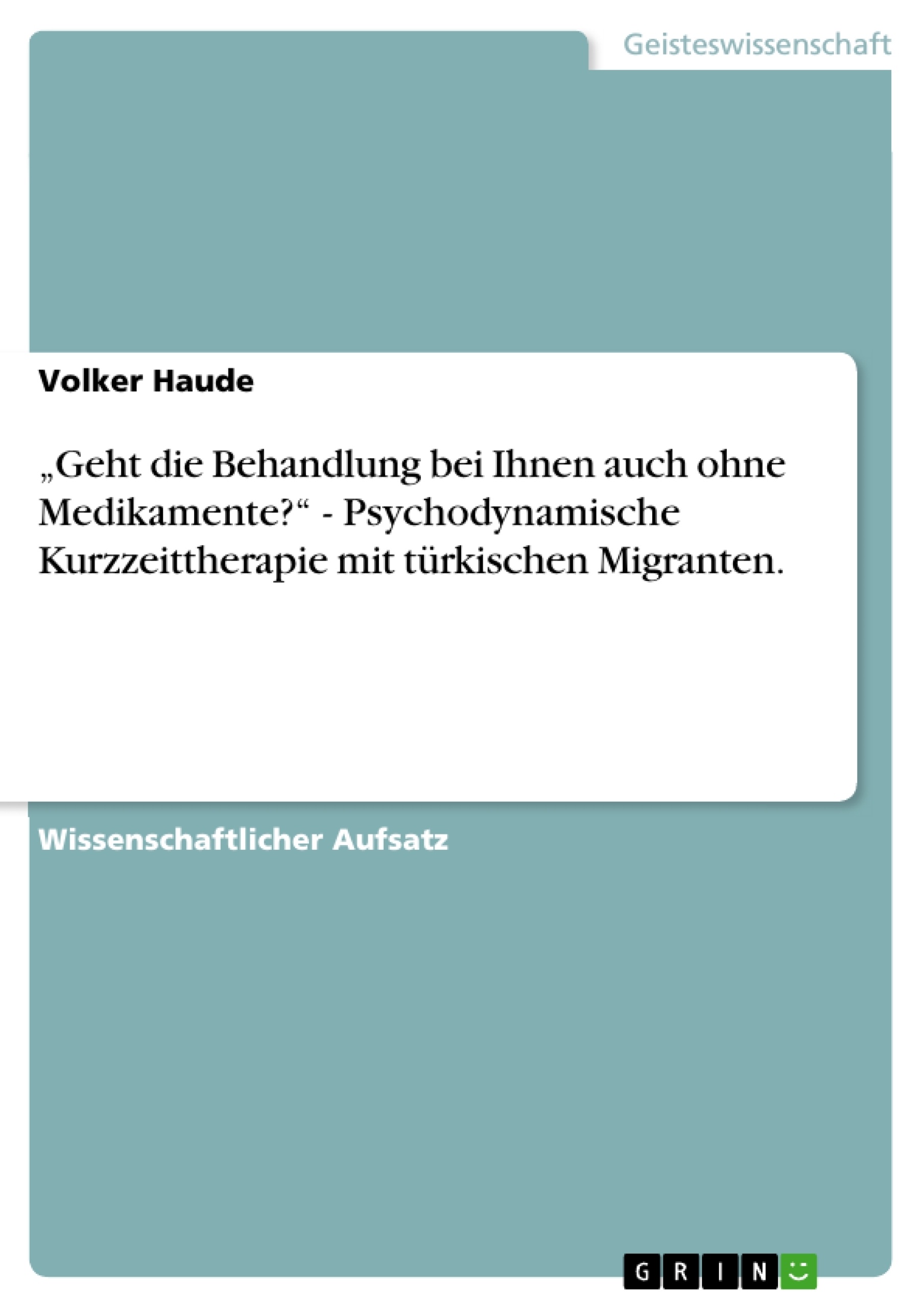Der Autor stellt in dieser kurzen Übersicht dar, wie psychodynamische Psychotherapie praktiziert werden kann. Er illustriert dieses an einem Fallbeispiel einer türkischen Patientin und beschreibt ein erfahrungsgeleitetes Konzept von Kurzzeittherapie mit der Katathym Imaginativen Psychotherapie. Das technische Vorgehen wird kurz dargestellt und supervisorische Aspekte vor dem interkulturellen Hintergrund diskutiert.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Fall
3. Diskussion
4. Schlussbemerkung
5. Literatur
1. Einleitung:
„Herr Doktor, ich habe gehört die Behandlung bei ihnen geht auch ohne Medikamente. Ich war bereits bei 15 verschiedenen Ärzten, “ sprach die Patientin und schüttete auf meinem Schreibtisch eine Plastiktüte mit ca. 20 z. T. angebrochenen oder neuen Medikamentenverpackungen aus, durch die ich mich dann durcharbeiten konnte. Die Tatsache, dass Menschen über Beschwerden berichten, für die keine medizinischen oder biologischen Ursachen gefunden werden und demzu- folge keine ursächlichen Behandlungsmethoden bestehen hat man schon vor etwa 100 Jahren gut beschrieben (Dubois 1910): „Die Psychiater fassen die Psychopathien als wahre Krankheiten im Sinne der internen Pathologie auf, und suchen die Ursache der psychischen Störung in einer pri- mären Erkrankung des Denkorgans. Sie vergessen, daß auch bei anderen Organen Funktionsstö- rungen ohne primäre Schädigung des Organs entstehen können. Ein dyspeptischer Zustand kann seine Ursache in einer Erkrankung des Magens haben; er kann aber auch bei normalem Magen infolge unzweckmäßiger Ingesta entstehen. Die Ingesta, welche unsere „Seele” verarbeitet, man könnte sagen, verdaut, sind Vorstellungen, Ideen. Wie unser Magenzustand sehr von der Qualität der Nahrung abhängt, so ist auch unser Seelenzustand in hohem Maße von den aufgenommenen Vorstellungen abhängig.“ Psychotherapeutischen Behandlungen von Patienten mit Migrations- hintergrund insbesondere bei fehlender oder reduzierter Sprachkompetenz in Deutsch beschrän- ken sich auf Falldarstellungen und es fehlt leider eine systematisierte Vorgehensweise für diese Patienten in Psychotherapie. Aufgrund der Nachfrage an unserer Klinik haben wir eine sogenann- te Interkulturelle Ambulanz für vorwiegend Türkisch-sprachige und Russisch-sprachige Patienten aufgebaut. Unsere Ambulanz versorgt die Stadt und den Kreis Gütersloh und wird auch von Pati- enten aus Bielefeld in Anspruch genommen, sie ist also in einer Region mit über 350 000 Ein- wohnern davon ca. 20 % Ausländern bzw. Menschen mit Migrationshintergrund angesiedelt. Es gibt keine vergleichbare Stelle in dieser Region. Die psychotherapeutische Behandlung mit Tür- kisch-sprachigen Patienten möchte ich zunächst anhand eines Fallbeispiels illustrieren.
2. Der Fall:
Fr. B kommt in meine Ambulanz, weil sie Darm-Probleme habe. Sie klagt über häufige Bauch- schmerzen und durchfälligen Stuhldrang. Die Ärzte, die sie bisher aufgesucht habe, hätten ihr nicht helfen können, im Übrigen stehe sie Medikamenten kritisch gegenüber. Es sei auch eine Darmspiegelung gemacht worden, da sei aber nichts wesentliches herausgekommen und zusätz- lich habe sie seit langem Magenbeschwerden, habe auch vor 10 bis 15 Jahren eine Magenblutung gehabt und schließlich leide sie unter Gefühlsstörungen im re. Arm, deswegen sei sie vor kurzem beim Nervenarzt in Behandlung gewesen, habe auch eine Schiene bekommen, nun habe ihr der Hausarzt erklärt, dass dieses alles mit ihrer psychischen Problematik zusammen hängen würde und sie habe sich deswegen der psychiatrischen Behandlung zugewandt.
Ihre Erwartungen an uns: Sie äußert, dass sie zu ihrem alten Zustand zurückkehren möchte, da- mals als sie noch lustig sein konnte, als es ihr gut gegangen sei, vor etwa 3 bis 4 Jahren sei sie ein fröhlicher Mensch gewesen, dann sei es nach und nach schlimmer geworden und im letzten Jahr sei es ganz verstärkt.
Vorgeschichte:
Die Patientin ist 48 Jahre alt, komme gebürtig aus einer Stadt in der Nähe von Adana und sei 1975 im Rahmen der Familienzusammenführung von ihrem Ehemann nach Deutschland geholt worden. Sie habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter (19 und 25 Jahre alt). Sie sei gelernte Friseurin, habe bis zur 5. Klasse die Schule besucht, ihre Eltern würden noch leben, seien Rentner und würden jeweils einige Monate in der Türkei und einige Monate in Deutschland verbringen.
Mit ihrer älteren Schwester, die ebenfalls am Ort wohne, verstehe sie sich überhaupt nicht, sie würden kaum miteinander reden – es gebe eine lange Geschichte von Eifersucht und Verletzung, weswegen der Kontakt abgebrochen sei. Derzeit arbeite sie als Leiharbeiterin, sie als Familie hätten sich vor kurzem ein Haus gekauft und stünden deswegen unter großem finanziellen Druck. Zentrales Thema oder Fokus: Ich formuliere zunächst, dass es um Symptomlinderung geht und der Versuch, die körperliche Symptompräsentation auf die verbale Konfliktebene zu heben.
Ressourcen: Es besteht noch Arbeitsfähigkeit, d.h. sie geht einer regelmäßigen Arbeit nach, sie gibt die Unterstützung durch ihren Ehemann an und sie hat offensichtlich eine Fähigkeit Aufga- ben anzugehen, zu lösen und beharrlich zu sein. Sie ist Mutter von 2 Kindern zu denen wohl ein gutes Verhältnis besteht und diese Beziehung scheint ihr wichtig.
Verlauf:
Ich bespreche mit ihr die Methodik der Psychotherapie (Therapie mit Worten) im Vergleich zur medikamentösen Therapie.
In der 2. Sitzung erscheint sie spontan mit ihrem Ehemann, nicht vorher abgesprochen und das Gespräch geht darüber, dass sie sich oft streiten würden.
Fokalziel dieser Stunde: Wie kann sie Unterstützung im täglichen Leben bekommen, wie steht es mit der Unterstützung durch ihre Eltern. Ich frage sie, wie es wohl ihrer Mutter ergangen ist, als diese genauso alt war wie sie. Sie gab zu, dass es ihre Mutter damals wohl schwer gehabt haben muss.
Beim nächsten Termin erscheint sie nicht:
Es kristallisiert sich heraus, dass sie kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter habe und meine, die Mutter wertschätze nicht sie, sondern ihre Schwester. An dieser Stelle begriff ich, dass ich mit dem Thema ihrer Mutter unmittelbar einen Konfliktbereich angesprochen hatte, der von ihr durch das Nicht-Erscheinen abgewehrt wurde.
3. Sitzung
Die Patientin berichtet über Durchfall und schlechtes Schlafen.
Ich biete ein ressourcenorientiertes Tagtraum-Motiv den Baum an: großer Baum, sehr groß, viel grün, hört Vögel zwitschern, schönes Wetter, Sonne, ein Baum aus ihrer Kindheit, Boden ist braun, trocken, beim anfassen der Rinde des Baumes breche sie spontan ein Stück glatte Rinde ab, dies fällt zu Boden, hierbei wird sie traurig und weint, darunter erscheint der Baum weiß. Der Baum brauche Wasser, habe aber nicht ausreichend, er ziehe Wasser mit den Wurzeln aus der Tiefe des Bodens, sie möchte auf diesen Baum gut acht geben.
Fokus: In dieser Sitzung stehen die Selbstfürsorge, das Selbstverständnis und die Stärken ihrer Persönlichkeit im Vordergrund.
4. Sitzung
Es erfolgt die Rückblende auf die vorhergehende Stunde: Sie habe viel über den Traum nachge- dacht, habe sich dann leichter gefühlt, auch die Arbeit habe gut geklappt, inzwischen hätte der Ehemann auch Arbeit gefunden. Sie äußert die Assoziation, dass die „Verletzung“ der Rinde et- was mit der Schwester zu tun habe, mit der sie keinen Kontakt pflege.
Sie meint sie habe sich in dem Sinne verändert, dass sie selbstbewusster geworden sei. Sie habe letztens mal das Geschirr nicht gleich für alle weggeräumt und die Familie habe sie gefragt, ob mit ihr irgendetwas los sei, sie sei anders geworden. Auch habe sie sich nun entschieden eine eigene häusliche Schneiderei zu eröffnen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text ist eine Falldarstellung einer psychotherapeutischen Behandlung einer türkisch-sprachigen Patientin mit Migrationshintergrund. Er enthält eine Einleitung, die den Kontext der interkulturellen Ambulanz und die Herausforderungen bei der Behandlung von Patienten mit Migrationshintergrund beschreibt. Anschließend wird der Fall der Patientin detailliert dargestellt, einschließlich ihrer Beschwerden, Erwartungen, Vorgeschichte und des Therapieverlaufs.
Wer ist die Patientin in dem Fallbeispiel?
Die Patientin, Frau B., ist eine 48-jährige türkisch-sprachige Frau, die 1975 im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland kam. Sie leidet unter Darmproblemen, Magenschmerzen, Gefühlsstörungen im rechten Arm und psychischen Problemen.
Welche Erwartungen hat die Patientin an die Behandlung?
Die Patientin wünscht sich, zu ihrem früheren Zustand zurückzukehren, als sie noch fröhlich und unbeschwert war. Sie hofft auf eine Linderung ihrer Symptome und eine Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens.
Was sind die wichtigsten Themen oder Schwerpunkte in der Therapie?
Zu den wichtigsten Themen gehören die Linderung der körperlichen Symptome, die Förderung der Selbstfürsorge, das Verständnis der eigenen Stärken, die Auseinandersetzung mit Konflikten (insbesondere mit der Mutter und Schwester) und die Verbesserung des Selbstbewusstseins.
Welche Methoden werden in der Therapie angewendet?
Die Therapie konzentriert sich auf Gespräche und die verbale Auseinandersetzung mit Konflikten. Es werden auch ressourcenorientierte Tagtraum-Motive eingesetzt, um die Patientin zu stärken und ihr Selbstverständnis zu fördern.
Welche Ressourcen werden bei der Patientin identifiziert?
Zu den Ressourcen der Patientin gehören ihre Arbeitsfähigkeit, die Unterstützung durch ihren Ehemann, ihre Fähigkeit, Aufgaben anzugehen und zu lösen, und ihre Beziehung zu ihren Kindern.
Was ist das Ziel der Interkulturellen Ambulanz, in der die Patientin behandelt wird?
Die Interkulturelle Ambulanz wurde aufgrund der Nachfrage nach psychotherapeutischer Behandlung für türkisch- und russischsprachige Patienten aufgebaut. Sie bietet eine spezialisierte Versorgung für Menschen mit Migrationshintergrund in der Region Gütersloh und Bielefeld.
Gibt es in dem Text eine Schlussfolgerung oder Zusammenfassung?
Der vorliegende Text ist eine Falldarstellung und enthält keine explizite Schlussfolgerung. Es wird jedoch der Therapieverlauf und die Entwicklung der Patientin beschrieben, was Einblicke in die Wirksamkeit der interkulturellen Psychotherapie geben kann.
- Quote paper
- Dr. Volker Haude (Author), 2009, „Geht die Behandlung bei Ihnen auch ohne Medikamente?“ - Psychodynamische Kurzzeittherapie mit türkischen Migranten., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124414