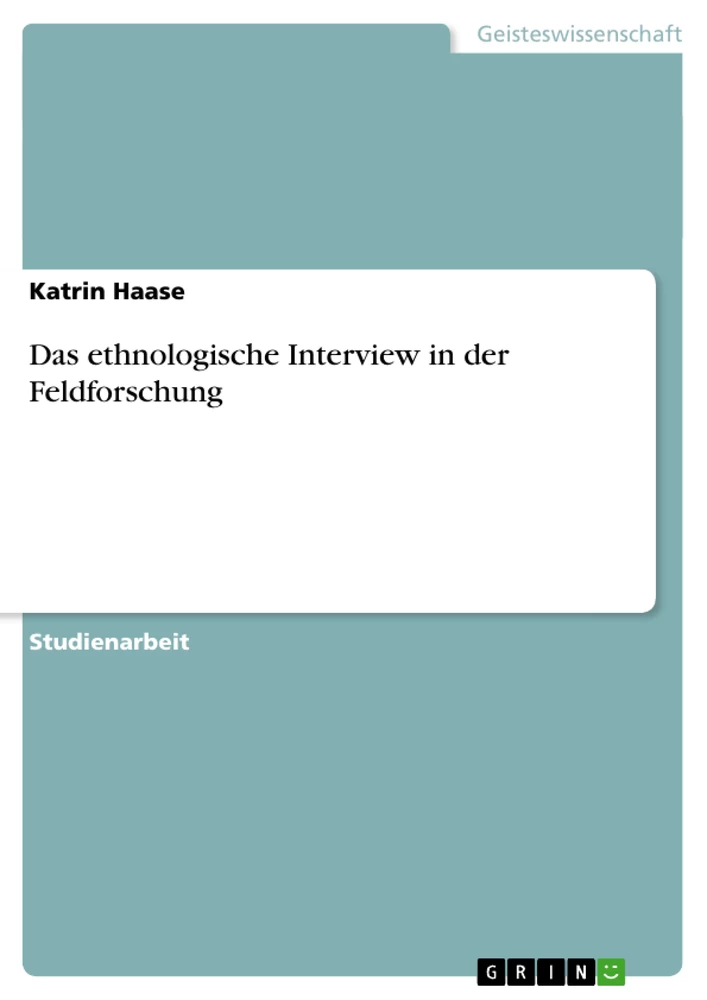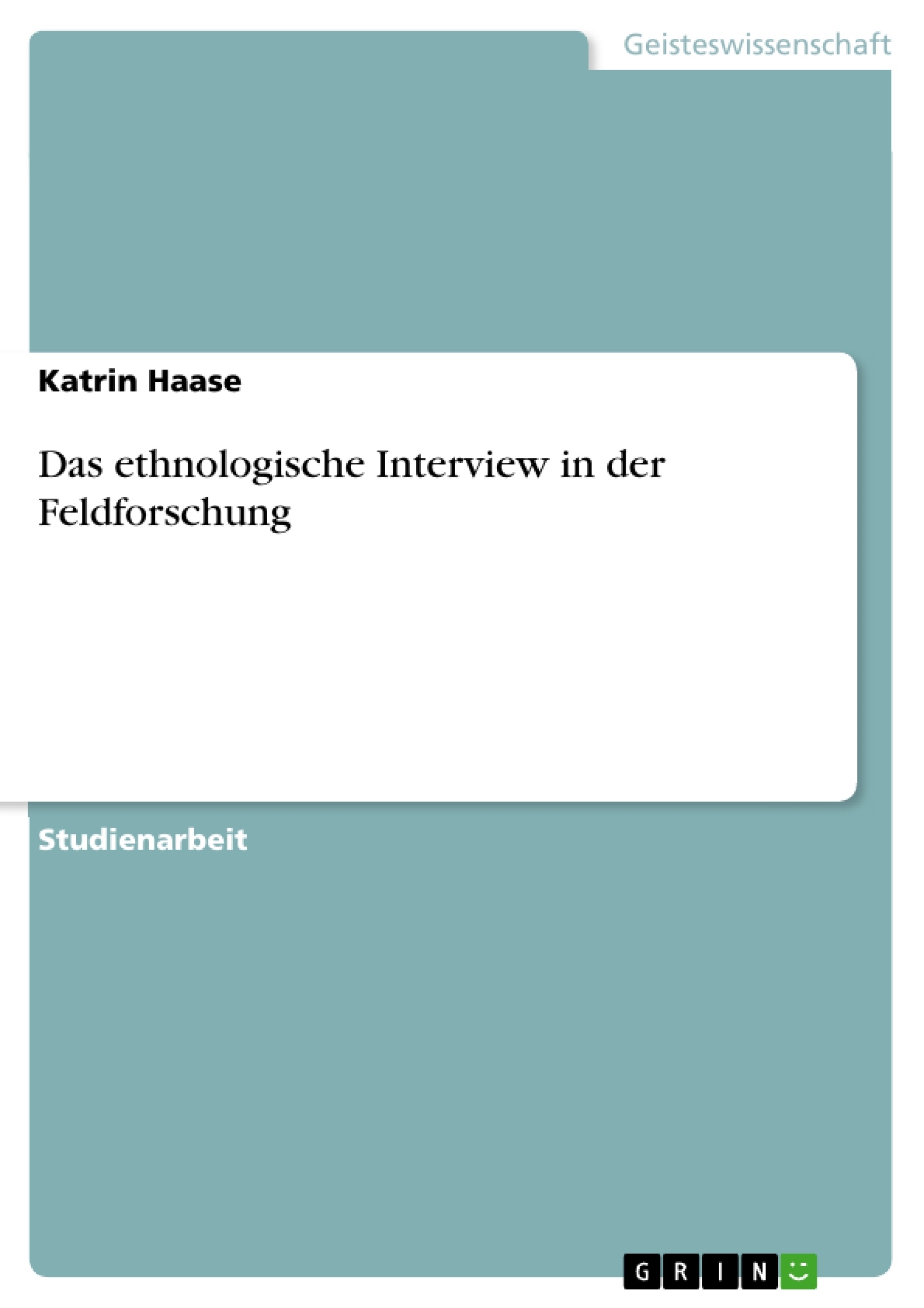Die Feldforschung und die damit verbundene Methode der teilnehmenden Beobachtung ist das elementare Charakteristikum der Ethnologie.1 Die teilnehmende Beobachtung wiederum geht einher mit dem ethnologischen Interview, einer für die Ethnologie spezifischen Vorgehensweise des wissenschaftlichen Gesprächs. In meiner Abhandlung werde ich auf die Besonderheiten dieser Methode eingehen. Dabei werde ich sie in den Kontext anderer sozialwissenschaftlicher Interviewmethoden einordnen. Besondere Aufmerksamkeit gebührt den Fragen, inwiefern man allgemein gültige Regeln für die Durchführung des ethnologischen Interviews geltend machen kann und wie die Wissenschaftlichkeit dieser Methode zu rechtfertigen ist. Eines ist vorab zu klären: Es gibt keine Regeln, die immer und überall anwendbar sind. Das gilt erst recht für die Ethnologie, da sie von der Einmaligkeit der Forschungssituation geprägt ist. Ich stelle die These auf, dass es zu diesem Forschungsansatz keine vorgeschriebenen Regeln geben kann und dadurch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, die herausgefunden werden, und damit auch die Wissenschaftlichkeit der gewonnenen Kenntnisse, in Frage gestellt werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Zielsetzung
- Terminus
- Vorgehen
- 1. Die Symbiose Informant - Ethnologe
- 2. Das ethnologische Interview im wissenschaftlichen Kontext
- 3. Vorgehensweise beim ethnologischen Interview
- 4. Die potentiellen Fehlerquellen
- 4.1 Der Informant
- 4.2 Der Ethnologe
- 5. Das "ero-epische Gespräch"
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung untersucht die Besonderheiten des ethnologischen Interviews als spezifische Methode des wissenschaftlichen Gesprächs in der Feldforschung. Sie ordnet diese Methode in den Kontext anderer sozialwissenschaftlicher Interviewmethoden ein und befasst sich mit der Frage nach allgemein gültigen Regeln für dessen Durchführung sowie der Rechtfertigung seiner Wissenschaftlichkeit. Ein zentraler Punkt ist die Auseinandersetzung mit der These, dass es aufgrund der Einmaligkeit der Forschungssituation keine allgemeingültigen Regeln geben kann und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse somit infrage gestellt wird.
- Das Verhältnis zwischen Ethnologe und Informant und die daraus resultierende spezifische Form der Methode.
- Die Abgrenzung des ethnologischen Interviews von anderen Interviewformen in der Ethnologie.
- Potentielle Fehlerquellen beim ethnologischen Interview, sowohl beim Informanten als auch beim Ethnologen.
- Die Diskussion um allgemein gültige Regeln und die Wissenschaftlichkeit der Methode.
- Das "ero-epische Gespräch" als alternative Bezeichnung und Betrachtungsweise.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Bedeutung der teilnehmenden Beobachtung und des ethnologischen Interviews in der Ethnologie und formuliert die Forschungsfragen. Der Abschnitt "Terminus" diskutiert die Eignung des Begriffs "Interview" im ethnologischen Kontext. "Vorgehen" skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel "1. Die Symbiose Informant - Ethnologe" beleuchtet die besondere Beziehung zwischen Forscher und Informant als Grundlage der Methode. Kapitel "2. Das ethnologische Interview im wissenschaftlichen Kontext" vergleicht das ethnologische Interview mit quantitativen und qualitativen Methoden. Kapitel "3. Vorgehensweise beim ethnologischen Interview" beschreibt praktische Aspekte der Durchführung, wie Vorbereitung, Gesprächsführung und Dokumentation. Kapitel "4. Die potentiellen Fehlerquellen" behandelt mögliche Fehlerquellen beim Informanten und beim Ethnologen, wie z.B. Falschaussagen oder Fehlinterpretationen. Kapitel "5. Das „ero-epische Gespräch“" stellt eine alternative Perspektive auf das Interview dar.
Schlüsselwörter
Ethnologisches Interview, Feldforschung, teilnehmende Beobachtung, qualitative Forschung, Informant, Ethnologe, Wissenschaftlichkeit, Fehlerquellen, Methodenvergleich, "ero-episches Gespräch", emische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am ethnologischen Interview?
Es ist eng mit der teilnehmenden Beobachtung verknüpft und geprägt von der Einmaligkeit der Forschungssituation sowie der engen Beziehung zwischen Ethnologe und Informant.
Gibt es allgemeingültige Regeln für ethnologische Interviews?
Der Autor stellt die These auf, dass es keine festen Regeln geben kann, da jede Situation individuell ist, was jedoch die Vergleichbarkeit und Wissenschaftlichkeit der Ergebnisse erschwert.
Was versteht man unter dem "ero-epischen Gespräch"?
Es ist eine alternative Bezeichnung für das ethnologische Interview, die den fließenden Übergang zwischen Fragen (ero) und Erzählen (episch) betont.
Welche Fehlerquellen gibt es beim Ethnologen?
Fehler können durch Fehlinterpretationen aufgrund des eigenen kulturellen Hintergrunds, falsche Fragestellungen oder eine unzureichende Dokumentation entstehen.
Was ist die "emische Perspektive"?
Es ist der Versuch des Forschers, die Sichtweise und Kategorien der untersuchten Kulturmitglieder (die Innensicht) zu verstehen und darzustellen.
- Quote paper
- Katrin Haase (Author), 2008, Das ethnologische Interview in der Feldforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124418