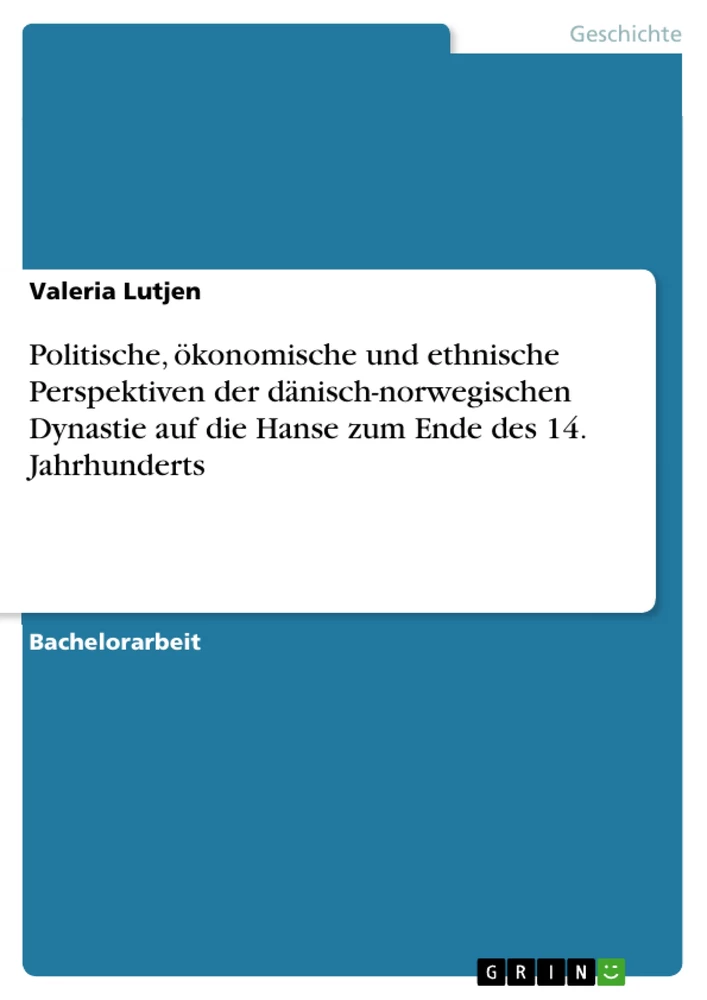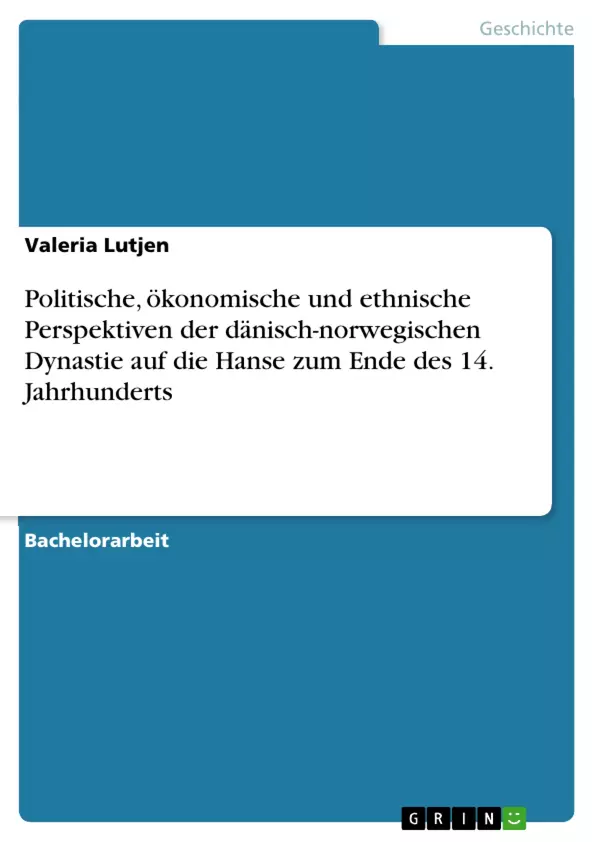Die Gründung der Personalunion zwischen Dänemark und Norwegen wirkt wie eine notwendige Reaktion auf die Vormachtstellung der Hanse im Ostseeraum. Inwieweit die nordischen Länder, insbesondere das dänisch-norwegische Königshaus, die Hanse zum Ende des 14. Jahrhunderts als Opponentin einstuften oder sie in ihrem Interesse benutzten, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Perspektiven der dänisch-norwegischen Dynastie auf die Hanse zwischen 1370 und 1380. Folglich geht es um die Frage, inwieweit die Hansestädte vom dänisch-norwegischen Königshaus als politische Akteure, Kaufleute mit rein ökonomischem Interesse oder als ethnische Gruppierung betrachtet wurden. Als Untersuchungszeitraum dient die Zeitspanne zwischen dem Stralsunder Frieden, um 1370, und dem Tod Håkons 1380. Im Fokus steht die dänisch-norwegische Dynastie, welche aus den Akteure Waldemar, Håkon, Margareta und Olav sowie den Reichsräten bestand. Dem gegenüber stehen die Hansestädte, welche 1369 einen erfolgreichen militärischen Sieg über Norwegen und Dänemark errangen und damit ihren Handelsvorteil in Skandinavien sichern konnten.
Zu Beginn dieser Arbeit werden die jeweiligen Ausgangslagen des dänisch-norwegischen Königshauses sowie der Hanse um 1370 untersucht. Hierbei stehen die politischen sowie ökonomischen Handlungen im Vordergrund. Nachfolgend werden ausgewählte Quellen vorgestellt sowie in den historischen Kontext gesetzt. Die Einteilung der Untersuchung erfolgt jeweils in politische, ökonomische sowie ethnische Perspektiven. Die nachfolgende Interpretation soll die Dynamik hinter den Verhandlungen zwischen dem dänisch-norwegischen Reich sowie den Hansestädten untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erkenntnisinteresse, Fragestellungen, Aufbau der Arbeit
- Forschungsstand
- Verwendete Quellen und Literatur
- Hauptteil
- Umriss der Ausgangslage im Jahr 1370
- Politische Perspektive
- Ökonomische Perspektive
- Ethnische Perspektiven
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Beziehung der dänisch-norwegischen Dynastie zur Hanse im späten 14. Jahrhundert. Sie untersucht, inwiefern die Hansestädte von der dänisch-norwegischen Dynastie als politische Akteure, Kaufleute mit rein ökonomischen Interessen oder als ethnische Gruppe betrachtet wurden. Das Ziel ist es, die Dynamik hinter den Verhandlungen zwischen dem dänisch-norwegischen Reich und den Hansestädten zu beleuchten.
- Die politische Beziehung zwischen der dänisch-norwegischen Dynastie und der Hanse
- Die ökonomischen Interessen der Hanse und der dänisch-norwegischen Dynastie
- Die ethnische Perspektive auf die Hanse durch die dänisch-norwegische Dynastie
- Die Rolle der Hanse im Konflikt zwischen den nordischen Ländern
- Die Auswirkung des Zweiten Waldemarkrieges auf die Beziehungen zwischen der Hanse und der dänisch-norwegischen Dynastie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage und das Erkenntnisinteresse der Arbeit dar. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und beleuchtet den Forschungsstand zu den Themen der Hanse und der dänisch-norwegischen Dynastie. Außerdem werden die verwendeten Quellen und Literatur vorgestellt.
Hauptteil
Der Hauptteil der Arbeit untersucht die Beziehung der dänisch-norwegischen Dynastie zur Hanse aus verschiedenen Perspektiven: politisch, ökonomisch und ethnisch. Er analysiert die Ausgangslage im Jahr 1370 und setzt die Beziehung der beiden Akteure im Kontext des Zweiten Waldemarkrieges.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Hanse, dänisch-norwegische Dynastie, politisch, ökonomisch, ethnisch, Zweiter Waldemarkrieg, Stralsunder Frieden, Sund, Handelsprivilegien, Skandinavien, Nordische Länder.
Häufig gestellte Fragen
Warum verbündeten sich Dänemark und Norwegen Ende des 14. Jahrhunderts?
Die Gründung der Personalunion war eine notwendige Reaktion auf die starke wirtschaftliche und militärische Vormachtstellung der Hanse im Ostseeraum.
Wie betrachtete die dänisch-norwegische Dynastie die Hanse?
Sie sah die Hanse als einen ambivalenten Akteur: einerseits als notwendige Handelspartner, andererseits als bedrohliche politische Opponenten mit ethnischen Differenzen.
Was war der Stralsunder Friede von 1370?
Es war ein Friedensvertrag nach einem Sieg der Hanse über Dänemark, der den Hansestädten weitreichende Handelsprivilegien und politischen Einfluss in Skandinavien sicherte.
Welche Rolle spielte Königin Margareta in diesem Konflikt?
Margareta war eine zentrale Akteurin der Dynastie, die versuchte, die nordischen Reiche zu festigen und den Einfluss der Hanse strategisch zu begrenzen.
Ging es bei dem Konflikt nur um Geld?
Nein, neben ökonomischen Interessen spielten auch politische Machtansprüche und ethnische Vorurteile zwischen den skandinavischen Adligen und den deutschen Kaufleuten eine große Rolle.
- Quote paper
- Valeria Lutjen (Author), 2022, Politische, ökonomische und ethnische Perspektiven der dänisch-norwegischen Dynastie auf die Hanse zum Ende des 14. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1244342