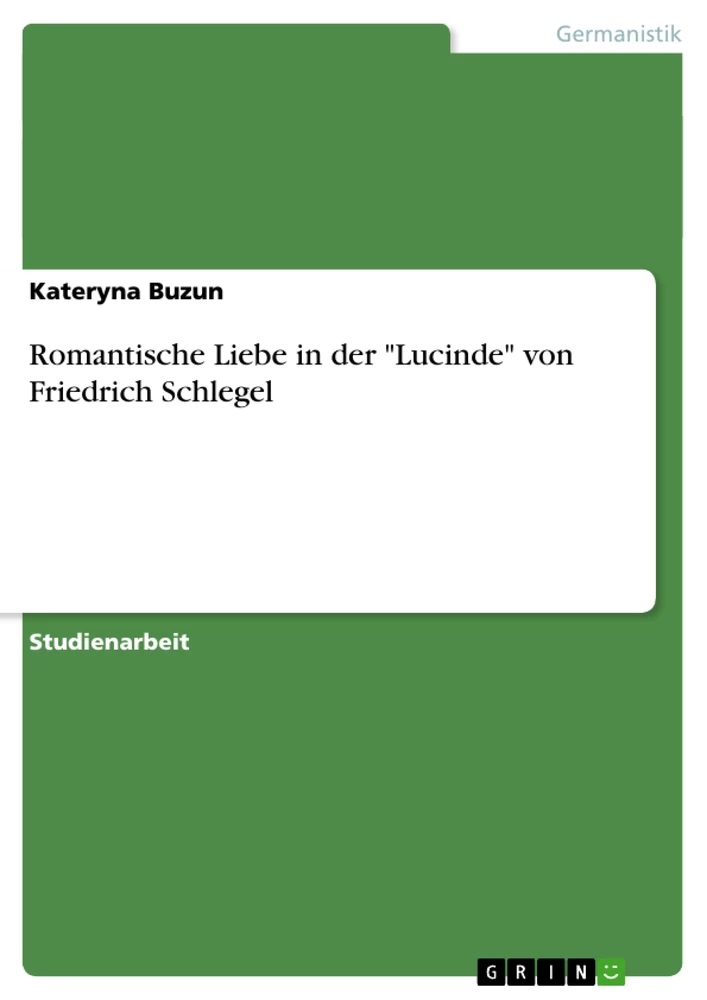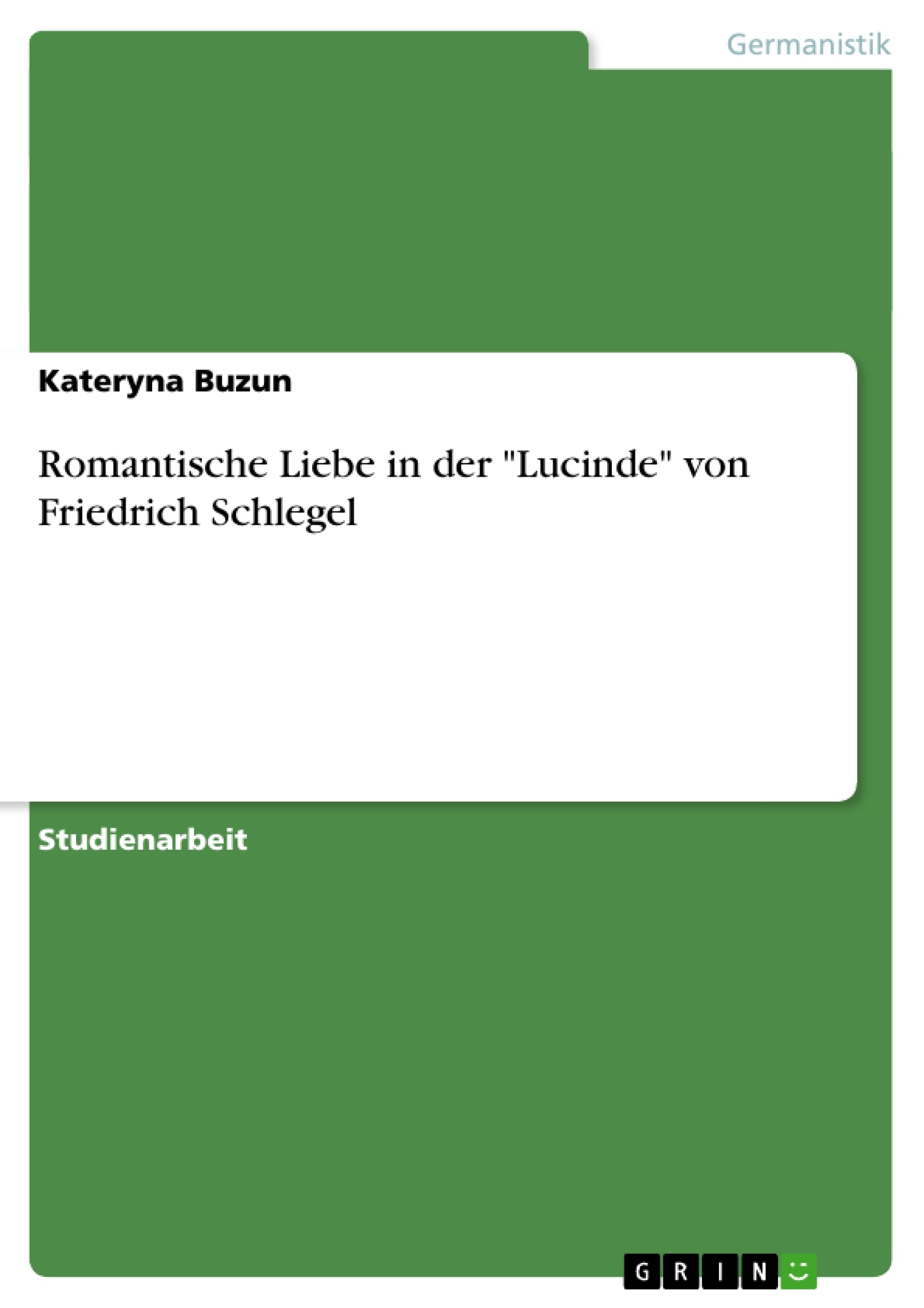Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage der romantischen Liebe in der „Lucinde“ von Friedrich Schlegel. 1799 in Berlin erschienen, rief dieser Roman einen Skandal hervor, da er eine neue und ethisch hohe Auffassung von Liebe und die Darstellung von Sexualität enthielt, die den damaligen Zeiten nicht entsprachen. Im Gegensatz zu den Einstellungen des 18. Jahrhunderts zur Liebe, die zwischen der körperlich-sinnlichen und der geistig-seelischen Verbindung von Mann und Frau unterschieden, betonte Schlegel gerade die Einheit sinnlicher und seelischer Liebe. Damit eröffnete er eine neue Epoche für die soziale Stellung der Frau. Vor der eigentlichen Analyse des Werkes wird in dem ersten Teil der Arbeit die Romantik als Epoche kurz beschrieben. Es wird auch genauer sowohl auf Schlegels Vorstellung über die Liebe als auch auf seine Theorie der Universalpoesie eingegangen. Der zweite Teil wird sich mit dem Roman selbst befassen: Es wird gezeigt, dass es sich in der „Lucinde“ um eine typisch romantische Liebe handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Theorie der romantischen Liebe
- 1.1. Romantik in Deutschland
- 1.2. Universalpoesie nach Fr. Schlegel
- 1.3 Ein Schlüsselroman
- 2. Das Ideal der romantischen Liebe am Beispiel der „Lucinde“
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung romantischer Liebe in Friedrich Schlegels „Lucinde“. Sie beleuchtet den Roman im Kontext der Romantik und Schlegels Theorie der Universalpoesie, um die Besonderheiten der im Roman dargestellten Liebesauffassung zu erhellen.
- Die Romantik als literarische und geistige Bewegung
- Schlegels Theorie der Universalpoesie und deren Einfluss auf „Lucinde“
- Die Darstellung von Liebe in „Lucinde“ im Vergleich zu den Normen des 18. Jahrhunderts
- „Lucinde“ als Schlüsselroman und seine autobiographischen Elemente
- Die gesellschaftliche und moralische Relevanz des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der romantischen Liebe in Schlegels „Lucinde“ ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der erste Teil beschreibt die Romantik als Epoche in Deutschland und Schlegels Konzept der Universalpoesie. Er beleuchtet dabei die Synthese von Philosophie, Religion, Gesellschaft und Kunst innerhalb dieses Konzepts. Der zweite Teil analysiert die Darstellung romantischer Liebe in „Lucinde“, setzt diese in Relation zu den damaligen gesellschaftlichen Normen und betrachtet den Roman als Schlüsselroman, welcher auf einer realen Beziehung basiert.
Schlüsselwörter
Romantische Liebe, Friedrich Schlegel, Lucinde, Romantik, Universalpoesie, Schlüsselroman, Dorothea Veit, gesellschaftliche Normen, 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Schlegels Liebesauffassung in „Lucinde“?
Schlegel betonte die Einheit von sinnlich-körperlicher und seelisch-geistiger Liebe, was im 18. Jahrhundert als skandalös galt.
Was versteht Friedrich Schlegel unter „Universalpoesie“?
Es ist ein Konzept, das Philosophie, Kunst, Religion und Leben miteinander verschmelzen lässt und die Grenzen zwischen literarischen Gattungen aufhebt.
Warum gilt „Lucinde“ als Schlüsselroman?
Der Roman basiert auf der realen Liebesbeziehung zwischen Friedrich Schlegel und Dorothea Veit und spiegelt autobiographische Erlebnisse wider.
Welchen Einfluss hatte der Roman auf die Stellung der Frau?
Durch die Darstellung einer gleichberechtigten, leidenschaftlichen Liebe eröffnete Schlegel neue Perspektiven für die soziale Rolle der Frau in der Romantik.
Warum löste das Werk 1799 einen Skandal aus?
Die explizite Darstellung von Sexualität und die Abkehr von damals herrschenden moralischen Konventionen empörten das zeitgenössische Publikum.
- Quote paper
- Kateryna Buzun (Author), 2007, Romantische Liebe in der "Lucinde" von Friedrich Schlegel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124493