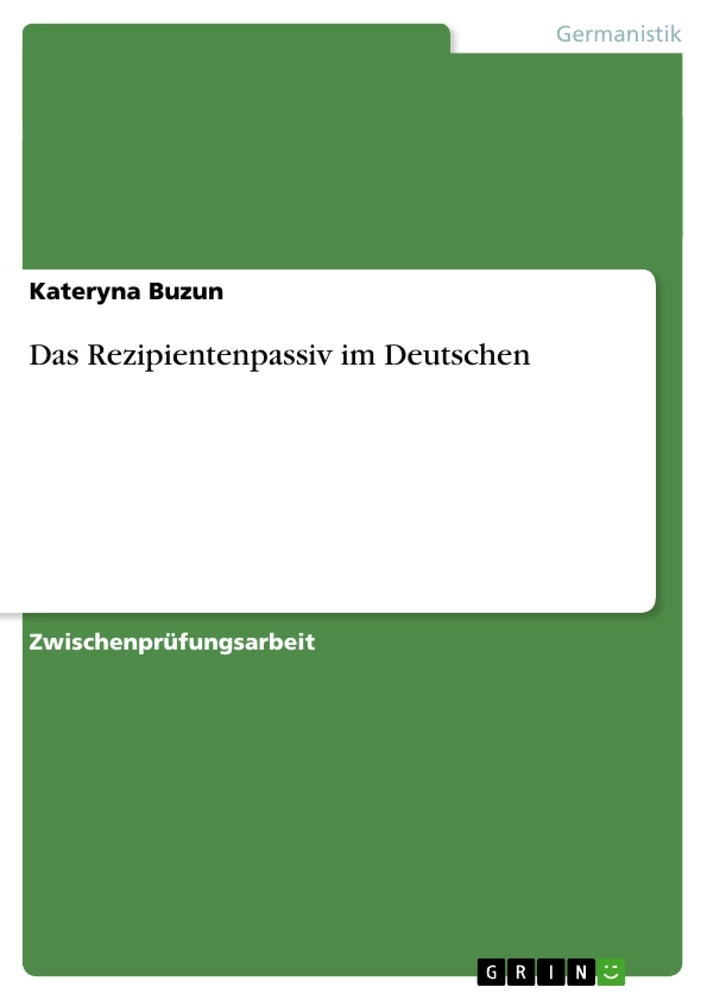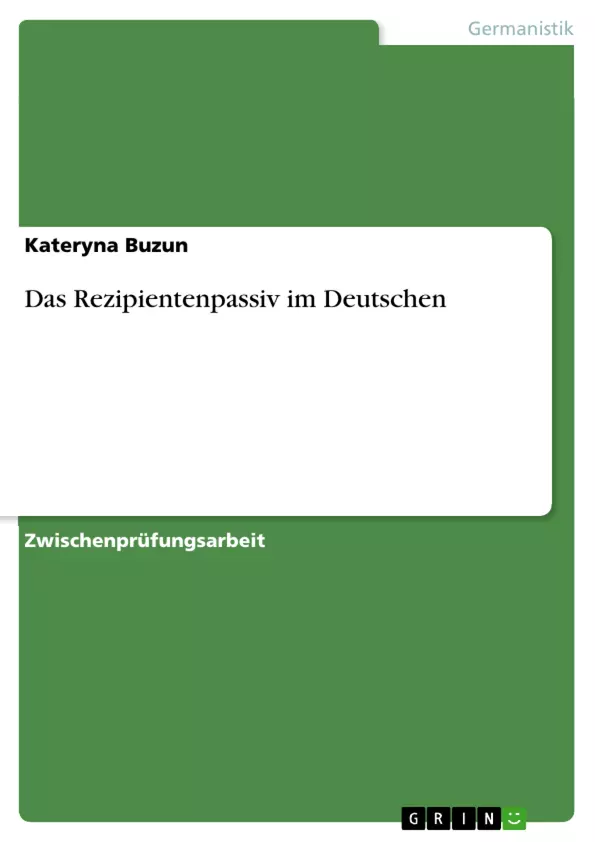Lange Zeit wurde in der linguistischen Literatur das sog. Vorgangspassiv, auch werden-Passiv genannt, als die einzige passivische Konstruktion im Deutschen angesehen. Grund dafür war das Streben, viele grammatische Erscheinungen mit den Regeln der lateinischen Grammatik zu erklären. Da das Latein nur ein Passiv kennt, galt auch die Meinung, dies treffe auch für das Deutsche zu. Erst als viele kontrastive Analysen gezeigt haben, dass es Sprachen mit mehr als einem Passiv gibt (vor allem in den slawischen und skandinavischen, aber auch einigen asiatischen Sprachen), fing man an, auch in der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur von verschiedenen Arten des Passivs zu reden: Zustandspassiv, bekommen-Passiv, bleiben-Passiv, haben-Passiv, gehören-Passiv. Besonders viele Diskussionen hat die Frage des Status des Razipientenpassivs hervorgerufen. Aus der geschichtlichen Sicht lässt sich zuerst das Verb kriegen als eine Komponente des Rezipientenpassivs nachweisen. Das spätere Erscheinen des Verbs erhalten in dieser Funktion kann man mit dem Verhältnis zwischen bekommen und erhalten erklären: Es ist immer durchaus möglich, erhalten durch bekommen zu ersetzen, aber nicht immer ist bekommen durch erhalten substituierbar (Mihailova 2003: 145-146). Der Grund für die Diskussion über den Status des Rezipientenpassivs in der Literatur ist, dass die Verben, mit denen diese Art des Passivs gebildet wird, relativ viel eigenständige Semantik haben: Es ist schwer, die Hilfsverben bekommen, kriegen und erhalten von den entsprechenden Vollverben zu unterscheiden (Pittner/Berman 2004: 74). Anfangs konnte man der Konstruktion bekommen/kriegen/erhalten + Partizip II nur im Zusammenhang mit sog. Verben des Gebens begegnen. In letzter Zeit treten sie jedoch immer öfter in Sätzen auf, deren Vollverb gerade das Gegenteil von geben ausdrückt (Mihailova 2003: 146). Solche Sätze werden trotzdem oft für markiert oder ungrammatisch gehalten, z.B.: [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erläuterung der Begriffe
- 2.1 Genus verbi
- 2.2 Passiv
- 2.3 Das Rezipientenpassiv
- 3. Der umstrittene Status des Rezipientenpassivs
- 3.1 Unterschiede zum Vorgangspassiv
- 3.1.1 Prädikative Beziehung
- 3.1.2 Semantik des Rezipientenpassivs
- 3.2 Argumente für den Passivstatus
- 3.2.1 Prädikativ- oder Passivkonstruktion?
- 3.2.2 Grammatikalisierung
- 3.2.3 Testverfahren
- 3.2.4 Kritik an Gegenargumenten
- 4. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den umstrittenen Status des Rezipientenpassivs im Deutschen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Begrifflichkeiten, der Darstellung der Kontroverse um dessen Einordnung als Passivkonstruktion und der Analyse der Argumente verschiedener Linguisten.
- Erläuterung der Begriffe Genus verbi, Passiv und Rezipientenpassiv
- Unterschiede zwischen Rezipienten- und Vorgangspassiv
- Analyse der Argumente für und gegen den Passivstatus des Rezipientenpassivs
- Diskussion der Semantik der mit dem Rezipientenpassiv verwendeten Verben (bekommen, kriegen, erhalten)
- Bewertung der verschiedenen theoretischen Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Betrachtung des Passivs im Deutschen dar und führt in die Thematik des Rezipientenpassivs und die damit verbundene linguistische Kontroverse ein.
Kapitel 2 (Erläuterung der Begriffe): Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Genus verbi und Passiv, bevor es spezifisch auf das Rezipientenpassiv eingeht und dessen Besonderheiten erläutert.
Kapitel 3 (Der umstrittene Status des Rezipientenpassivs): Hier werden die zentralen Unterschiede zwischen dem Rezipientenpassiv und dem Vorgangspassiv detailliert beschrieben. Die verschiedenen Argumente für und gegen die Einordnung des Rezipientenpassivs als Passivkonstruktion werden vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Rezipientenpassiv, Vorgangspassiv, Genus verbi, Passivkonstruktionen, Grammatikalisierung, deutsche Grammatik, kontrastive Linguistik, bekommen-Passiv, kriegen-Passiv, erhalten-Passiv, Semantik, Syntax.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Rezipientenpassiv?
Das Rezipientenpassiv (auch bekommen-Passiv) ist eine Konstruktion mit den Hilfsverben „bekommen“, „erhalten“ oder „kriegen“ und dem Partizip II (z.B. „Er bekommt das Buch geschenkt“).
Warum ist der Status als „Passiv“ in der Linguistik umstritten?
Kritiker argumentieren, dass die Verben „bekommen“ oder „kriegen“ noch zu viel eigenständige Bedeutung haben und nicht rein grammatische Hilfsverben wie „werden“ sind.
Was unterscheidet das Rezipientenpassiv vom Vorgangspassiv?
Das Vorgangspassiv (werden-Passiv) fokussiert auf das direkte Objekt, während das Rezipientenpassiv das indirekte Objekt (den Empfänger/Dativ-Objekt) zum Subjekt des Satzes macht.
Welche Verben eignen sich für das Rezipientenpassiv?
Ursprünglich waren es primär „Verben des Gebens“ (schenken, leihen). Heute wird die Konstruktion aber auch bei Verben verwendet, die das Gegenteil ausdrücken (z.B. „den Pass entzogen bekommen“).
Gibt es stilistische Unterschiede zwischen „bekommen“, „erhalten“ und „kriegen“?
Ja, „erhalten“ gilt als formell, „bekommen“ als standardsprachlich neutral und „kriegen“ als eher umgangssprachlich.
- Quote paper
- Kateryna Buzun (Author), 2008, Das Rezipientenpassiv im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124498