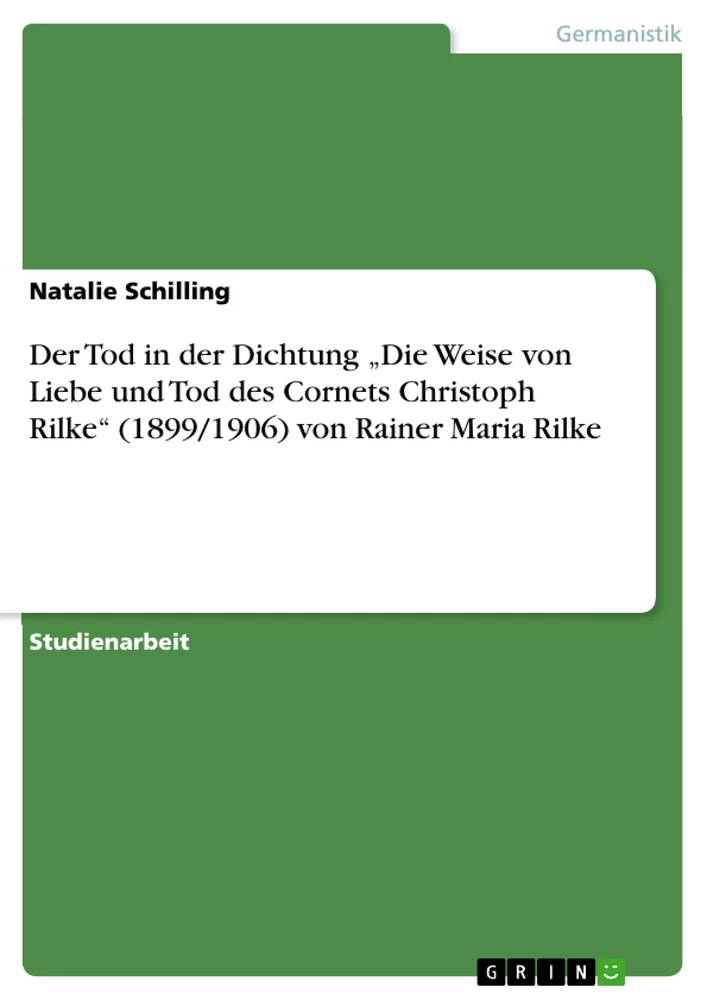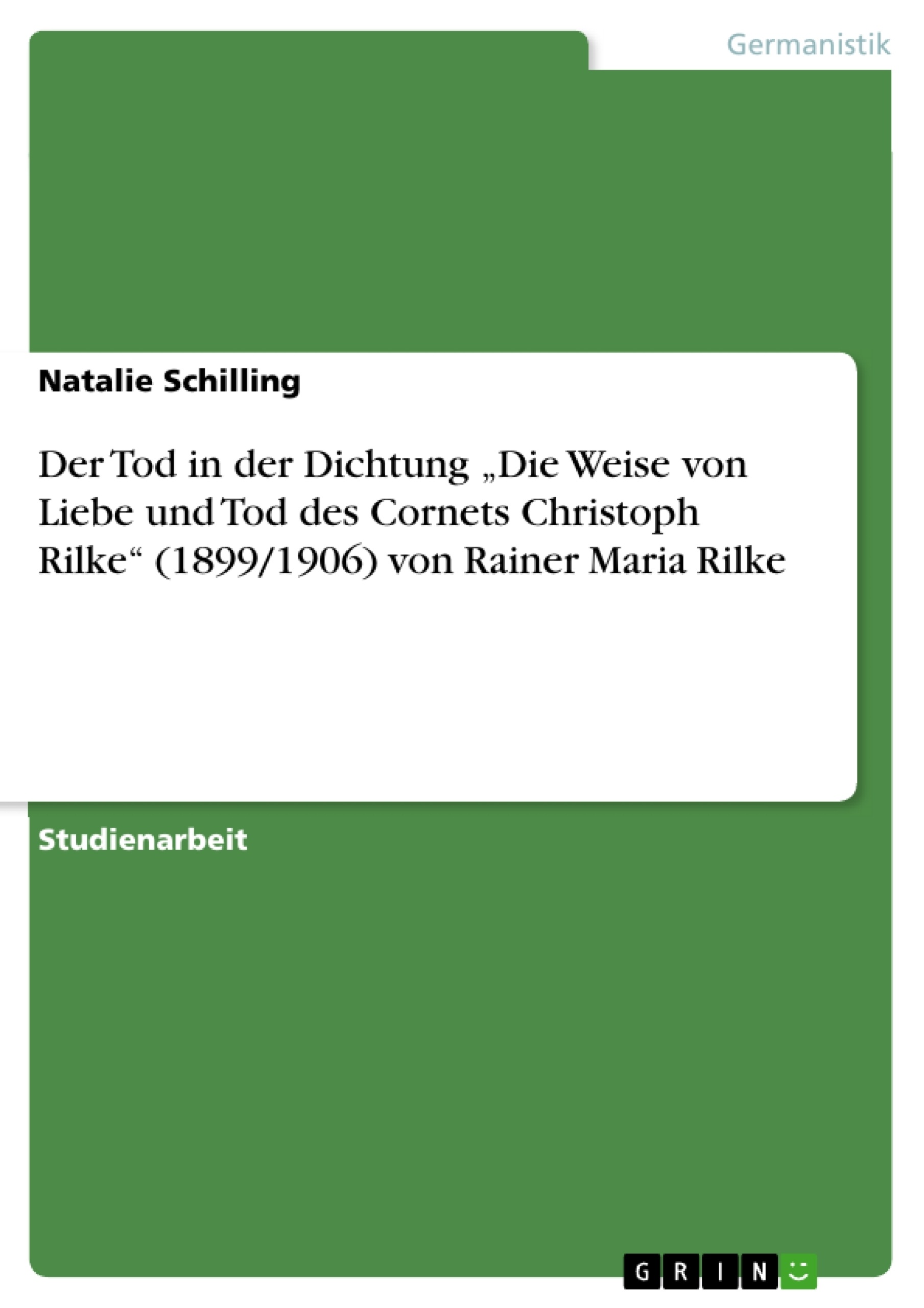Der Tod ist ein unerklärbares Urphänomen, das nicht wirklich verstanden werden kann. Er bestimmt alles Leben entscheidend als begrenzender Faktor mit.
In Perioden tief greifender geschichtlicher Umbrüche, so auch dem frühen 20. Jahrhundert, zeigt die Literatur heftige Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Sterben. Die Figuren eines literarischen Textes entwickeln eine besondere Beziehung zum Tod, denn das Wissen, sterben zu müssen, beeinflusst die Konzeption der menschlichen Entwicklung, die vergangenes und zukünftiges Leben in ein anderes Licht rückt. Leben bedeutet eine bewusste Auseinandersetzung mit der Frage des Sterbens oder den Versuch, die Todessehnsucht zu überwinden. Auffallend für die Literatur um 1900 ist der Wandel ästhetischer Ausdrucksformen, die darüber hinaus eine Vielzahl neuer Stiltendenzen mit sich brachte. Die Veränderungen lassen sich auf die durch Industrialisierung und Urbanisierung des Lebensraums hervorgerufenen Wandlungen im Erfahrungs- und Wahrnehmungsbereich zurückführen. Die Jahrhundertwende war geprägt durch Wirtschaftswachstum, Bevölkerungsexplosion, Landflucht und politische Resignation. Das Bildungsbürgertum war auf der einen Seite einer wachsenden Unsicherheit durch Technik und Lebensbedingungen einer Industriegesellschaft ausgesetzt, auf der anderen Seite entwickelte sich ein neues menschliches Selbstbewusstsein, der Mensch wurde durch die neue Technik Herr über das Sein und Nichtsein in der Welt. Die Religion bot keine ausreichenden Antworten auf neu entstehende Fragen in diesem Zusammenhang. Es gab keinen gegebenen Daseinszweck, eine Krise des Lebens und gleichsam des Todes entstand, sowie die Frage, was nach dem Tod folgt. In diesem Zusammenhang stehen Trennungsangst und Angst vor dem Verlust der Autonomie und der Individualität durch den Tod, ein Kontrollverlust des selbstkontrollierten technischen Menschen, der hier in seine Grenzen verwiesen wird. Die einzige Möglichkeit der eigenen Todesentscheidung ist der Selbstmord. Deshalb ist das Todesthema oft mit Motivbereichen kombiniert, die in der Geschichte menschlicher Ängste eine herausragende Rolle spielen wie Wasser, Feuer, Nacht und Erotik.
Durch diese Umbrüche und Wandlungen im Leben der Menschen wurde ein Prozess evoziert, welcher als Subjektivierung bezeichnet wird, weil sich der Mensch aus seiner passiven Rolle, nämlich Objekt der Geschichte zu sein, löst und sich zum Subjekt der Weltgeschichte macht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Todesthematik in der Literatur
- I.2 Untersuchungsgegenstand und Thema der Seminararbeit
- II Der Tod
- II.1 Der Tod des Cornets in der Forschung
- II.2 Der Tod im „Cornet“
- II.3 Menschliche und göttliche Gewalt
- II.3.1 Männlichkeit
- II.3.2 Weiblichkeit
- II.3.2.1 Die Frauengestalten im „Cornet“
- II.3.2.2 Mutterrolle
- II.3.2.3 Rilkes Mutterbezug
- III. Tod und Liebe
- III.1 Menschliche und göttliche Liebe
- III.2 Die Liebe im „Cornet“
- III.3 Das Motiv des Traums als Verknüpfung von Liebe und Tod
- IV Subjekt und Identität
- V Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Darstellung des Todes in Rainer Maria Rilkes frühem Werk „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“. Ziel ist es, die im Text vorhandenen Zusammenhänge zwischen Tod und Liebe sowie die Frage nach Identität und Subjektivität zu klären, unter Berücksichtigung des historischen Kontextes der Jahrhundertwende und in Bezugsetzung zu Rilkes Biographie.
- Der Tod als zentrales Motiv und seine Darstellung in Rilkes Gedicht.
- Die Beziehung zwischen Tod und Liebe im Werk.
- Die Rolle von Männlichkeit und Weiblichkeit in Bezug auf den Tod.
- Die Frage nach Identität und Subjektivität des Cornets.
- Der Einfluss des historischen Kontextes der Jahrhundertwende auf die Thematik.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Todes in der Literatur der Jahrhundertwende ein. Sie beleuchtet den Tod als ein unerklärliches Phänomen und dessen besondere Bedeutung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Der Wandel ästhetischer Ausdrucksformen, bedingt durch Industrialisierung und Urbanisierung, wird ebenso thematisiert wie die daraus resultierende Krise des Lebens und des Todes, die sich in der Literatur widerspiegelt. Die Abwehrhaltung der Gesellschaft gegenüber dem Tod und die daraus resultierenden Versuche, ihn zu überwinden oder zu verarbeiten, werden ebenfalls diskutiert. Abschließend wird der Fokus auf Rilkes „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ und die Forschungsfragen der Arbeit gelegt.
II Der Tod: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Tod des Cornets in Rilkes Gedicht und der Interpretation dieses Motivs in der Forschung. Es werden verschiedene Forschungsansätze vorgestellt, die den Tod des Cornets mal als ästhetisches Ende eines jugendlichen Heldentums, mal als sinnvolles Schicksal interpretieren. Die unterschiedlichen Perspektiven zeigen die Komplexität des Werks auf. Kritische Auseinandersetzung mit bisherigen Interpretationen, welche den Tod des Cornets oft vereinfacht und unter rein ästhetischen Gesichtspunkten betrachten, bildet einen wichtigen Teil des Kapitels.
III. Tod und Liebe: Dieses Kapitel analysiert das komplexe Verhältnis von Tod und Liebe in Rilkes Gedicht. Es untersucht, wie Rilke Liebe und Tod miteinander verknüpft und welche Rolle das Motiv des Traums dabei spielt. Die Analyse fokussiert auf die Interdependenz beider Motive und deren Bedeutung für das Verständnis der Gesamtkomposition. Die Kapitel untersuchen, wie die Darstellung dieser Themen die literarischen und gesellschaftlichen Strömungen der Jahrhundertwende widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Tod, Liebe, Rainer Maria Rilke, Jahrhundertwende, „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“, Jugend, Heldentum, Identität, Subjektivität, Männlichkeit, Weiblichkeit, Gesellschaftliche Umbrüche, Ästhetik, Todesthema in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu Rilkes "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert Rainer Maria Rilkes "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke", insbesondere die Darstellung des Todes und seine Beziehung zur Liebe, sowie Fragen der Identität und Subjektivität. Sie betrachtet den Text im Kontext der Jahrhundertwende und unter Einbezug von Rilkes Biographie. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zum Tod, zum Verhältnis von Tod und Liebe, zu Subjekt und Identität sowie eine Zusammenfassung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Zentrale Themen sind der Tod als zentrales Motiv und seine Darstellung, das Verhältnis von Tod und Liebe, die Rollen von Männlichkeit und Weiblichkeit im Kontext des Todes, die Frage nach der Identität und Subjektivität des Cornets sowie der Einfluss des historischen Kontextes der Jahrhundertwende.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den Tod in der Literatur der Jahrhundertwende einführt, ein Kapitel zum Tod des Cornets und dessen Interpretationen in der Forschung, ein Kapitel zum Verhältnis von Tod und Liebe, inklusive der Rolle des Traums, ein Kapitel zu Subjekt und Identität und schließlich eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit gestellt?
Die Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Tod und Liebe in Rilkes Gedicht, klärt die Frage nach Identität und Subjektivität des Cornets und berücksichtigt den historischen Kontext der Jahrhundertwende und Rilkes Biographie. Sie hinterfragt vereinfachende Interpretationen des Todesmotivs und beleuchtet die Komplexität des Werks.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Tod, Liebe, Rainer Maria Rilke, Jahrhundertwende, "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke", Jugend, Heldentum, Identität, Subjektivität, Männlichkeit, Weiblichkeit, Gesellschaftliche Umbrüche, Ästhetik, Todesthema in der Literatur.
Wie werden Liebe und Tod in Rilkes Gedicht dargestellt?
Die Arbeit analysiert die komplexe Verknüpfung von Liebe und Tod in Rilkes Gedicht. Sie untersucht die Interdependenz beider Motive und ihre Bedeutung für das Verständnis der Gesamtkomposition, wobei die Rolle des Traums als verbindendes Element hervorgehoben wird. Die Darstellung dieser Themen im Kontext der literarischen und gesellschaftlichen Strömungen der Jahrhundertwende wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird der Tod des Cornets interpretiert?
Das Kapitel zum Tod des Cornets präsentiert verschiedene Forschungsansätze, die den Tod mal als ästhetisches Ende eines jugendlichen Heldentums, mal als sinnvolles Schicksal interpretieren. Die Arbeit setzt sich kritisch mit bisherigen Interpretationen auseinander, die den Tod oft vereinfacht und unter rein ästhetischen Gesichtspunkten betrachten.
Welchen Einfluss hat der historische Kontext?
Der historische Kontext der Jahrhundertwende, geprägt von gesellschaftlichen Umbrüchen, Industrialisierung und Urbanisierung, spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der Thematik. Die Arbeit thematisiert den Wandel ästhetischer Ausdrucksformen und die daraus resultierende Krise des Lebens und des Todes, die sich in der Literatur widerspiegelt.
- Quote paper
- Natalie Schilling (Author), 2007, Der Tod in der Dichtung „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ (1899/1906) von Rainer Maria Rilke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124505