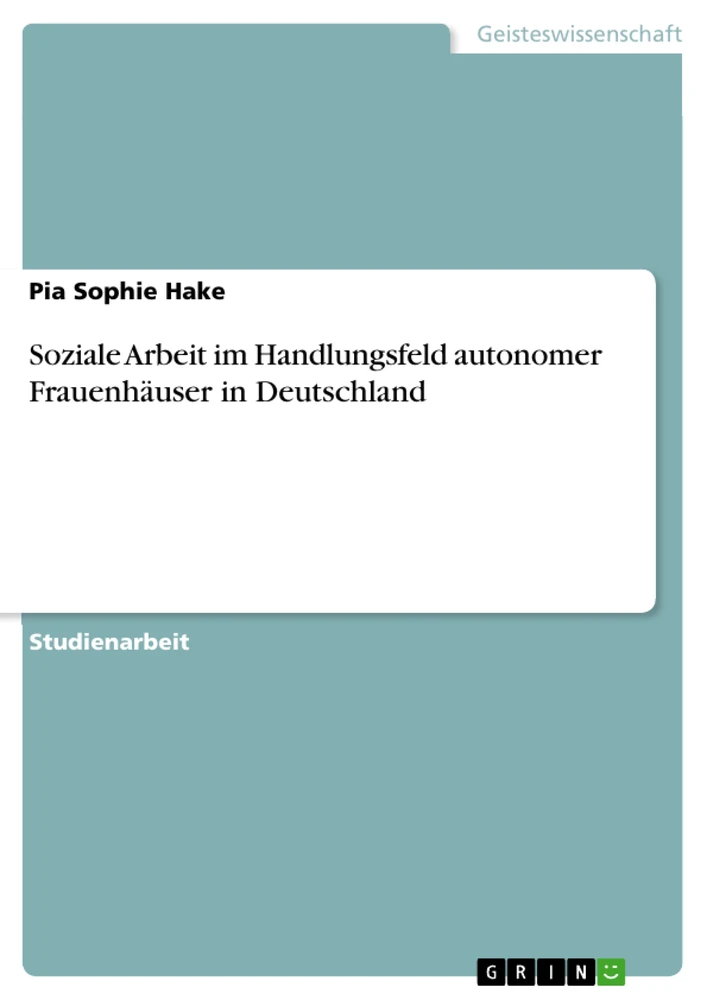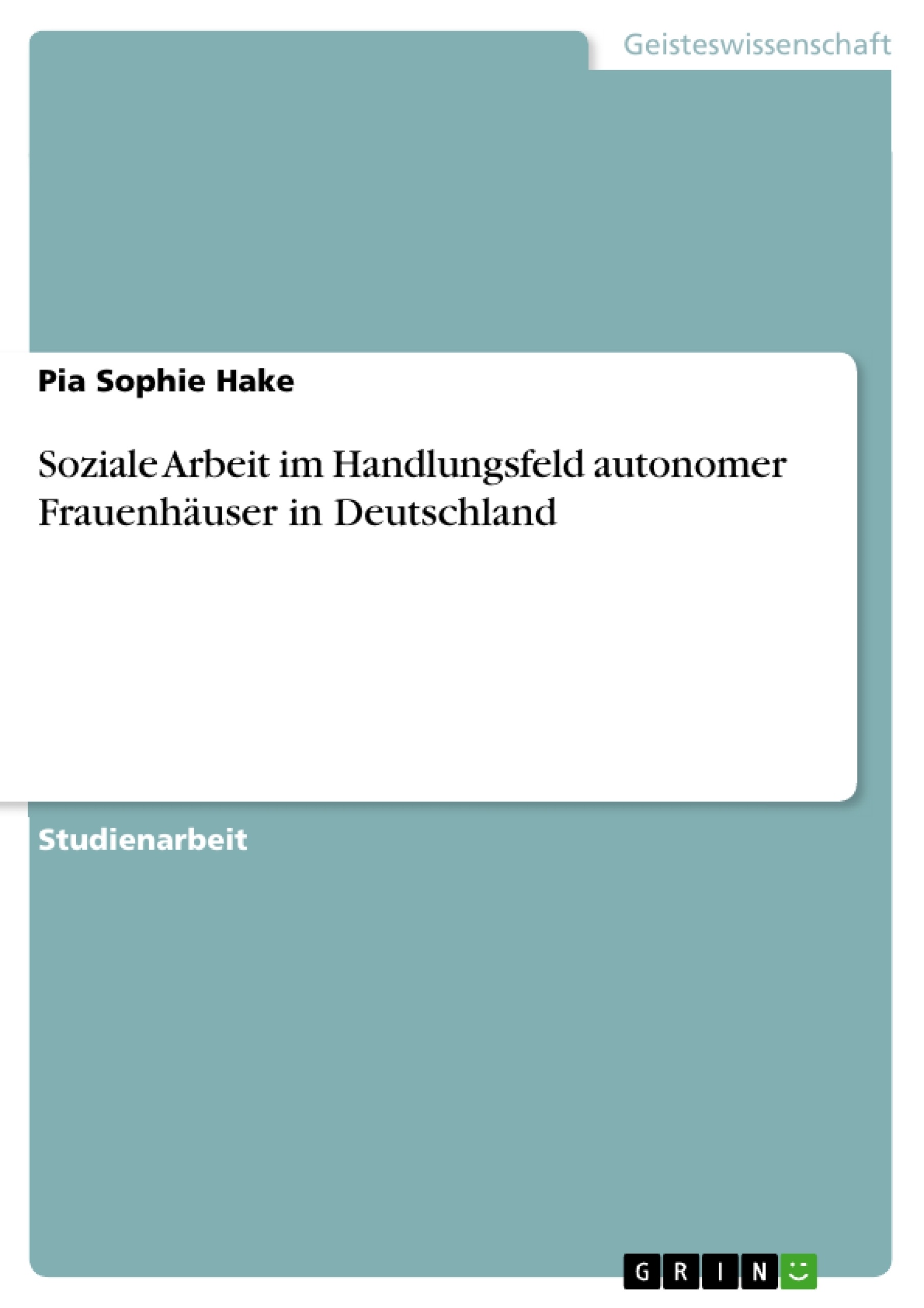Die Arbeit thematisiert autonome Frauenhäuser und Fachberatungsstellen für Gewalt in der Partnerschaft in Deutschland. Was können Betroffene tun, um sich und ihre Kinder vor Angriffen zu schützen? Und was gibt das deutsche Hilfesystem für Frauen so her? Gibt es auf der Welt Länder, die sich vorbildlicher mit diesem Thema befassen und stärker umsetzen?
Ziel dieser Arbeit ist es, durch die Darstellung von Geschichte und Organisation und die Erläuterung einiger Methoden einen Einblick in das Arbeitsfeld Frauenhaus zu gewinnen. Zunächst wird die Geschichte, das heißt der Entwicklungsprozess, auf dem die aktuellen Gegebenheiten des Arbeitsfeldes aufbauen, dargestellt und in die Thematik eingeleitet. Darauf folgt eine Darstellung der Organisation des Arbeitsfeldes. Folgend werden die innerhalb dieses Feldes angewendeten Methoden erläutert und mit den Zielen und Adressaten in Verbindung gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Geschichte der Frauenhäuser
- 1.1 Erste Frauenbewegung
- 1.2 Zweite Frauenbewegung
- 2. Organisation des Handlungsfeldes Frauenhaus
- 2.1 Rechtliche Grundlagen
- 2.2 Trägerstrukturen
- 2.3 Finanzierung
- 2.4 Adressaten
- 2.5 Aufgaben
- 2.6 Ziele und Rahmenbedingungen
- 3. Methodisches Handeln und Handlungskompetenzen in der Sozialen Arbeit
- 4. Methodisches Handeln im Handlungsfeld Frauenhaus
- 4.1 Die Einzelfallhilfe
- 4.2 Die Soziale Gruppenarbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Handlungsfeld der autonomen Frauenhäuser in Deutschland. Ziel ist es, einen Einblick in die Geschichte, Organisation und Methoden dieses Arbeitsfeldes zu geben, um relevante Fragen zum Schutz von Frauen vor Gewalt in Partnerschaften zu beantworten.
- Entwicklung des Handlungsfeldes Frauenhaus im historischen Kontext
- Rechtliche Grundlagen, Trägerstrukturen und Finanzierung von Frauenhäusern
- Zielgruppen, Aufgaben und Rahmenbedingungen der Arbeit in Frauenhäusern
- Methoden der Sozialen Arbeit, die in Frauenhäusern angewendet werden
- Bedeutung der Einzelfallhilfe und Sozialen Gruppenarbeit im Kontext von häuslicher Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Bedeutung von Frauenhäusern als Schutzraum für Frauen, die von Gewalt in Partnerschaften betroffen sind. Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung der Frauenbewegung in Deutschland und zeigt die Anfänge des Engagements für Frauenrechte auf. Kapitel 2 beschreibt die Organisation des Handlungsfeldes Frauenhaus, einschließlich rechtlicher Grundlagen, Trägerstrukturen, Finanzierung, Adressaten und Aufgaben.
Schlüsselwörter
Frauenhäuser, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Soziale Arbeit, Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit, Geschichte der Frauenbewegung, Organisation des Handlungsfeldes, Rechtliche Grundlagen, Finanzierung, Adressaten, Methoden der Sozialen Arbeit, Empowerment.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptaufgabe eines autonomen Frauenhauses?
Ein Frauenhaus bietet Schutz, Unterkunft und Beratung für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt oder Gewalt in der Partnerschaft betroffen sind.
Welche Rolle spielte die Frauenbewegung bei der Entstehung von Frauenhäusern?
Sowohl die erste als auch die zweite Frauenbewegung waren entscheidend für die Thematisierung von Gewalt gegen Frauen und den Aufbau der ersten autonomen Schutzstrukturen in Deutschland.
Welche Methoden der Sozialen Arbeit werden dort angewendet?
Vorrangig werden die Einzelfallhilfe zur individuellen Unterstützung und die Soziale Gruppenarbeit zum Austausch und zur Stärkung (Empowerment) der Betroffenen genutzt.
Wie werden Frauenhäuser in Deutschland finanziert?
Die Finanzierung ist oft komplex und erfolgt über eine Mischung aus staatlichen Zuschüssen, Tagessätzen, Eigenmitteln der Träger und Spenden.
Was ist das Ziel des „Empowerment“-Ansatzes in der Frauenhausarbeit?
Ziel ist es, die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern, damit sie nach der Gewalterfahrung wieder die Kontrolle über ihr eigenes Leben gewinnen können.
- Arbeit zitieren
- Pia Sophie Hake (Autor:in), 2022, Soziale Arbeit im Handlungsfeld autonomer Frauenhäuser in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1245259