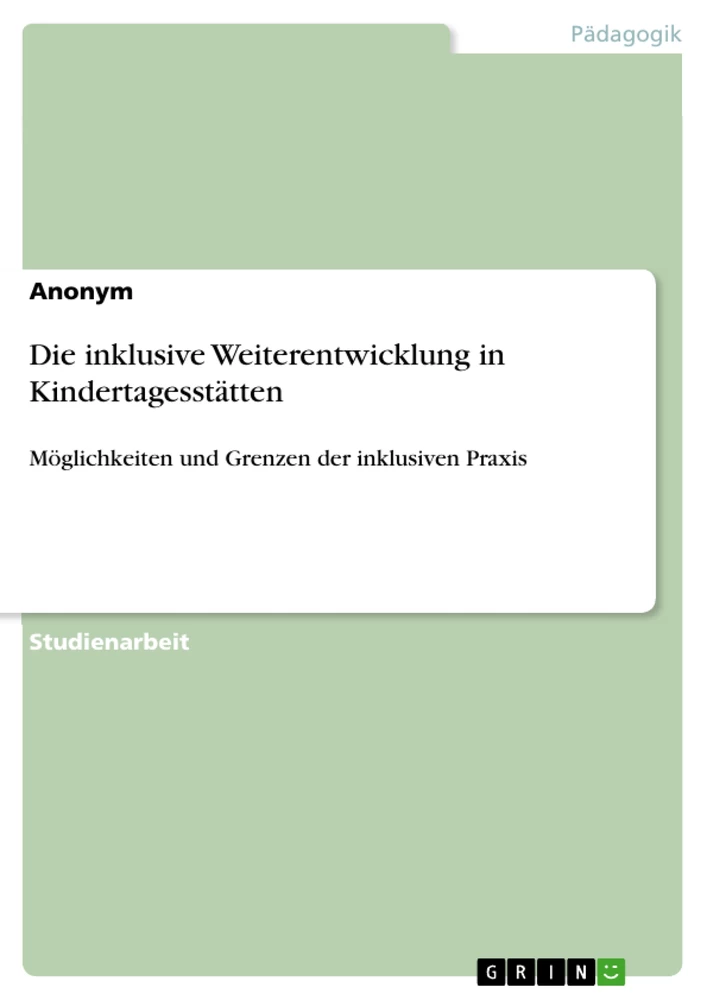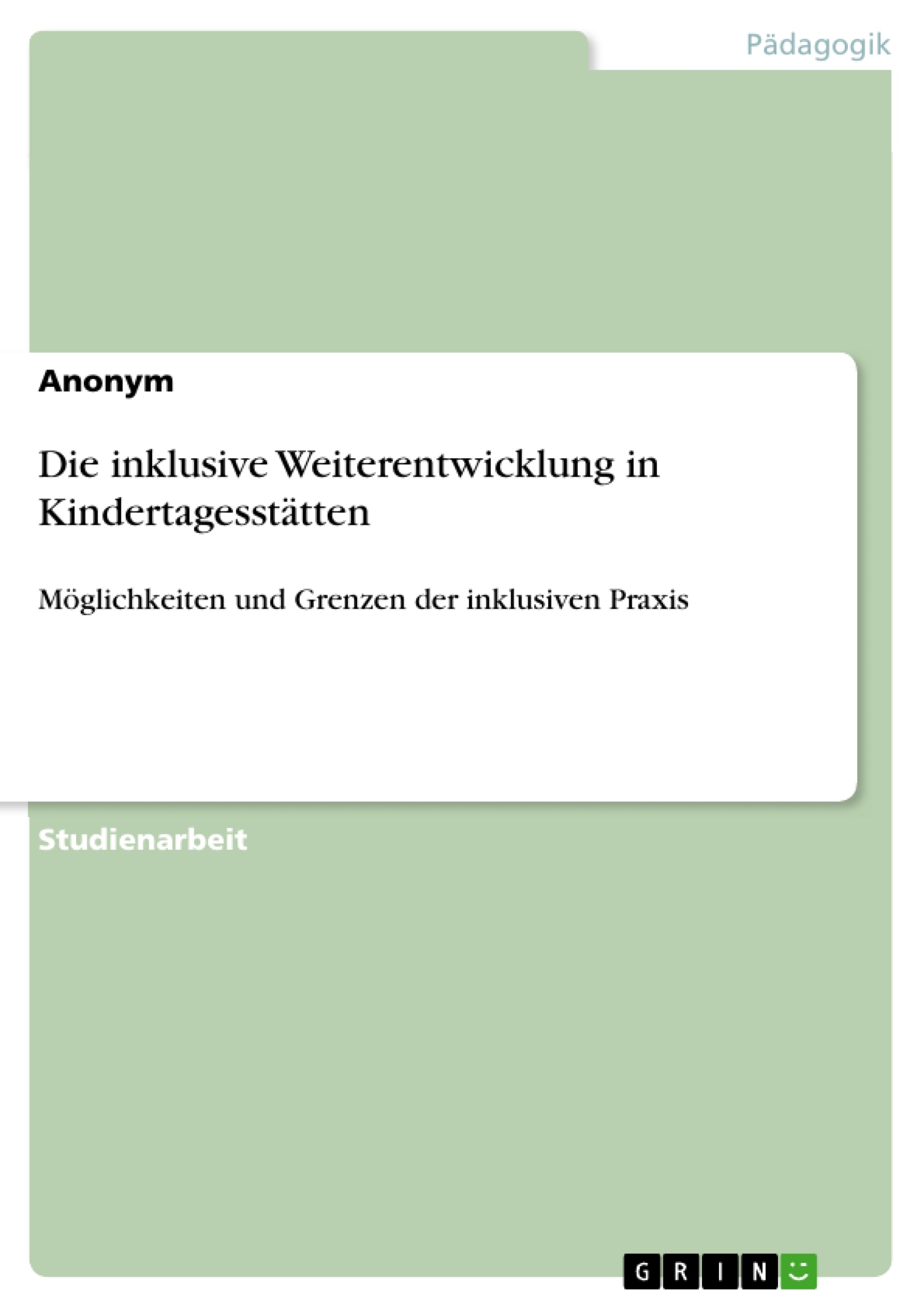Die Arbeit befasst sich mit dem Thema inklusive Weiterentwicklung in Kindertageseinrichtungen. Ziel der Arbeit ist es, ein Verständnis über die inklusive Weiterentwicklung in Kindertagesstätten zu erlangen und die daraus resultierenden Möglichkeiten und Grenzen der inklusiven Praxis zu untersuchen.
Der erste Teil befasst sich mit den theoretischen Grundlagen. Darin wird unter anderem der Index für Inklusion genauer beschrieben und zwei weitere Theorien zur Inklusionsentwicklung in Kurzform dargestellt. Der zweite Teil beinhaltet die Befunde zur aktuellen Lage der inklusiven Weiterentwicklung und den damit verbundenen Möglichkeiten und Grenzen in den Kindertagesstätten. Anschließend wird im dritten Teil die Konsequenz für die Praxis in den Einrichtungen beschrieben.
Aufgrund der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen hat sich Deutschland 2006 verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen. Dieses System bezieht sich nicht nur auf den schulischen Bereich, sondern auch auf den frühkindlichen Bereich. Doch Inklusion ist noch lange nicht in allen frühpädagogischen Einrichtungen angekommen. Die Umsetzung bedarf eine Weiterentwicklung der Praxis hin zur inklusiven Praxis. Eine Unterschrift eines Vertrags und zahlreiche Leitlinien und Pläne alleine reichen nicht aus. Zudem bringt die inklusive Praxis einige Möglichkeiten mit sich, stellt die Einrichtung aber auch vor aufkommende Grenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Ausgangssituation
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsbestimmungen
- Integration
- Inklusion
- Rechtliche Grundlage
- UN-Kinderrechtskonvention
- Salamanca-Erklärung
- Begriffsbestimmungen
- Befunde zur inklusiven Weiterentwicklung
- Konsequenzen für die Kita Praxis
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die inklusive Weiterentwicklung in Kindertagesstätten und analysiert die daraus resultierenden Möglichkeiten und Grenzen der inklusiven Praxis. Sie zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Umsetzung von Inklusion in der frühkindlichen Bildung zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Integration und Inklusion
- Relevante rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere die UN-Kinderrechtskonvention und die Salamanca-Erklärung
- Analyse der aktuellen Situation der inklusiven Weiterentwicklung in Kindertagesstätten
- Herausforderungen und Chancen der inklusiven Praxis
- Konsequenzen für die praktische Arbeit in Kindertageseinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Ausgangssituation und beleuchtet die Relevanz der inklusiven Weiterentwicklung in Kindertagesstätten. Es stellt die rechtliche Grundlage für Inklusion in Deutschland dar, die auf der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen beruht. Der zweite Teil befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Inklusion. Hier werden die Begriffe Integration und Inklusion im Detail erläutert und die Unterschiede zwischen diesen pädagogischen Ansätzen herausgestellt. Das Kapitel behandelt zudem wichtige rechtliche Grundlagen wie die UN-Kinderrechtskonvention und die Salamanca-Erklärung, die den Rahmen für die Inklusionsdiskussion in der frühkindlichen Bildung setzen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, Kindertagesstätten, Frühpädagogik, UN-Kinderrechtskonvention, Salamanca-Erklärung, Heterogenität, Individuelle Bedürfnisse, Teilhabe, Gemeinsames Lernen, Weiterentwicklung, Praxis, Möglichkeiten, Grenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion in der Kita?
Integration zielt darauf ab, Kinder mit Defiziten in ein bestehendes System einzugliedern. Inklusion hingegen bedeutet, dass das System von vornherein so gestaltet ist, dass es der Heterogenität aller Kinder gerecht wird und Barrieren für jeden abbaut.
Welche rechtliche Verpflichtung hat Deutschland zur Inklusion?
Durch die Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2006 hat sich Deutschland verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen, das bereits im frühkindlichen Bereich (Kitas) beginnt.
Was ist der "Index für Inklusion"?
Der Index für Inklusion ist ein Instrument zur Selbstevaluation und Weiterentwicklung von Einrichtungen. Er hilft Kitas dabei, inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken zu etablieren.
Welche Grenzen gibt es bei der Umsetzung von Inklusion in Kitas?
Grenzen liegen oft in unzureichenden personellen Ressourcen, fehlender fachlicher Qualifikation der Erzieher, räumlichen Gegebenheiten oder mangelnder finanzieller Unterstützung durch die Träger.
Welche Konsequenzen hat die inklusive Praxis für den Kita-Alltag?
Erzieher müssen individueller auf die Bedürfnisse jedes Kindes eingehen, die pädagogische Planung flexibler gestalten und eine Haltung entwickeln, die Vielfalt als Bereicherung und nicht als Belastung sieht.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Die inklusive Weiterentwicklung in Kindertagesstätten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1245742